Beurteilung im Licht Gottes
Die Frage Asaphs lautete: Warum geht es auf der Erde vielen Ungläubigen oft besser als den Gottesfürchtigen? Er versuchte, in seinen Gedanken eine Antwort darauf zu finden. Doch er fand sie nicht bei sich selbst.
Erst als er in die Gegenwart Gottes trat, erkannte er im göttlichen Licht das wahre Ende der Ungläubigen. Da gingen ihm die Augen auf. Er sah das schreckliche Ende derer, die ohne Gott gelebt haben. Für sie bleibt nur das Gericht (Psalm 73,18-20; Hebräer 9,27).
Nun schämte sich Asaph, dass er solche Gedanken gehabt hatte. Er bekannte: «Da war ich dumm und wusste nichts.» Im Licht der Gegenwart Gottes verurteilte er aber nicht nur seine verkehrten Gedanken, sondern fand auch zurück in den Genuss der Gemeinschaft mit seinem Gott. Er realisierte: Gott hat mich nicht losgelassen.
Auch für uns ist es gut zu wissen, dass nicht wir den Herrn festhalten müssen. Dann wüsste keiner von uns, ob er das Ziel auch erreicht. Aber Er hat unsere Hand erfasst und hält sie fest, bis Er uns ans Ziel in die Herrlichkeit gebracht hat. Darin liegt unsere Sicherheit. Das gibt uns Ruhe.
Wer einen solchen Herrn im Himmel hat und seine Hilfe auf der Erde erfahren darf, kann ohne Furcht dem Tag seines Abscheidens entgegensehen. Der Tod kann ihn nicht von seinem Herrn und Gott trennen. Möchten wir wie Asaph unsere Zuversicht auf den Herrn setzen und bewusst nahe bei Ihm leben.
Die Feinde im Heiligtum
In diesem Psalm ist die Not Asaphs nicht persönlicher Art wie im vorhergehenden. Jetzt klagt er Gott, dass die Feinde sowohl das Heiligtum als auch das Volk Gottes zu zerstören suchen.
Eine ähnliche Sorge kann auch unser Herz beschleichen. Der Feind sucht auf alle Weise einerseits dem Zeugnis der Versammlung, die heute das geistliche Haus Gottes bildet, zu schaden. Anderseits versucht er die einzelnen Gläubigen vom Herrn abzuziehen oder zu verwirren. Verweltlichung, d.h. sich der Welt anpassen, und destruktive Kritik sind zwei seiner Waffen. In 1. Korinther 3,17 werden solche erwähnt, die den Tempel Gottes verderben. In Apostelgeschichte 20,29.30 warnt der Apostel Paulus vor Wölfen, die in die Herde Gottes eindringen und zerstören werden, und vor Verführern, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen.
Doch der Psalm beginnt mit der Frage nach der Züchtigung von Seiten Gottes. Wegen der Sünden des Volkes musste Gott in seinen Regierungswegen strafend eingreifen. Aber niemals wird Er die, die Er in Gnade erlöst hat, aufgeben. Das bleibt auch für uns Christen wahr. Wir alle erfahren die Erziehungswege Gottes (Hebräer 12,4-11). Oft müssen wir ernten, was wir gesät haben. Aber Gott wird uns niemals aufgeben. Das ist ein Trost in der Prüfung, besonders wenn wir wie Asaph fragen: «Bis wann?» oder «Warum ziehst du deine Hand zurück?» (Psalm 74,9-11). Gott gibt uns nicht auf jede Frage eine Antwort. Doch eins gilt immer: Wir bleiben seine Erlösten (Vers 2).
Vertrauen auf Gottes Handeln
Nachdem Asaph die Not seines Herzens im Gebet Gott vorgebracht hat, stärkt er sich in Ihm. Er denkt an sein machtvolles Wirken in der Vergangenheit. Aber er erinnert sich auch daran, wie Er als Schöpfer alles in der Hand hat und lenkt (Vers 17). Dann wird ihm bewusst, dass der Angriff des Feindes auf Gottes Volk und auf das Heiligtum sich im Grunde genommen gegen den Herrn richtet. Dieser Gedanke ermutigt ihn, für das Volk zu Ihm zu flehen. Dabei vergleicht er Israel mit einer Turteltaube, die sich nicht verteidigen kann, und bittet Ihn, die Elenden nicht zu vergessen.
Was können wir dabei von Asaph lernen? Wir haben es mit dem gleichen grossen Gott zu tun wie er. Er ist es wert, dass wir Ihm vertrauen. Doch es ist gut, wenn uns unser eigenes Unvermögen, unsere Schwachheit und Hilflosigkeit stets bewusst bleiben. Das bewahrt uns vor Selbstüberhebung.
Asaph erinnert Gott auch an seinen Bund mit dem Volk Israel. Und wir? Als Christen stehen wir nicht in einem Bundes-, sondern in einem Kindesverhältnis zu Gott. Vertrauensvoll dürfen wir uns auf all die Zusagen stützen, die Er uns in seinem Wort gemacht hat. Er steht treu zu allem, was Er versprochen hat. Zu seiner Zeit wird Er zu seiner eigenen Verherrlichung antworten und helfen.
In den Schlussversen wiederholt Asaph zum dritten Mal in diesem Psalm die Verhöhnung Gottes durch seine Feinde (Psalm 74,10.18.22). Das war für ihn noch schlimmer als die Zerstörung des Heiligtums.
Gottes Eingreifen im Gericht
In der Zukunft, d.h. nach der Entrückung der Gläubigen der Gnadenzeit, wird Gott seine Ziele auf dem Weg des Gerichts erreichen. Daran denkt der Psalmist und preist Gott dafür.
Auf den Lobpreis in Vers 2 antwortet Gott selbst in den Versen 3 und 4. Er bestimmt die Zeit, wann Er in Geradheit richten wird. Sollte das, was die Menschen auf der Erde aufgebaut haben, und sie selbst ins Wanken geraten, so wird doch das, was Gott festgestellt hat, nicht erschüttert werden. Das gilt in geistlicher Hinsicht auch für uns. Wenn vieles um uns her ins Wanken gerät, dürfen wir an den Grundsätzen Gottes, wie wir sie in der Bibel finden, festhalten. Sie werden sich nicht ändern.
In der Anwendung auf uns sagt Vers 7: Sucht und erwartet nicht von irgendeiner Seite Hilfe auf der Erde, also von Menschen. Richtet eure Blicke auf Gott, der den Niedrigen erhöht.
In den prophetischen Büchern wird das Bild eines mit Wein gefüllten Bechers oft für das Gericht Gottes gebraucht (Vers 9; Jesaja 51,17; Jeremia 25,15). Unwillkürlich denken wir an den Kelch des Zornes Gottes über die Sünde, den unser Erlöser damals in Gethsemane aus der Hand seines Vaters nahm und am Kreuz in den drei Stunden der Finsternis völlig leerte. Deshalb werden alle, die an Ihn glauben, vom Gericht verschont werden (Johannes 5,24). Wenn der Psalmist schon dem Gott Jakobs Psalmen singen wollte, wie viel mehr Grund haben wir Christen, Gott für das wunderbare Heil im Herrn Jesus zu danken und Ihn zu loben!
Die Siegesmacht Gottes
Wir denken wieder zuerst an die prophetische Seite dieser Verse. Im vorhergehenden Psalm sahen wir Gott als den Richter, der zu seiner Zeit gegen die Gottlosen und Feinde seines Volkes vorgehen wird. Dieser Psalm zeigt, dass nach den Gerichten Jerusalem das Zentrum der Regierung Gottes durch seinen Messias sein wird. Christus wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen, um von jener Stadt aus zu herrschen. Er wird jeden Widerstand gegen Ihn brechen (Vers 4).
Wie Er sein Gericht ausführen wird, beschreiben die Verse 5-7. Vers 9 lässt uns an die Gerichte denken, wie wir sie in der Offenbarung finden. Da lesen wir auch, wie die Menschen sich fürchten. Doch es wird sie nicht mehr zur Buße führen, es wird keine Gnade mehr geben für die, die den Herrn Jesus abgelehnt haben (Offenbarung 6,15-17). Es wird nicht nur auf der Erde eine Stille geben; sogar im Himmel entsteht ein Schweigen, bevor die letzten Gerichte losbrechen (Vers 9; Offenbarung 8,1).
Doch Vers 10 zeigt, dass sein Gericht gleichzeitig die Rettung und Befreiung des Überrests bedeuten wird. Jene glaubenden Juden werden als die Sanftmütigen des Landes bezeichnet. In Galater 5,22 gehört die Sanftmut zur Frucht des Geistes, die auch in unserem Leben sichtbar werden sollte.
Vers 11 weist darauf hin, dass schliesslich alles zur Ehre Gottes ausschlagen muss. In Philipper 2,10.11 heisst es, dass sich jedes Knie vor Jesus Christus beugen wird und jede Zunge bekennen muss, dass Er Herr ist, «zur Verherrlichung Gottes, des Vaters».
Gebet und ungläubige Fragen
Was der Grund der Bedrängnis in Asaphs Leben war, dass er in seiner Not zu Gott schrie, wissen wir nicht. Doch er tat das einzig Richtige: Am Tag seiner Drangsal suchte er den Herrn. Wohin wenden wir uns in den Schwierigkeiten? Gehen wir zuerst zu den Menschen und wenden uns erst, wenn von ihnen keine Hilfe kommt, an Gott? «Lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden» (Philipper 4,6). Möchten wir uns mit allem und zu jeder Zeit an den Herrn um Hilfe wenden!
Das Problem von Asaph war, dass er seine Hand nach Gott ausstreckte, aber scheinbar ohne Antwort blieb. Er fing an zu grübeln. Wie oft gleichen wir Asaph! Wir waren niedergedrückt und blickten auf uns und in unser Inneres hinein. Und das Resultat? Wir wurden noch unglücklicher.
Vielleicht haben wir in unserem Leben Erfahrungen mit Gott gemacht und können deshalb die in den Versen 8-10 gestellten Fragen mit einem klaren Nein beantworten. Aber noch besser ist es, wenn wir uns auf die Antworten stützen, die die Bibel selbst gibt. Die Fragen in Vers 8 werden z.B. durch Psalm 66,16-20 und Römer 10,12 beantwortet. Sollten wir an seiner Güte zweifeln, dann ist es gut, wieder einmal Psalm 103,11 und den Psalm 136 zu lesen. Von seinen Worten hat der Herr Jesus gesagt, dass sie nicht vergehen werden (Markus 13,31; siehe auch Römer 11,29; 2. Korinther 1,20). Im Blick auf seine Gnade gilt Epheser 2,4-8 und von seinen Erbarmungen heisst es, dass sie jeden Morgen neu sind (Klagelieder 3,22-24).
Gottes Weg für sein Volk
Von Vers 11 an ist die Blickrichtung des bedrängten und betrübten Psalmisten eine andere. Anstatt in sich hinein zu schauen, blickt er jetzt auf Gott. Er denkt über Ihn und seine Taten nach. Nun wird ihm die Grösse und Allmacht seines Gottes neu bewusst. Ja, Er ist ein grosser Gott und einer, der Wunder zu tun vermag. Asaph erinnert sich an die Erlösung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens. Sie geschah durch Gottes Macht.
Aber er entdeckt beim Nachsinnen über Gott noch etwas anderes: «Gott, dein Weg ist im Heiligtum!» Im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, ist alles klar. Da ist kein Fehler möglich. Da gibt es nichts, was den Glaubenden beunruhigen könnte.
Aber Gottes Weg ist nicht nur im Heiligtum. Asaph erkannte, dass Gottes Weg auch im Meer ist, «und deine Fussstapfen sind nicht bekannt». Wir können seine Wege nicht immer wahrnehmen. Er handelt manchmal im Verborgenen. Wie wichtig ist es da, Ihm trotz allem zu vertrauen.
Der Psalm endet mit der Hirtentreue Gottes. Wie eine Herde hatte Er durch Mose und Aaron sein Volk aus Ägypten, durch das Rote Meer, dann durch die pfadlose Wüste bis ins verheissene Land geleitet. Dabei hatte es ihnen an nichts gefehlt.
Auch wir sind dieser Hirtentreue und seiner Fürsorge anvertraut. Als die Schafe seiner Herde wollen wir ganz nahe bei unserem Hirten bleiben und auf Ihn vertrauen.
Gesetz und Ungehorsam
Dieser lange Psalm trägt die Überschrift: «Ein Maskil», was vielleicht Unterweisung oder Lehrgedicht bedeutet (siehe Fussnote). Es ist ein Psalm, den man besonders beachten und über den man nachdenken sollte. Dieser Gedanke wird mit dem ersten Vers unterstrichen.
Der Psalmist möchte Wichtiges aus der Geschichte des Volkes Israel, das er selbst von den Vätern gehört hat, seinen Nachkommen weitergeben. Er will vom Herrn, von seiner Stärke und von dem, was Er getan hat, erzählen. Das Gesetz, das Er seinem aus Ägypten erlösten Volk am Sinai gegeben hat, soll auch von den Nachkommen beachtet und befolgt werden.
Einen ähnlichen Gedanken finden wir in 2. Timotheus 2,2, wo Paulus im Blick auf die Wahrheit des Neuen Testaments sagt: «Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren.»
Dieses Weitergeben der Erfahrungen des Volkes Israel mit seinem Gott hat zwei Ziele. Erstens soll das künftige Geschlecht auf Gott vertrauen, seine Taten nicht vergessen und seine Gebote bewahren (Vers 7). Zweitens soll die kommende Generation sich warnen lassen und nicht wie ihre Vorfahren vom Herrn abweichen und sich gegen Ihn und sein Wort auflehnen. Gerade die Untreue Israels gegenüber seinem Gott war ein Problem, das in seiner Geschichte immer wieder auftrat.
Die gleiche Untreue des Menschen kennzeichnet auch die Geschichte des christlichen Zeugnisses. Sie endet damit, dass der Herr draussen steht (Offenbarung 3,20).
Güte und Widerspenstigkeit
In diesen Versen werden einige der Wunder Gottes aufgezählt, die Er zu Beginn der nationalen Geschichte Israels wirkte. Doch von allem Anfang an sündigte es und war widerspenstig gegen den Höchsten. Wie viel Geduld hatte Gott mit diesem hartnäckigen Volk! Obwohl Er immer wieder züchtigend eingreifen musste, gab Er es nicht auf.
Wenn wir als Kinder Gottes auf unser Leben zurückschauen, müssen wir da nicht seine unendliche Geduld und Gnade mit uns bewundern und rühmen?
Eine besondere Sünde wird in Vers 18 erwähnt: «Sie versuchten Gott.» Sie stellten Gott auf die Probe. Würde Er ihre Forderung erfüllen können? Eine solche Einstellung offenbart das wahre Wesen des Unglaubens.
Die zweifelnden Fragen in den Versen 19 und 20 stellen die Allmacht Gottes in Frage. Welch eine Überhebung des Menschen! Aber Zweifel und Ungehorsam gegenüber Gott sind ein Zwillingsübel, das sich beim Volk Israel immer wieder zeigte.
Wer nach all den Wundern, die Gott wirkte, noch Zweifel an seiner Allmacht äussert, beleidigt Ihn. Sein Grimm und Zorn in Vers 21 sind daher verständlich. Er musste züchtigend eingreifen, «weil sie Gott nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Rettung». Möge dieses Verhalten Israels uns zur Warnung dienen, damit wir nie an Gott zweifeln, auch dann nicht, wenn wir auf Ihn vertrauen und Er nicht so handelt, wie wir es erwartet haben, oder wenn Er unsere Geduld übt.
Fürsorge und Unzufriedenheit
Wir haben einen unendlich gütigen und gnädigen, aber auch langmütigen Gott. Das durfte das Volk Israel erfahren. Obwohl sie Ihn mit ihren zweifelnden Fragen herausgefordert hatten, gab Er ihnen Brot aus dem Himmel. An jedem Tag ihrer langen Wüstenreise konnten sie hinausgehen und das Manna – dieses Himmelsgetreide – sammeln. Keiner musste Hunger leiden.
Im Blick auf das Fleisch, das Er ihnen gab, finden wir in den Büchern Mose zwei verschiedene Hinweise. In 2. Mose 16,12.13 heisst es, dass der Herr ihnen auf ihr Murren hin am Abend Fleisch (Wachteln) und am Morgen Brot (Manna) gab. In 4. Mose 11 rief das Volk weinend erneut nach Fleisch. Sie dachten an das, was sie in Ägypten gegessen hatten und verachteten das Manna, das Gott ihnen täglich gab. Diese böse Haltung des Volkes überforderte sogar den Führer Mose. Verzweifelt betete er zu Gott: «Ich allein vermag dieses Volk nicht zu tragen, denn es ist mir zu schwer.» Da griff Gott ein. Er gab dem Volk Fleisch in Fülle, brachte aber auch ein schweres Gericht über sie (4. Mose 11,30-35). Daran erinnern die Verse 30 und 31 in unserem Psalm.
Die Verse 32-39 zeigen, wie das Volk jeweils nach einer Züchtigung zu Gott umkehrte, aber nur oberflächlich. Wenn es ihnen schlecht ging, fragten sie wieder nach Gott. Aber sahen sie ihre Sünde wirklich ein? Waren sie betrübt über das Böse in ihrem Leben? Vers 36 sagt: «Sie heuchelten ihm mit ihrem Mund.» Gott aber war barmherzig und vergab trotzdem. Er gab sein Volk nicht auf. Welch eine Gnade!
Befreiung aus Ägypten
Das Traurige in der Geschichte Israels ist, dass sich der Ungehorsam gegenüber Gott und seinem Wort und die Auflehnung gegen Ihn so oft wiederholten. Wie sieht es da in unserem Leben aus? Haben wir den Herrn nicht öfter durch die gleichen Sünden betrübt, die immer wieder in unserem Leben vorkamen? Ach, wir sind von Natur aus nicht besser als Israel!
Weil sie so vergesslich waren und nicht daran dachten, was Gott für sie getan hatte, muss der Psalmdichter in diesen Versen an die verschiedenen Plagen erinnern, die Gott vor der Befreiung des Volkes über Ägypten brachte. Es waren eindrückliche Beweise der Grösse und Allmacht des Herrn, ihres Gottes, den der Pharao verhöhnte (2. Mose 5,2). Wie konnte Israel dies vergessen!
Die letzte der zehn Plagen war der Tod aller Erstgeburt in Ägypten. Erst dann liess der Pharao das Volk ziehen. Es zog weg aus Ägypten, aber nicht ohne göttliche Führung. «Der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten» (2. Mose 13,21). Das war eine absolut sichere Leitung. Sie brauchten sich nicht zu fürchten (Vers 53). Gott führte sie zunächst zum Sinai und schliesslich bis ins verheissene Land. Es geht in diesen Versen um Gott und nicht so sehr um das Volk, das in seiner Verantwortung versagt hat. Darum liegt der Schwerpunkt auf der Erlösung aus Ägypten, auf der sicheren Führung durch die Wüste, auf dem Einzug ins Land und auf der Verteilung ihres Erbteils.
Götzendienst und seine Folgen
Verhielten sich die Nachkommen derer, die in der Wüste gestorben waren, besser als ihre Väter? Nein. Auch als sie im Land wohnten, «versuchten sie Gott, den Höchsten» und gehorchten Ihm nicht (Vers 56; vergleiche Psalm 78,18.41). In der Wüste hatten sie gegen Ihn gemurrt. Im Land wichen sie von Ihm ab, indem sie Götzendienst trieben. Sie stellten Götzenbilder auf und richteten heidnische Kultstätten ein. Welch eine Beleidigung und welch eine Herausforderung des einzig wahren Gottes!
Die Verse 59-64 beschreiben vor allem das züchtigende Eingreifen Gottes zur Zeit des Propheten Samuel. Damals fiel die Bundeslade in die Hände der Feinde. Im Krieg mit den Philistern mussten viele Menschen ihr Leben lassen. Auch die Priester fielen durchs Schwert (Vers 64; 1. Samuel 4,11.19-22).
Ab Vers 65 sehen wir dann das erneute Wirken Gottes. Nachdem König Saul, der Mann nach dem Fleisch, völlig versagt hatte, musste der Prophet Samuel jemand aus dem Stamm Juda zum König salben. Es war David. Vers 70 erinnert uns an 1. Samuel 16,11.12. David wurde ein König mit einem Hirtenherzen. Das bezeugt uns der letzte Vers, der seine Regierung mit dem Verhalten eines Hirten gegenüber seiner Herde beschreibt. Unter der Regierung Davids wurde Jerusalem erobert, das später zur Hauptstadt Israels wurde. Dort stand dann auch der Tempel Gottes – sein Heiligtum (Psalm 78,68-69). So endet dieser Psalm, der zur Unterweisung des Volkes dienen sollte, mit einem herrlichen, göttlichen Höhepunkt.
Gebet bei der Verwüstung Jerusalems
Wir denken zuerst an den prophetischen Charakter dieses Psalms. Er drückt die Not des treuen Überrests in der Zukunft aus. Nach menschlichem Ermessen sieht es aus, als ob das ganze Volk Israel ausgelöscht würde. Deshalb die Frage: «Bis wann, Herr?» und die Bitte, die Feinde Israels zu vernichten.
Doch in der grössten Not klammern sich jene Treuen an Gott, rufen sein Erbarmen an und reden von ihren Sünden, die Er um seines Namens willen vergeben wolle. «Hilf uns, Gott unseres Heils, um der Herrlichkeit deines Namens willen!» Schliesslich möchten sie als Errettete und Befreite den Herrn preisen und von Geschlecht zu Geschlecht sein Lob erzählen.
Was können wir aus diesen Versen für uns lernen? Mancher Erlöste hat erleben müssen, dass «seine Welt» zusammenbrach. Die Nöte mögen im persönlichen Leben, in der Familie oder im Volk Gottes unter den Gläubigen auftreten. In jedem Fall sind und bleiben der souveräne Gott, der unser Heiland-Gott geworden ist, und seine Gnade unsere Zuflucht. Zu Ihm dürfen wir uns im Gebet wenden. In Ihm liegen unsere Hilfsquellen.
Vielleicht muss Er uns zeigen, dass es in unserem Leben Unrechtes gibt. Dann wollen wir Ihm unsere Sünden bekennen und das Verkehrte im Selbstgericht verurteilen. Er wird uns vergeben (1. Johannes 1,9). Aber niemals wird Er die Seinen aufgeben und untergehen lassen. Die Glaubenden sind und bleiben sein Eigentum.
Gebet in der Bedrängnis
Prophetisch gesehen geht es in diesem Psalm um das gleiche Thema wie im vorhergehenden. Der zerstreute gläubige Überrest aus Israel ruft Gott um Rettung an. Auch in diesem Psalm wird die Frage laut: «Bis wann …?» Wir wissen, dass Christus, der Messias seines Volkes, zur Befreiung der Seinen einschreiten wird, aber erst wenn die Not aufs Höchste gestiegen und die Hoffnung geschwunden ist.
Zwei Namen Gottes in diesen Versen weisen auf sein Wesen und die Art seines Handelns mit den Seinen hin. In Vers 2 wird Er als «Hirte Israels» angeredet. Wir denken unwillkürlich an den Herrn Jesus, der sich in Johannes 10 als der gute Hirte bezeichnet. Als solcher hat Er einerseits sein Leben für die Schafe gelassen. Aber anderseits führt Er auch alle, die an Ihn glauben, wie ein Hirte seine Herde leitet. Er geht vor seinen Schafen her, Er hütet und weidet sie.
In den Versen 5 und 8 wird der Herr als «Gott der Heerscharen» bezeichnet. Das lässt uns an all das denken, was Ihm zur Verfügung steht. Wir begegnen diesem Titel Gottes zum ersten Mal im ersten Buch Samuel (1. Samuel 1,3.11). Gerade in einer Zeit, da es im Volk Gottes nicht gut stand – sowohl das Richteramt als auch das Priestertum hatten versagt –, stellt sich Gott als der vor, dem alles zu Gebote steht. Welch eine Ermunterung für alle Glaubenden, die ihre eigene Schwachheit und ihr Versagen einsehen und sich unter den traurigen Zustand im Volk Gottes beugen! Sie dürfen sich auf den Gott der Heerscharen stützen.
Rückblick und Aufblick zum Herrn
In der Bibel wird das irdische Volk Gottes verschiedentlich mit einem Weinstock verglichen. Gott hatte diesen Weinstock aus Ägypten geholt (nach der Fussnote Vers 9: herausgerissen) und ihn im Land Israel gepflanzt. Eine Zeit lang wuchs er und breitete sich aus. Wir denken an die Geschichte des Volkes Israel unter den Königen David und Salomo. Da erlebte es eine einmalige Blütezeit. Doch ab Vers 13 wird sein Niedergang beschrieben. Weil die Menschen von ihrem Gott abwichen und immer mehr in Götzendienst verfielen, liess der Herr zu, dass fremde Völker es bedrängten und dezimierten. Die Bewohner des Zehnstämme-Reichs kamen in die assyrische, jene des Zweistämme-Reichs in die babylonische Gefangenschaft.
Vers 18 zeigt, dass es für Israel eine Hoffnung gibt. Sie gründet sich auf Jesus Christus, den Messias. Als Er hier als Mensch lebte, übernahm Er die Stellung Israels als Gottes Weinstock. In Johannes 15 sagt der Mensch gewordene Sohn Gottes: «Ich bin der wahre Weinstock.» Er hat im Gegensatz zu Israel in seinem Zeugnis auf dieser Erde nicht versagt. In der heutigen Zeit sind alle, die sich zu Ihm bekennen, Reben an diesem Weinstock.
Aber diese Person, die hier «Mann der Rechten Gottes» und «Menschensohn» genannt wird, ist auch der Messias Israels. Durch Ihn wird Gott alle Pläne mit seinem irdischen Volk zu seinem Ziel führen. Die Verse 19 und 20 werden also in der Zukunft eine herrliche Erfüllung finden – durch den Herrn Jesus selbst!
Israel schöpft Hoffnung
Die ersten Verse lassen an die Zeit in der Zukunft denken, da das Volk Israel wiederhergestellt sein wird und wieder in einer Beziehung zu seinem Gott lebt. Das wird wirklich Grund zu Lob, Dank und grosser Freude sein.
Die Verse 6-8 sind wieder ein Rückblick auf den Anfang der nationalen Geschichte des Volkes. Mächtig erwies sich damals sein Gott. War es zu viel verlangt, wenn Er als Antwort von Seiten der Menschen Gehorsam forderte? Zudem ist Er allein Gott. In Jesaja 48,11 sagt Er: «Meine Ehre gebe ich keinem anderen.» Darum will Er auf keinen Fall, dass sein Volk sich vor irgendwelchen fremden Göttern beugt.
Obschon der Herr, der Gott Israels, die Menschen segnen wollte, hörten sie nicht auf Ihn. So musste Er sie in seinen Regierungswegen züchtigen. Er liess sie ernten, was sie gesät hatten (Vers 13). Auf den traurigen Ausruf Gottes: «O dass mein Volk auf mich gehört hätte …!», folgt alles, was Er ihm hätte tun und wie Er ihm hätte helfen wollen. Der göttliche Grundsatz, den wir in diesen Versen finden, gilt heute noch. Durch unseren Ungehorsam, durch die fehlende Bereitschaft, auf Gottes Stimme in seinem Wort zu hören, behindern wir oft das Handeln Gottes. Nicht dass Er seine Ziele nicht erreichte! Nichts und niemand kann Ihn daran hindern. Aber wir verlieren unter Umständen einen grossen Segen. Fehlender Gehorsam wird den Genuss unserer Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn erheblich beeinträchtigen.
Gott richtet die Richter
Die Fussnote zu Vers 1 erklärt die Bedeutung des Ausdrucks «Götter» in diesem Psalm. Gott meint damit die Richter in Israel. Diese Männer besassen eine Vollmacht von Gott, um als seine Vertreter im Volk Recht zu sprechen. Daher die Bezeichnung «Götter» (vergleiche Johannes 10,35). Sie, die im Volk Gottes Gericht halten mussten, stehen jetzt selbst vor dem höchsten Richter. Er prangert ihr ungerechtes Urteil an. Sie liessen sich von der Person, die vor Gericht stand, beeinflussen. Leute von Rang und Namen kamen mit einem milderen Urteil davon als die Armen und Geringen. Es scheint, dass diese ungerechten Richter den sozial Schwächeren überhaupt nicht zu Recht und Gerechtigkeit verhalfen.
Das Bevorzugen der Bessergestellten und das Unterdrücken der Hilflosen war neben dem Götzendienst eine der Hauptsünden, die Gott seinem Volk vorhalten musste. Wie oft haben die Propheten dieses Thema aufgegriffen! (Jesaja 1,16.17.23; Amos 5,10-13; Maleachi 3,5).
Wenn die Richter eines Volkes nichts wissen, nichts verstehen und im Dunkeln tappen – wie es die göttliche Beschreibung in Vers 5 ausdrückt –, dann gerät jede soziale Ordnung ins Wanken. Dann ist die moralische Stabilität der Welt wirklich bedroht. Auch wenn diese Menschen eine von Gott gegebene besondere Stellung einnahmen, müssen sie doch wie alle Menschen sterben. Auch für sie gilt Hebräer 9,27: «Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.»
Der grosse Angriff des Feindes
Wir haben bereits früher gesehen, dass in der Zukunft die Feinde Israels versuchen werden, das Volk wenn möglich ganz zu eliminieren (Psalm 79,1-4). Im heute gelesenen Psalm drücken sie dieses Ziel konkret aus (Vers 5). Um dies zu erreichen, schliessen sich viele Völker – vor allem Nachbarvölker Israels – zu einer unheiligen Allianz zusammen. Der treue Überrest des Volkes in der Zukunft weiss, dass sie Gottes Geborgene oder Schützlinge sind. Deshalb rufen sie Ihn um Hilfe an.
Interessanterweise erinnern sie den Herrn an seine Hilfe und sein mächtiges Eingreifen zur Zeit der Richter (vergleiche die Verse 10 bis 12 mit Richter 4,22-24; 7,25; 8,12). Nach der Einnahme des verheissenen Landes war es in Israel die Zeit des ersten Abweichens von Gott. Wie oft musste Er züchtigend eingreifen, um die Menschen zur Besinnung und zur Umkehr zu Ihm zu bringen! Immer, wenn sich das Volk beugte, schickte Gott ihnen einen Richter, der sie aus der Hand ihrer Bedränger rettete. Am Ende der Zeit wird es Christus selbst sein, der den bedrängten Treuen aus seinem irdischen Volk zu Hilfe kommen und sie befreien wird.
Auch heute stellt sich der Herr zu denen, die Ihm angehören und hilft ihnen, wenn sie angegriffen werden. So rief Er einst Saulus von Tarsus vom Himmel zu, als dieser die gläubigen Christen verfolgte: «Saul, Saul, was verfolgst du mich?», und trat ihm in den Weg. Die Hilfe ist vielleicht nicht immer äusserlich sichtbar. Aber stets gilt seine Zusage aus Hebräer 13,5.6.
Freude am Heiligtum Gottes
Dieser Psalm ist nicht mehr von Asaph wie die vorhergehenden, sondern von den Söhnen Korahs. Ihr Vater Korah kam als Aufständischer um, sie aber blieben verschont (4. Mose 16,1.2.31.32; 26,9-11). Wie sehr haben sie Gottes Gnade erfahren!
In diesen Versen drücken sie ihr Verlangen nach der Nähe Gottes aus. Es ist ein Heimweh-Psalm. Der Glaubende sehnt sich nach dem Zuhause bei Gott. Ist das nicht auch unser Verlangen? Wir haben doch die Zusicherung unseres Erlösers, dass Er bald kommen wird, um uns zu sich nach Hause zu holen (Johannes 14,2.3; Offenbarung 22,20)!
Aber bis es soweit ist, führt unser Glaubensweg oftmals durchs Tränental. Glücklicherweise vermag der Herr Prüfungszeiten zu Segenszeiten werden zu lassen. Wenn wir auf den Wegen nach seinem Willen bleiben (gebahnte, nicht krumme, eigenwillige Wege), werden wir seine Kraft erfahren, bis wir am Ziel sind (Vers 8).
Und während wir im Glauben unterwegs sind, haben wir das Vorrecht, als Kinder Gottes jede Not, jede Sorge, jedes Problem im Gebet vor unseren himmlischen Vater zu bringen (Vers 9).
Die Söhne Korahs waren im Gegensatz zu ihrem Vater zufrieden mit dem Platz, den Gott ihnen angewiesen hatte. Sind wir auch mit dem zufrieden, was der Herr uns gibt und wie Er uns führt? Er meint es gut mit uns, auch wenn wir sein Tun mit uns nicht immer begreifen. Lasst uns im Vertrauen auf Ihn nicht wankend werden! Denn glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn der Heerscharen vertraut!
Der verheissene Segen
Im Lauf seiner Geschichte ist das Volk Israel immer wieder von Gott abgewichen. Die Züchtigungen des Herrn führten zu einer Rückkehr und Wiederherstellung. Trotzdem wichen sie nach einer Zeit aufs Neue vom Weg des Gehorsams und von Gott ab. In der Zukunft wird Gott sein Volk in die Zeit der grossen Drangsal bringen. Es geschieht vor allem wegen der Verwerfung und Kreuzigung seines Messias. Aber dann wird es zu einer endgültigen Wiederherstellung des Überrests des Volkes kommen. Von jener zukünftigen Zeit spricht unser Psalm. Gott wird seinem Volk vergeben, es zurückführen und es seine Güte und seine Rettung erfahren lassen.
Die Grundlage dazu, dass in der Zukunft die Verse 12-14 wahr werden können, liegt im Erlösungswerk, das Christus am Kreuz auch für Israel vollbracht hat. Weil Er dort ein unendlich grosses Opfer gestellt hat – es hat allen heiligen Forderungen Gottes und allen Bedürfnissen sündiger Menschen genügt –, konnten sich Gerechtigkeit und Frieden verbinden. Christus hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes (Kolosser 1,20). Er hat auch die Schuld seines irdischen Volkes bezahlt, so dass Gott ihm in Güte auf der Grundlage bedingungsloser Gnade begegnen kann (Römer 11,26.27).
«Nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten.» Spornt uns das nicht zu einem Leben echter Gottesfurcht an? Möge der Herr uns helfen, ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst zu führen (1. Timotheus 2,2). Dann werden wir bestimmt die Rettung und Hilfe des Herrn erfahren.
Bitte um Erhörung
Sicher ist auch dieser Psalm von prophetischer Bedeutung. So wie David sich als Knecht des Herrn zu Gott wandte, wird einmal der gläubige Überrest zu Gott rufen. Doch wir dürfen aus dem Gebet Davids auch manches für uns als glaubende Christen lernen.
Wenn wir in Nöten und Schwierigkeiten stecken, oder uns elend und arm fühlen, dürfen wir vertrauensvoll zu Gott rufen. Und wenn wir aus eigener Schuld in Probleme gekommen sind, dann gilt Vers 5. Auf unser Bekenntnis hin wird der Herr vergeben und uns weiterhelfen.
Auch wenn keine besonderen Vorkommnisse in unserem Leben vorliegen, liefert uns dieses Gebet Davids hilfreiche Hinweise:
«Bewahre meine Seele.» Wir leben in einer gefahrvollen Umgebung. Die Welt um uns her versucht auf alle Weise in unser Herz und Leben zu dringen. Wie nötig haben wir da die Bewahrung des Herrn! – «Sei mir gnädig!» Der unerschöpfliche Reichtum der Gnade Gottes steht uns jeden Tag zur Verfügung. Lasst uns regen Gebrauch davon machen. – «Erfreue die Seele deines Knechtes!» Auch das darf unsere Bitte sein. Ja, es ist der Wunsch des Herrn, dass seine Freude in uns sei und unsere Freude völlig werde (Johannes 15,11).
David wusste, zu wem er betete. Ist uns auch bewusst, dass keiner wie Er ist? Ja, Gott, unser himmlischer Vater, ist gross. Er ist der einzig wahre Gott, Er allein (Vers 10). Haben wir es nicht gut, dass wir durch den Glauben an den Erlöser in eine Kindesbeziehung zu diesem Gott gebracht worden sind?
Bitte um Belehrung
Es ist der Wunsch Davids, diesem grossen Gott, zu dem er vertrauensvoll beten darf, in Treue nachzufolgen. Ist das auch unser Begehren? Dann darf Vers 11 unser Gebet sein.
Den Weg des Willens Gottes lernen wir aus der Bibel kennen. Natürlich finden wir darin nicht auf jede Frage in unserem Glaubensleben eine konkrete Antwort. Aber der Herr möchte, dass wir durch sein Wort die Grundsätze Gottes kennen lernen. Wenn Er bei uns das Verlangen sieht, in seiner Wahrheit zu leben, wird Er uns helfen, die göttlichen Grundsätze auf unsere persönlichen Situationen anzuwenden. Wichtig ist, dass unser Herz ungeteilt auf Ihn gerichtet ist. Wenn wir heimlich eigenwillige Wünsche pflegen oder versuchen, einen Weg der Kompromisse mit der Welt einzuschlagen, ist unser Herz geteilt. David aber bittet: «Einige mein Herz zur Furcht deines Namens.»
David hat nicht nur Bitten, die er Gott vorbringt. Er hat auch Grund zu Lob und Preis. Auch wir wollen das Danken und Loben nicht vergessen.
In Vers 13 dankt David dem Herrn, dass Er seine Seele aus dem untersten Scheol errettet. Auch wir wollen nie vergessen, Gott und unserem Erretter für das wunderbare, ewig gültige und sichere Heil zu danken!
Die Beschreibung Gottes in Vers 15 finden wir bereits in 2. Mose 34,6. Wie froh war Mose, dass er und das Volk Israel – es hatte sich soeben durch die Anbetung des goldenen Kalbes schwer versündigt – sich auf einen solchen Gott stützen konnten. Er hat sich seither nicht verändert.
Der Berg Zion
Dieser Lied-Psalm hat die Stadt Jerusalem zum Thema. Gott selbst hat sie erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Doch die Stadt Jerusalem hat ihre göttliche Bestimmung verfehlt und hat in ihrer Verantwortung völlig versagt. Sie wurde zur Stadt, in der das Volk seinen Messias umgebracht hat (Apostelgeschichte 4,27.28). Schliesslich haben die Römer den Tempel in Jerusalem und die Stadt zerstört.
Dem Versagen der Menschen steht die souveräne Gnade Gottes gegenüber. Darum gebraucht der Geist Gottes, wenn Er von der Stadt Gottes spricht, den Namen Zion. Gottes Gnade, die sich auf das Sühnungswerk des Herrn Jesus am Kreuz stützt, wird diese Stadt im Tausendjährigen Reich zum Mittelpunkt der Erde und zum Regierungssitz von Christus machen. Ja, «Herrliches ist von dir geredet». Jerusalem wird der berühmteste Ort auf dieser Erde werden. Welch eine Ehre für jeden, der dort geboren ist!
Der letzte Vers spricht in erster Linie von Zion als dem Ausgangspunkt allen Segens im Tausendjährigen Reich. Doch wir dürfen diese Worte sicher auch für uns nehmen und sie auf unseren Herrn und Erlöser anwenden. «Alle meine Quellen sind in dir!» Alles, was wir besitzen und was wir sind, haben wir Ihm zu verdanken. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Durch den Glauben an Ihn haben wir ewiges Leben empfangen. Als unser Hirte sorgt Er Tag für Tag für uns. Er führt und bewahrt uns, bis wir am Ziel bei Ihm selbst ankommen. Ihm gehört unser Dank, unser Lob und unsere Anbetung.
Tiefe Leiden vonseiten Gottes
Beim Lesen der überaus ernsten Worte dieses Psalms denken wir einerseits an den treuen Überrest der Juden in der Zukunft. Die Not jener Glaubenden wird aufs Höchste steigen, bevor Christus, ihr Messias, zu ihrer Errettung erscheinen wird. Aber anderseits drücken diese Verse auch die Empfindungen unseres Heilands in den drei Stunden der Finsternis am Kreuz aus. Unter diesem Blickwinkel wollen wir ein wenig über diese Worte nachdenken.
Was muss es für unseren Erlöser gewesen sein, so zu Gott zu rufen, ja, zu schreien – und keine Antwort zu bekommen! Unsägliche Leiden hatte Er bereits von Seiten der Menschen erdulden müssen. Sie haben Ihn wie einen Verbrecher ans Kreuz genagelt und dann mit ihrem Spott sein Herz zutiefst verletzt. «Meine Bekannten (oder Vertrauten) hast du von mir entfernt.» Das wird in Lukas 23,49 bestätigt, wenn es heisst: «Aber alle seine Bekannten standen von fern, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies.»
Wie gross war die Einsamkeit, die der Heiland in seinen letzten Stunden des Lebens hier erfahren musste! Aber die schlimmsten Leiden kamen in den drei Stunden der Finsternis über Ihn.
Furchtbar war das Verlassensein von Gott, das Er damals empfand. In jenen Stunden traf Ihn der Zorn Gottes über die Sünde, weil Er, der Reine und Heilige, unsere Sünden trug und für uns zur Sünde gemacht worden war. Die Wellen und Wogen des göttlichen Gerichts drückten Ihn nieder.
Unter dem gerechten Zorn Gottes
Das Warum in Vers 15 erinnert sehr an das Warum in Psalm 22,2: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» So rief der Heiland am Ende der drei Stunden der Finsternis zu Gott (Matthäus 27,46). Aber in Ihm selbst gab es keinen Grund, von Gott verlassen zu werden. Er war sündlos, heilig und gerecht. Während seines Lebens fragte Er nur nach Gottes Willen und tat ihn. Es waren unsere Sünden, die in den drei Stunden der Finsternis auf Ihm, unserem Stellvertreter, lagen, die den heiligen Gott veranlassten, sein Angesicht vom Herrn Jesus abzuwenden. Wegen unseren Sünden trafen Ihn die Zorngluten Gottes (Vers 17).
Der Vers 16 deutet an, dass der Herr Jesus in seinem Leben hier von allem Anfang an seinen Tod am Kreuz voraussah. Denken wir an sein Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3. Da erklärte Er diesem Pharisäer: «Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden.»
Im Unterschied zu Psalm 22, wo in Vers 22 eine Wendung eintritt und wir den Herrn prophetisch zu Gott sagen hören: «Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel», gibt es in diesem Psalm keinen einzigen Lichtblick. Die Antwort finden wir erst im nächsten Psalm. Unser Psalm beginnt mit einem intensiven Schreien bei Tag und bei Nacht. Er endet mit der Finsternis. Auch wenn wir nicht wirklich begreifen können, was unser Heiland wegen unseren Sünden gelitten hat, sollten wir uns doch immer wieder mit seinen Leiden am Kreuz beschäftigen.
Gott ist gross
Dieser Psalm spricht von der völligen Wiederherstellung Israels. Der treue Überrest, den Gott nach der Drangsalszeit wieder als sein Volk anerkennen wird, kommt aufs Neue in eine geordnete Beziehung zu Gott, dem Herrn. Wie ist das möglich? Nur aufgrund der Güte und Treue Gottes – zwei Ausdrücke, die in diesem Psalm mehrfach vorkommen. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass sich die Wiederherstellung Israels auf das Erlösungswerk des Herrn Jesus, ihres Messias, gründen wird (Römer 11,26.27.32).
In Vers 4 wird ein Bund erwähnt, den Gott mit König David gemacht hatte, in dem Er ihm verhiess, dass bis in Ewigkeit Nachkommen von ihm auf dem Thron sitzen werden. Es war ein Bund bedingungsloser Verheissungen. Gott hatte zur Zeit Davids bereits den Sohn Davids – Jesus Christus – vor sich.
Die Verse 6-8 beschreiben rühmend die Grösse und Erhabenheit Gottes. Er kann mit niemand und mit nichts verglichen werden. Ist nicht das Weltall (= die Himmel) aus seiner Schöpferhand hervorgegangen? Mit den «Heiligen» sind die Glaubenden seines irdischen Volkes gemeint. Ihnen gegenüber erweist Er seine Treue. Er steht zu allem, was Er in seinem Wort gesagt und versprochen hat. Gleichzeitig ist Er ein heiliger Gott, der Böses nicht sehen kann. Niemals kann Er Sünde im Leben der Seinen gutheissen oder tolerieren. Deshalb möchte Er, dass wir in Gottesfurcht vorangehen, d.h. dass wir uns davor fürchten, etwas zu tun oder zu sagen, was Ihm missfällt.
Gott ist mächtig
Ab Vers 9 spricht der Psalmist nicht mehr in der dritten Person von Gott, sondern redet Ihn direkt an. Dabei spricht er sowohl von der Schöpfermacht Gottes als auch von seinem Eingreifen zugunsten seines Volkes. Vers 11 lässt uns an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten denken, denn Rahab ist eine sinnbildliche Bezeichnung für Ägypten (Jesaja 30,7).
Der gewaltige Arm Gottes und seine starke Hand in Vers 14 reden nicht nur davon, dass Er allmächtig ist, sondern dass Er diese Macht auch ausübt. Die Zeit wird kommen, da Er durch Jesus Christus seinen Thron auf der Erde aufrichten wird. Unter der Regierung von Christus wird es absolute Gerechtigkeit geben. Wer sich gegen seine Herrschaft auflehnt, wird sofort gerichtet werden. Aber alle, die sich Ihm unterwerfen, werden seine Güte erfahren.
Dem Volk Israel, das in der Zukunft aus dem gläubigen Überrest gebildet wird, steht eine unvorstellbar herrliche Zeit bevor. Wenn Gott, der Herr, sein König sein wird, wird dieses Volk mit Recht glückselig gepriesen werden. Kein Volk könnte es besser haben als Israel.
Die Titel «Frommer», «Mächtiger» und «Auserwählter» in Vers 20 weisen auf einen Grösseren als David hin. Der Sohn Isais ist, obwohl er als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird, nur ein Abbild von Jesus Christus, dem wahren Sohn Davids. Er ist der Fromme, der Mächtige und der Auserwählte Gottes.
Gott ist treu
Nachdem der erste König in Israel – es war Saul, der Mann nach den Wünschen des Volkes, – in jeder Hinsicht versagt hatte, fand Gott David, den Mann nach seinem Herzen (1. Samuel 13,14). Diesen musste der Prophet Samuel zum König über Israel salben.
Ab Vers 22 zählt Gott auf, was Er für David sein wollte, wie Er ihm helfen und seine Herrschaft festigen wollte. Wir finden in diesen Versen manche Zusage Gottes an David und sehen etwas von der Beziehung, in der dieser Mann Gottes zum Herrn stand (Vers 27). Und doch müssen wir beim Lesen dieser Worte an den Herrn Jesus denken. Von Ihm wissen wir, dass Er, obwohl Er als Mensch hier lebte, tatsächlich der Sohn Gottes ist. Er trägt auch in verschiedener Hinsicht den Titel «Erstgeborener», was auf seine Vorrangstellung hinweist (Kolosser 1,15; Hebräer 1,6; Römer 8,29).
Die Verse 30-38 zeigen einerseits die Treue Gottes zu dem, was Er im Blick auf die Nachkommenschaft Davids gesagt hat. «Sein Same wird ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir.» In Jesus Christus, dem Sohn Davids, wird sich dies erfüllen, wenn Er in Herrlichkeit wiederkommen und seinen Thron hier aufrichten wird.
Anderseits machen diese Verse die direkten Nachkommen Davids – wir denken an die Könige des Südreichs Juda – vor Gott verantwortlich. Wie oft musste Er im Lauf der Zeit züchtigend eingreifen, wenn die Könige aus der Linie Davids von Ihm abwichen und das Volk in Götzendienst verfiel!
Gott kommt zum Ziel
Ab Vers 39 spricht nicht mehr Gott. Bis Vers 46 ist es jetzt der Psalmist, der sich an Gott wendet. Seine Worte sind eine Voraussage von dem, was schliesslich zum Ende des Königtums in Juda und zum Ende der nationalen Selbstständigkeit des irdischen Volkes Gottes führte.
Als Nebukadnezar, der babylonische König, das Reich Juda und Jerusalem eroberte, die Menschen in die Gefangenschaft nach Babel verschleppte und die Stadt Jerusalem samt ihrer Mauer zerstörte, da erfüllten sich diese Psalmverse.
Glücklicherweise endet der Psalm nicht mit Vers 46. Ab Vers 47 hören wir prophetisch den treuen Überrest der Juden, der in der Zukunft mit diesen Worten zu Gott rufen wird. Gerade in der heute noch zukünftigen Drangsalszeit werden die Treuen zu Gott beten und fragen: «Bis wann, Herr?»
Sie werden Gott an seine früheren Gütigkeiten erinnern, die Er David in seiner Treue zugeschworen hat. Sie werden den Herrn bitten, des Hohns zu gedenken, mit dem ihre Feinde sowohl sie als auch seinen Gesalbten verhöhnt haben.
Diese Beter bekommen an dieser Stelle noch keine konkrete Antwort von Gott. Aber sie vertrauen völlig auf die Treue Gottes und glauben, dass sie nicht beschämt werden. In diesem Vertrauen können sie daher, noch bevor Gott eingreift, Ihn bereits rühmen: «Gepriesen sei der Herr in Ewigkeit! Amen, ja, Amen!»
Einleitung
In diesem geschichtlichen Bibelbuch wird der Name Gottes nicht erwähnt. Er wirkt im Hintergrund und führt seinen Plan mit dem Volk Israel trotz des feindlichen Widerstands aus.
- Esther geht mutig zum persischen König, um für die Rettung des jüdischen Volkes zu bitten. Da erfährt sie seine Gnade.
- Mordokai bleibt Gott, seinem Wort und seinem Volk treu. Nach einer Zeit der Bedrängnis kommt er zu hohen Ehren.
Kapitel 1 – 3: Die Bedrängnis der Juden
Kapitel 4 – 10: Die Rettung der Juden
Buchtipp: Betrachtung über das Buch Esther
Das Gastmahl des Königs
Das Buch Esther ist ein geschichtliches Buch der Bibel. Die darin berichteten Ereignisse spielten sich im persischen Weltreich unter dem Herrscher Xerxes I. ab. Er wird im Buch Esther König Ahasveros genannt. Es geht vor allem um das Schicksal der im persischen Reich lebenden Juden, die dem Aufruf von Kores, dem ersten Perserkönig, nicht gefolgt und nicht nach Jerusalem zurückgekehrt waren. Die in diesem Buch beschriebenen Geschehnisse fallen in die Zeit zwischen Esra 6 und 7.
Die Besonderheit des Buches Esther ist das vollständige Fehlen des Namens Gottes. Wir lesen auch nichts von einem Gebet, was auf eine Verbindung zu Ihm hinweisen würde. Gott wirkte jedoch hinter der Szene für sein irdisches Volk, zu dem Er sich wegen seines Ungehorsams nicht mehr offen bekennen konnte. Hier liegt auch die prophetische Bedeutung des Buches Esther. Es zeigt uns anhand geschichtlicher Ereignisse, wie Gott am Ende der Zeit für den treuen Überrest aus seinem Volk sorgen und ihn schliesslich durch das Kommen des Messias befreien wird.
Die Beschreibung des königlichen Gastmahls für die Mächtigen im Reich zeigt etwas von der herrlichen Grösse und dem überragenden Reichtum dieses Königs. Wir denken dabei an unseren Gott, der viel grösser und herrlicher ist als jeder menschliche König. Wie viele irdische Segnungen schenkt Er allen Menschen! (Matthäus 5,45; Apostelgeschichte 14,17). Das Gastmahl für das Volk erinnert an das Gastmahl der Gnade, das Gott für alle Menschen bereitet hat (Lukas 14,16-24). Doch viele wollen, wie die Königin Vasti, ohne Gott fröhlich sein.
Ahasveros verstösst Vasti
Die Weigerung Vastis, in ihrer Würde und Schönheit vor den König und seine Mächtigen zu treten, erschütterte die Autorität von Ahasveros aufs Tiefste. Wenn wir an die Vollmachten denken, die die persischen Herrscher besassen, dann war eine Auflehnung gegen ihre Autorität gravierend. Memukan, einer der sieben weisen Fürsten des Königs, erkannte sofort die weitreichenden Folgen des Verhaltens von Vasti. Es war eine reichsweite Autoritätskrise zu befürchten.
So wie Vasti sich weigerte, sich der Autorität ihres Ehemanns und Königs zu unterziehen, so verwerfen heute viele Menschen die Autorität Gottes, ihres Schöpfers. Sie nennen sich zwar noch Christen. Doch sie weigern sich, Gottes Schöpfungsordnung anzuerkennen. Sie lehnen sich gegen jede untergeordnete, aber von Gott gegebene Autorität auf. Auch wir als gläubige Christen stehen in Gefahr, hinter den menschlichen Autoritäten nicht mehr den Herrn als höchste Instanz zu sehen. Als Folge davon achten wir die Autorität des Ehemanns, der Eltern, der Vorgesetzten im Betrieb, der Regierungsbeamten gering.
Um dieser drohenden Autoritätskrise im Reich zu begegnen, wurde die auflehnerische Vasti abgesetzt. Zudem wurde ein königliches Gesetz erlassen, in dem festgeschrieben wurde, dass der Mann Herr in seiner Familie sei und er das Sagen habe. – Für uns Christen hat Gott im Neuen Testament klare Anordnungen über die Stellung von Mann und Frau, Eltern und Kindern, Herren und Knechte gegeben. Wir wollen sie mit der Hilfe des Herrn beherzigen und ausleben.
Esther erlangt Gunst
Zwischen Kapitel 1 und 2 verging eine nicht näher umschriebene Zeit. Nun wurde es dem persischen König schmerzlich bewusst, dass er keine Königin mehr hatte. Seine Diener schlugen ihm vor, sich nach einer neuen Königin umzusehen, was ganz im Sinn von Ahasveros war.
Nun werden zwei Personen aus dem Volk Israel eingeführt, die zu Hauptpersonen des ganzen Buches werden: Mordokai, ein Benjaminiter, der zu den Weggeführten aus Juda gehörte, und Hadassa oder Esther, die Tochter des Onkels von Mordokai, die eine Vollwaise war. Nach dem Tod ihrer Eltern hatte Mordokai sie als Tochter angenommen. Aufgrund der königlichen Anordnung wurde auch Esther ins Frauenhaus aufgenommen. Sie beugte sich unter diese Demütigung, denn diese gehörte zu den Folgen der Sünden ihres Volkes (Nehemia 9,37).
Wenn wir nach der praktischen Belehrung fragen, die uns diese Verse geben wollen, dann finden wir sie wohl in Vers 9. Warum wurde Hegai, der Leiter des Frauenhauses, auf Esther aufmerksam? Warum begünstigte er sie und brachte sie in den besten Teil des Hauses? Das Verhalten Esthers gibt keine Anhaltspunkte. Zweifellos war sie eine schöne Jungfrau. Doch schön waren auch die anderen. Es gibt nur eine Erklärung: Gott wirkte hinter der Szene zugunsten seines Volkes, das in der Gefangenschaft lebte. Er hatte es nicht aufgegeben. Er gibt auch uns nicht auf, wenn Er uns in seinen Regierungswegen züchtigen muss. Das ist ein grosser Trost.
Esther wird Königin
Die Fürsorge Mordokais für seine Adoptivtochter ist sehr schön. Tag für Tag versuchte er zu erfahren, wie es ihr ging. Unwillkürlich denken wir an die prophetische Seite dieser Geschichte. Mordokai weist auf den Herrn Jesus hin und Esther ist ein Bild des gläubigen Überrests in der Zukunft, dem die Aufmerksamkeit seines Messias gilt.
Nachdem Esther bereits die Gunst von Hegai erlangt hatte, fand sie auch Gnade in den Augen aller, die sie sahen. Und als sie zum König geführt wurde, erlangte sie nicht nur Gnade und Gunst von ihm, er schenkte ihr auch seine Liebe und machte sie zur Königin an Vastis statt. Wieder müssen wir sagen: Nur weil Gott im Hintergrund alles lenkte, kam es so weit. Dies geschah vier Jahre nachdem Vasti verstossen worden war (Esther 1,3; 2,16).
Vasti ist in der prophetischen Erklärung dieses Buches ein Bild des christlichen Bekenntnisses, das nach der Entrückung der Gläubigen nur noch Bekenner ohne Leben aus Gott umfasst. Es endet als Babylon (Offenbarung 17 und 18). Erst wenn Gott sein Gericht an der christuslosen Christenheit vollzogen hat, wird Er den gläubigen Überrest aus Israel wieder als sein Volk anerkennen und sich sozusagen mit seinem Volk vermählen.
Mordokai suchte das Wohl des Königs, der Stadt und des Landes, wohin er weggeführt worden war (Jeremia 29,7). Dadurch konnte er einen Anschlag auf den König rechtzeitig vereiteln. Doch er blieb vorläufig ohne Belohnung für seine Loyalität.
Haman kommt an die Macht
Seit der Krönung Esthers zur persischen Königin waren wieder einige Jahre vergangen (Esther 2,16; 3,7). Da beförderte der König einen Amalekiter königlicher Abstammung mit Namen Haman und setzte ihn über alle Fürsten, die am Hof des Königs lebten.
Es ist offensichtlich, dass Haman, der in diesem Buch mehrmals als «Widersacher der Juden» bezeichnet wird, mehr als nur eine geschichtliche Bedeutung hat. Er wird zum Gegenspieler Mordokais und weist prophetisch auf den Antichristen hin, der in der zukünftigen Drangsalszeit auftreten und sich als Gott verehren lassen wird (2. Thessalonicher 2,3.4).
Alle, die sich irgendwie am Hof des Königs aufhielten, zollten Haman höchste Ehre – wie der König es geboten hatte – und knieten vor ihm nieder. «Aber Mordokai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder.» Verstiess er damit nicht gegen die Obrigkeit? Nein, in diesem Fall traf Apostelgeschichte 5,29 zu: «Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen.» Mordokai kannte Gottes Urteil über Amalek, das Volk Hamans (2. Mose 17,16; 4. Mose 24,20; 1. Samuel 15,2.3). Als gottesfürchtiger Jude beugte er sich nicht vor dem, dessen Volk unter dem Urteil Gottes stand.
Vermutlich erklärte er denen, die ihn fragten: «Warum übertrittst du das Gebot des Königs?», dass er ein Jude sei und es ihm unmöglich sei, gegen Gottes Urteil über Amalek zu handeln. Mordokais Haltung weist prophetisch auf den gläubigen Überrest der Juden in der Endzeit hin, der sich weigern wird, den Antichristen als Messias anzuerkennen.
Haman will die Juden vernichten
Erneut erkennen wir das Handeln Gottes hinter der Szene. Zunächst bewirkte der Allmächtige, dass Haman nicht einfach Mordokai umbringen liess, sondern alle Juden im persischen Reich vertilgen wollte. Als der abergläubische Feind des Volkes Gottes das Los warf, um den günstigsten Zeitpunkt für sein böses Vorhaben zu erfahren, liess Gott das Pur auf den zwölften Monat fallen. Damit lag zwischen dem Tag des Erlasses bis zu dessen Ausführung die längst mögliche Zeitspanne, in der sich noch manches ereignen konnte.
Nachdem Haman durch das Werfen des Loses «das Schicksal befragt hatte», stellte er dem König sein Vorhaben vor. Er schilderte ihm das Volk der Juden – ohne jedoch diesen Namen zu erwähnen – auf eine Weise, die den König überzeugen musste. Dass das Volk Gottes abgesondert ist, bezeugte schon Bileam (4. Mose 23,9). Diese Absonderung war die Folge ihrer Beziehung zum wahren Gott im Gegensatz zu den übrigen Völkern, die ihre eigenen Götter hatten. Dass sie die Anordnungen des Königs nicht befolgten, war bis auf das Verhalten Mordokais gegenüber Haman eine glatte Lüge. Um sicher zu gehen, dass der König einwilligte, war Haman bereit, für die Ausführung des Plans finanziell persönlich aufzukommen, damit die Staatskasse nicht belastet wurde. Gott liess zu, dass dieser Mann – ein Werkzeug des Teufels – beim König Erfolg hatte. Nach dem Bekanntwerden der Anordnung war die Bestürzung in Susan gross. Eine noch grössere Not wird in der kommenden Drangsalszeit über dieses Volk kommen (z.B. Psalm 44,10-17).
Mordokai trauert
Der mit dem Siegel des Königs versehene Mordbefehl Hamans löste bei Mordokai und den übrigen Juden eine grosse Trauer aus. Die Bibel beschreibt das Verhalten Mordokais sehr ausführlich. Man merkt daraus, wie tief ihm die Not ging, in die der Erlass Hamans sein Volk gestürzt hatte.
Die Trauer der Juden und ihr Fasten, Weinen und Wehklagen reden prophetisch von der Trübsal und den tiefen Übungen, durch die der gläubige Überrest der Juden in der Drangsalszeit zu gehen hat. Im Bild von Mordokai sehen wir, wie der Herr Jesus sich mit den Nöten seines Volkes eins macht. Wie vieles hat Er in der Zeit, da Er als abhängiger Mensch hier lebte, von den Ungläubigen erlitten und durchmachen müssen! Manche Psalmen reden daher von den Leiden des treuen Überrests und weisen gleichzeitig auf Christus und seine Leiden hin (z.B. Psalm 126,5.6; 129,1-3). Die gleiche Art von Feinden, die damals dem Herrn Jesus widerstanden und Ihn schliesslich kreuzigten, wird in der Zukunft die gottesfürchtigen Juden bedrängen. Immer steht Satan dahinter.
Als Esther von der offensichtlichen und tiefen Trauer ihres Pflegevaters hörte, machte sie sich grosse Sorgen. Durch einen Hofbeamten, der als Verbindungsmann zwischen ihr und Mordokai operierte, erfuhr sie von der Trübsal, die über ihr Volk gekommen war. Sie erhielt auch eine Abschrift der erlassenen Anordnung. Gleichzeitig wurde ihr eine schwere Aufgabe übertragen: Sie sollte zum König hineingehen, ihn um Gnade anflehen und vor ihm für ihr Volk bitten.
Esther vor einer schwierigen Aufgabe
In ihrer Antwort an Mordokai zeigt Esther auf, wie lebensgefährlich eine solche Aktion war. Ungerufen zum König zu gehen, konnte auch für die Königin den Tod bedeuten.
Es scheint, dass Mordokai wusste, wie gefahrvoll Esthers Aufgabe war. Jedenfalls ging er auf ihre Vorwände überhaupt nicht ein. Er warnte sie aber vor dem Gedanken, sie könnte als Königin dem über die Juden verhängten Gericht entgehen.
Obwohl Vers 14 überaus ernste Worte an Esther enthält, deutet er doch auch das Gottvertrauen Mordokais an. Die Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her ist doch nichts anderes als die Hilfe von Seiten Gottes.
Die Frage am Schluss von Vers 14 weist auf Gottes Vorsehung hin. Hatte Er nicht dafür gesorgt, dass sie Königin wurde, um jetzt in der Not fürbittend für das Leben ihres Volkes vor den König zu treten. Esther war zu dem schweren Gang bereit, aber nicht ohne vorher drei Tage zu fasten, was sicher auf ihr eigenes Gebet und auf die ernste Fürbitte der anderen hinweist.
Was Esther in Vers 16 ausdrückt, wird in der Zukunft die Erfahrung des treuen Überrests sein. Der Mensch kann Gott nur auf der Grundlage unumschränkter Gnade nahen, niemals auf einem Weg eigener Verdienste.
Das war damals so; es ist heute nicht anders und es wird auch in der Zukunft für die Gottesfürchtigen aus Israel die einzige Möglichkeit sein.
Esther geht zum König
Drei Tage lang hatte Esther mit ihren Dienerinnen gefastet. Das bedeutet, dass sie sich in die Gegenwart Gottes, sozusagen ins Heiligtum zurückgezogen hatte. Innerlich gestärkt trat sie nun in den Hof des Palasts vor Ahasveros. Gott bewirkte, dass sie in den Augen des Königs Gnade fand und er ihr das goldene Zepter entgegenreichte. Indem sie dieses berührte, drückte sie aus, dass sie von der königlichen Macht und Autorität – symbolisiert im Zepter – Hilfe erwartete.
Das Ausmass der Gnade, das der König ihr anbot, war überwältigend: «Bis zur Hälfte des Königreichs, und es soll dir gegeben werden!» Wie gross ist die Gnade, die wir von Gott empfangen haben, als wir in Buße und Glauben zu Ihm kamen! Er hat uns im Herrn Jesus, den Er für uns ans Kreuz und in den Tod gegeben hat, alles geschenkt (Römer 8,32).
Warum äusserte Esther ihren Wunsch nicht auf der Stelle? Es ging nicht nur um ihr Leben, sondern auch um das Leben der anderen Juden. Daher musste Haman ebenfalls anwesend sein. Warum schiebt sie beim ersten Bankett die Sache nochmals um einen Tag hinaus? Sie wollte sichergehen, dass der König ihr helfen würde. Es ist schön zu sehen, dass Esther nichts überstürzte. Ja, wer auf den Herrn vertraut, «wird nicht ängstlich eilen» (Jesaja 28,16). – In der Zukunft wird bei den gottesfürchtigen Juden das Vertrauen zu Gott schrittweise zunehmen. Die Bußpsalmen (Psalm 25; 32; 38; 41; 51) zeigen, wie sie im Erkennen ihrer Sünden tiefer geführt werden und gleichzeitig ihr Vertrauen mehr und mehr auf Gott setzen.
Haman will Mordokai beseitigen
Nach dem ersten Mahl ahnte Haman noch nichts vom Unglück, das ihn ereilen würde. Fröhlich und guten Mutes verliess er den Palast. Doch als er Mordokai am Tor sah, der ihm keinerlei Ehre erwies, verwandelte sich seine gute Stimmung in Grimm.
Was Haman zu Hause seiner Frau und seinen Freunden erzählte, zeugt vom Hochmut und von der Selbstherrlichkeit, die ihn erfüllten. Doch die Worte in Vers 13 lassen auf die tiefe Wurzel seines Grimms schliessen. Er war zwar mit allen Ehren überhäuft worden. Doch solange dieser Mordokai sich nicht vor ihm beugte, hatte er einen Gegenspieler, der es mit ihm aufnahm. Da er Mordokai nicht in die Knie zwingen konnte, wollte er ihn umbringen. – Wir denken an Satan, der in der Wüste den Herrn Jesus zu Fall zu bringen suchte. Es gelang ihm nicht. Ungefähr drei Jahre später hatte Satan die Menschen derart in seiner Gewalt, dass sie den Herrn Jesus umbrachten. Doch als der Teufel meinte, durch die Kreuzigung des Herrn gesiegt zu haben, erlitt er selbst die grösste Niederlage (Hebräer 2,14.15).
Haman hörte auf seine Berater und liess den 25 Meter hohen Galgen errichten. Nun brauchte er nur noch die Einwilligung des Königs. Haman gleicht ein wenig dem reichen Kornbauern in Lukas 12, der seine Pläne ohne Gott machte und nicht wusste, dass das Urteil über ihn bereits gefällt war. Wir werden sehen, dass der Reichtum Hamans für einen anderen war, seine Herrlichkeit seinem Feind gegeben wurde und er schliesslich an seinem eigenen Galgen hing.
Eine schlaflose Nacht
In den ersten 2 Versen wird einmal mehr klar, dass Gott hinter der Szene wirkte, dieses Mal vor allem zugunsten Mordokais. Gerade in der Nacht, in der an einem anderen Ort in der Stadt die Ermordung Mordokais geplant wurde, konnte der König nicht schlafen! Beim Vorlesen aus dem Buch der Denkwürdigkeiten der Chroniken stiess man ausgerechnet auf den Eintrag, von dem am Schluss von Kapitel 2 berichtet wird! Das konnte nur Gott bewirken. Die Loyalität Mordokais gegenüber dem König, die damals unbelohnt blieb, sollte nachträglich honoriert werden.
Haman, der vermutlich zu ungewohnt früher Stunde die Tötung Mordokais veranlassen wollte, sollte dem König eine Belohnung für den Mann vorschlagen, «an dessen Ehre der König Gefallen hat». Haman war durch seinen Hochmut so verblendet, dass er nur noch an sich dachte und eine entsprechende Ehrung vorschlug.
Diese inspirierten Verse zeigen, dass sowohl der König als auch Haman an Mordokai dachten. Der eine wollte ihn an den Galgen hängen, der andere hatte im Sinn, ihn auszuzeichnen. War es beim Herrn Jesus nicht ganz ähnlich? Der Teufel versuchte von allem Anfang an, den Menschen Jesus Christus zu beseitigen (angefangen beim Kindermord in Bethlehem bis hin zum Kreuz). Im Gegensatz zu Mordokai wurde der Herr wirklich an ein Holz gehängt und umgebracht. Aber weil Er bis zum Tod am Kreuz gehorsam wurde, «hat Gott ihn auch hoch erhoben». Er hat Ihn auf den Ehrenplatz zu seiner Rechten erhöht und Ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt (Philipper 2,9; Hebräer 2,9).
Haman muss Mordokai ehren
Das Erschrecken Hamans muss furchtbar gewesen sein, als er vom König den Befehl erhielt, Mordokai, seinen ärgsten Feind, auf die vorgeschlagene Weise zu ehren. Haman hatte keine andere Wahl, als dies auszuführen, und zwar an jenem Vormittag, bevor er zum Mahl mit dem König und der Königin ging.
Das war der von Gott vorgesehene Zeitpunkt. Bevor Esther ihre Bitte um Verschonung ihres Volkes vorbringen konnte, musste Mordokai ins Rampenlicht treten. Die ganze Stadt sollte wissen, dass dieser verachtete Jude der Mann war, «den der König zu ehren wünschte».
Und Haman? Nachdem er den Auftrag des Königs ausgeführt hatte, kehrte er völlig zerknirscht nach Hause zurück. Als seine weisen Freunde und seine Frau hörten, was geschehen war, konnten sie nur die endgültige Niederlage prophezeien. Als Grund nannten sie die Tatsache, dass Mordokai «vom Geschlecht der Juden ist». Haman hatte sich am Volk der Juden, zu dem Gott eine besondere Beziehung hat, vergriffen.
Der Widersacher der Juden ist hier nicht nur ein Bild des Antichristen, sondern auch von Satan, der weiss, dass er schliesslich der grosse Verlierer ist. Er wurde am Kreuz besiegt und wird im Feuersee enden (Offenbarung 12,9.12; 20,2.10). Die Weisheit der Welt, hinter der Satan steht, ist wirklich Torheit bei Gott. Wenn uns dies doch mehr bewusst wäre! Wir würden mit all ihren Ideen vorsichtiger umgehen und sie nicht so schnell und unbesehen übernehmen.
Esther bittet für ihr Volk
Dreimal hatte der König bei der Frage nach der Bitte Esthers seine Grosszügigkeit mit den Worten ausgedrückt: «Bis zur Hälfte des Königreichs, und es soll dir gegeben werden.» Nun war Esther überzeugt, dass der König ihr helfen würde. Seine Gnade gab ihr Mut, für sich und das Leben ihres Volkes zu bitten.
Die Reaktion des Königs zeigt, wie ahnungslos er war. Als Esther damals in die Burg Susan geholt wurde, um vor den König zu kommen, wies Mordokai sie an, ihr Volk und ihre Abstammung zu verschweigen (Esther 2,10). So wusste wohl niemand am Hof, dass sie eine Jüdin war. Mordokai hingegen hatte aufgrund seines Verhaltens gegenüber Haman erklärt, dass er ein Jude war. Als Haman eine Anordnung gegen die Juden erwirken wollte, verschwieg er den Namen dieses Volkes, damit der König keinen Verdacht schöpfte und die Sache näher untersuchte.
Die Antwort Esthers auf die Frage des Königs brachte alles ans Licht. Der Schrecken Hamans muss gewaltig gewesen sein. Der König aber stand ohne eine weitere Frage in seinem Grimm auf und ging in den Garten hinaus. Ihm muss schlagartig klar geworden sein, was für einen Mann er begünstigt hatte und was für einen niederträchtigen Plan dieser ausführen wollte.
Haman versuchte bei der Königin, um sein Leben zu bitten, doch ohne Reue und Bekenntnis. Sein Verhalten veranlasste den König, ein sofortiges Urteil zu fällen und es auf der Stelle ausführen zu lassen. Ein Hofbeamter wagte nun vom aufgerichteten Galgen für Mordokai zu erzählen. Daran wurde Haman gehängt.
Der Plan zur Rettung der Juden (1)
«An jenem Tag.» Dieser Ausdruck erinnert an das Kommen des Herrn in Herrlichkeit. Manche Stellen im Neuen Testament sprechen dabei von «jenem Tag» (z.B. 2. Thessalonicher 1,10; 2. Timotheus 1,12.18; 4,8). Im Blick auf die prophetische Seite unserer Geschichte wird Gott an jenem Tag auf das Flehen des gläubigen Überrests antworten und den Antichristen richten, und zwar durch die Erscheinung des Herrn selbst. Das wird hier durch die Bitten Esthers, den Tod Hamans und die Erhöhung Mordokais gezeigt.
Bei den Persern konnte eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit seinem Siegel versehen war, nicht widerrufen werden (Vers 8; Daniel 6,9). Das den Juden drohende Unheil war also durch den Tod Hamans nicht beseitigt. Daher flehte Esther noch einmal um Gnade beim König. Wieder reichte er ihr das goldene Zepter. Wie sehr wurde der Glaube Esthers belohnt! Ihrer Bitte konnte der König zwar nicht entsprechen. Aber er fand einen Ausweg. Ist das nicht eine Ermunterung für uns? Auch wir dürfen Gott unsere Nöte im Vertrauen auf seine Gnade vorstellen. Er weiss einen Ausweg, wo alles unmöglich scheint.
Als Antwort auf ihre Bitte wies er sie an, einen entsprechenden Gegenbefehl zu erlassen, ihn mit dem Siegelring des Königs, den er Mordokai gegeben hatte, zu untersiegeln und ihn im ganzen Reich bekannt zu machen. Dem ersten Gesetz wurde ein zweites entgegengestellt. Die nächsten Verse zeigen, wie dieses ausgesehen hat.
Der Plan zur Rettung der Juden (2)
Als Haman zu Beginn das Los warf, hatte Gott in seiner Vorsehung zugunsten seines Volkes gewirkt und es auf den zwölften Monat fallen lassen. So blieb jetzt noch genügend Zeit für einen entsprechenden Gegenerlass. Auch diese neue Anordnung wurde auf schnellstem Weg im ganzen Reich verbreitet. Sie erlaubte den Juden, sich am dreizehnten Tag des zwölften Monats gegenüber denen zu wehren, die sie bedrängten. Es wurde ihnen gestattet, sich an ihren Feinden zu rächen.
Als gläubige Christen sind wir vielleicht erstaunt, dass ein derartiger Befehl nach Gottes Willen war. Doch wir müssen bedenken, dass die Zeit Esthers auf die Endzeit hinweist, in der Gott nicht mehr in Gnade mit den Menschen handeln wird. Er wird seine Ziele dann auf dem Weg des Gerichts erreichen.
Die Beschreibung Mordokais, wie er als geehrter Mann aus der Gegenwart des Königs trat, lässt uns an das Erscheinen von Jesus Christus denken. Er, den die Menschen einst gekreuzigt haben, wird einmal in seiner offiziellen Herrlichkeit sichtbar vor aller Welt erscheinen. Er ist der König der Könige und Herr der Herren.
Der neue Erlass löste bei den Juden grosse Freude aus. Wie hatte sich das Blatt gewendet! Das beeindruckte viele ihrer Mitmenschen, so dass sie Juden wurden (Vers 17b). Ähnlich wird es in der Zukunft sein. Viele Nationen werden sich dem Herrn anschliessen (Sacharja 2,15). «Die Edlen der Völker haben sich versammelt mit dem Volk des Gottes Abrahams» (Psalm 47,10).
Die Juden rächen sich an den Feinden (1)
Als der dreizehnte Tag des zwölften Monats kam, erreichten die Feinde der Juden ihr erhofftes Ziel nicht. Alle, die die Gesinnung Hamans teilten und das Volk der Juden hätten vernichten wollen, wurden nun selbst überwältigt. Niemand konnte vor den Juden bestehen, «denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen». Hinter den Juden stand der einflussreich gewordene Mordokai. Niemand wagte es, sich gegen ihn aufzulehnen.
In der Endzeit, wenn Christus erscheinen wird, um seine Herrschaft hier anzutreten, wird es ganz ähnlich sein. Er ist der Sohn des Menschen, dem Gott das ganze Gericht übertragen hat. Er besitzt diese Vollmacht und wird sie auch ausüben. Gleichzeitig wird Ihm jede Verehrung zukommen (Johannes 5,22.23.27). Das Gericht an den Nachbarvölkern Israels, die es immer wieder angegriffen haben, wird Christus nicht persönlich ausführen. Der Überrest selbst wird dies tun.
Viele Stellen in den Psalmen und Propheten reden davon, wie der Herr Jesus, der dann seine Universalherrschaft antreten wird, seinem irdischen Volk die Nationen unterwerfen wird (Psalm 47,3.4; 118,10-12; Jesaja 11,14; 51,22.23; Micha 4,13; Sacharja 12,6; Maleachi 3,21).
Der kontinuierlich wachsende Einfluss von Mordokai, wie er in Vers 4 beschrieben wird, weist ebenfalls auf die Zukunft hin. Beim Kommen des Herrn zur Errichtung seines Friedensreiches wird Er nach und nach die Herrschaft über alles übernehmen.
Die Juden rächen sich an den Feinden (2)
Am Wohnort Hamans, in der Burg Susan, wo die Feindschaft gegen die Juden wohl am intensivsten war, bekamen sie noch einen zweiten Tag, um sich an ihren Feinden zu rächen. Die zehn Söhne des Widersachers der Juden und ihr Los werden besonders erwähnt. Wie ihr Vater wurden sie ebenfalls an den Baum gehängt. Eine ernste Warnung an alle, die noch nicht zur Familie Gottes gehören. Wer nicht Buße tut und an den Herrn Jesus glaubt, wird schliesslich das gleiche Los teilen wie der Teufel; denn solange ein Mensch sich nicht bekehrt und kein neues Leben besitzt, gehört er zur Familie des Teufels (Johannes 8,44). Dieser wird am Ende in den Feuersee geworfen werden. Aber auch jeder, der nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, wird dorthin kommen (Offenbarung 20,10.15).
Mehrmals wird betont, dass die Juden ihre Hand nicht an die Beute legten. Sie wollten sich nicht an ihren Feinden bereichern. Es ging nur um die Befreiung aus der Hand derer, die sie hassten und vernichten wollten.
Nachdem die Juden für ihr Leben eingestanden waren und ihre Feinde überwältigt hatten, feierten sie einen Tag des Gastmahls und der Freude. Nun hatten sie Ruhe von ihren Feinden und die Freude konnte nicht mehr gestört werden. Dieser Festtag ist ein schönes Bild von dem, was das Volk Gottes und mit ihm die Nationen im Tausendjährigen Reich unter der Regierung des wahren Mordokais – Jesus Christus – erleben werden.
Das Purimfest
Der Tag des Gastmahls und der Freude, den die Juden nach der Überwältigung ihrer Feinde spontan gefeiert haben, sollte zu einem jährlich wiederkehrenden Festtag werden. Mordokai hielt diesen Brauch schriftlich fest. In einem Brief an alle Juden im persischen Reich ordnete er das Festhalten dieser Tage an. Noch heute feiern die Juden das Purimfest. Der Tag, an dem das jüdische Volk hätte vernichtet werden sollen, wurde zum Tag seiner Erlösung.
Auch wir Christen haben einen Tag, an dem wir gemeinsam an unseren Erlöser und sein gewaltig grosses Erlösungswerk, das Er am Kreuz vollbracht hat, denken dürfen. In der Nacht, in der der Herr Jesus überliefert wurde, hat Er sein Gedächtnismahl mit den Worten eingesetzt: «Dies tut zu meinem Gedächtnis.» Im Gegensatz zu den Juden, die das Purimfest jährlich feiern, dürfen und sollen wir das Gedächtnismahl des Herrn an jedem ersten Tag der Woche halten.
Die Juden haben am Purimfest einander Teile gesandt und den Armen Geschenke gegeben. Das erinnert uns an das materielle Opfer, das wir zusammen mit den Opfern des Lobes jeweils am ersten Tag der Woche dem Herrn geben dürfen (Hebräer 13,15.16; 1. Korinther 16,2).
Das Purimfest sollte auch unter den Nachkommen der damaligen Juden nicht in Vergessenheit geraten. Und so dürfen wir die Anweisung und Aufforderung des Herrn für sein Gedächtnismahl unseren Kindern weitergeben, damit sein Tod in dieser Welt verkündigt wird, «bis er kommt».
Die Grösse Mordokais
Bei der Festsetzung der Purimtage war auch von Fasten und Wehklage die Rede. Die Juden sollten nie vergessen, aus welcher Notlage sie damals befreit wurden. Wenn wir an unseren Erlöser und die wunderbare Erlösung denken, dann wollen wir nie vergessen, wie schrecklich unsere Sünden in Gottes Augen sind und welch einen unendlich hohen Preis unser Heiland für unsere Errettung bezahlen musste. Furchtbares hat Er in den drei Stunden der Finsternis am Kreuz durchgemacht, als Er für uns und unsere Sünden von Gott gestraft wurde. Ewig gebührt Ihm Lob und Dank dafür!
Das letzte kurze Kapitel weist prophetisch auf die Regierung im Tausendjährigen Reich hin. Die Abgaben, die der König dem Land auferlegte, zeigen, dass in der Zukunft alle Nationen dem Volk Israel unterworfen und tributpflichtig sein werden. Der Reichtum der Nationen wird dann nach Israel gebracht werden (Jesaja 60,5.6.16; 61,6).
Die Beschreibung der Grösse Mordokais ist nur ein schwaches Abbild von der Grösse und Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus, die einmal in seinem Reich voll entfaltet werden. Für dich und mich darf Er heute schon der Grösste und Herrlichste, ja, der Mittelpunkt unserer Gedanken und unserer Bewunderung sein.
Dass Mordokai der zweite nach dem König war, weist darauf hin, dass der Herr Jesus als Mensch regieren wird. Der Messias des Volkes Israel ist der Mensch Jesus Christus. Er wird den höchsten Platz einnehmen, und alle seine Bemühungen werden zum Segen Israels ausschlagen. Dann wird auf der Erde Frieden sein.
Einleitung
Der Hebräer-Brief richtete sich damals an Menschen aus dem Volk Israel, die Christen geworden waren. Durch den äusseren Widerstand wurden sie auf dem Weg zum Himmel entmutigt. So standen sie in Gefahr, zum Judentum zurückzukehren.
Der Schreiber des Briefs lenkt den Blick der Gläubigen auf Christus zur Rechten Gottes. Seine herrliche Person verbindet sie mit dem Himmel und löst sie von der Erde. Das gibt ihnen Kraft, den Glaubensweg mutig weiterzugehen.
Kapitel 1 – 2:
Jesus Christus ist eine herrliche Person
Kapitel 3 – 6:
Der Hohepriester hilft auf dem Weg zum Himmel
Kapitel 7 – 10:
Der Hohepriester führt Anbeter zu Gott
Kapitel 11 – 13:
Auf dem Weg zum himmlischen Ziel
Buchtipp: Aufblicken – Christus im Hebräer-Brief
Gott redet im Sohn
Die beiden ersten Kapitel stellen uns den Herrn Jesus in einer doppelten Aufgabe vor:
- Als Apostel ist Er aus dem Himmel auf die Erde gekommen, um uns Menschen Gott nahe zu bringen.
- Als Hoherpriester ist Er als Mensch in den Himmel gegangen, um uns Glaubende zu Gott zu führen.
Gott hatte schon zur Zeit des Alten Testaments oft und auf verschiedene Weise durch Propheten zu uns Menschen gesprochen. Aber am Ende der Tage hat Er in der Person des Sohnes zu uns geredet, d.h. durch seine Menschwerdung, durch sein Reden, durch seine Werke und durch sein Verhalten. Bedenken wir: Wenn der Sohn Gottes uns eine Botschaft mitteilt, fordert das unsere volle Aufmerksamkeit!
Die Verse 2 und 3 machen uns mit sieben Aspekten seiner göttlichen Herrlichkeit bekannt:
- Als «Erbe aller Dinge» hat der Sohn Gottes einen Besitzanspruch auf die ganze Schöpfung.
- Er ist der Schöpfer des Universums, denn Er hat «die Welten gemacht».
- Er hat die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt, als Er in seinem Leben auf der Erde bei bestimmten Gelegenheiten in die Naturgesetze eingegriffen hat.
- In Ihm ist Gott in seinem Wesen als ein Gott des Lichts und der Liebe offenbar geworden.
- Durch sein Sterben am Kreuz hat Er in göttlicher Macht die Reinigung der Sünden bewirkt.
- Nach Beendigung seiner Aufgabe auf der Erde hat Er sich in göttlicher Würde auf den höchsten Platz im Himmel gesetzt.
Der Sohn steht über den Engeln
Nachdem der Schreiber in Vers 4 erklärt hat, dass Jesus Christus über die Engel erhaben ist, begründet er diese Tatsache mit sieben Zitaten aus dem Alten Testament.
Der Herr Jesus steht hier nicht als der ewige Sohn Gottes vor uns wie in Johannes 1, sondern als der, der vom Heiligen Geist gezeugt wurde und deshalb Sohn Gottes durch Geburt ist. Das macht uns das Zitat aus Psalm 2,7 deutlich.
In Vers 6 werden unsere Gedanken zum Tausendjährigen Reich gelenkt: Wenn Christus ein zweites Mal erscheinen wird, werden Ihn alle Engel anbeten. Dann wird öffentlich sichtbar werden, dass Er über diesen himmlischen Geschöpfen steht.
In den Versen 7 und 8 wird der Sohn Gottes mit zwei weiteren Worten aus dem Alten Testament den Engeln gegenübergestellt. Die Engel dienen Gott, Jesus Christus hingegen wird über Himmel und Erde herrschen. Aus zwei Gründen hat Er Anspruch auf den Thron: Erstens weil Er der Sohn Gottes ist und zweitens weil Er hier ein vollkommenes Leben geführt hat. Wie kein anderer hat Er das Gute verwirklicht und das Böse verurteilt.
Eine weitere Herrlichkeit des Sohnes besteht darin, dass Er unveränderlich derselbe bleibt. Die Schöpfung, die Er gemacht hat, wird einmal vergehen, Er selbst wird jedoch ewig bestehen.
Da Jesus Christus die Hauptperson des Christentums ist und die Engel das Judentum vertreten, ergibt sich aus diesem Kapitel folgendes Fazit: Weil Er so viel grösser ist als die Engel, ist der christliche Glaube viel erhabener als der jüdische.
Der Sohn des Menschen ist verherrlicht
Die ersten vier Verse dieses Kapitels gehören gedanklich noch zum vorherigen. Wenn der Sohn Gottes mit solch grosser Herrlichkeit ausgestattet ist, sind seine Worte überaus wichtig.
Das Gesetz vom Sinai hatten die Israeliten durch Engel empfangen (Apostelgeschichte 7,53). Das Wort der Errettung hingegen verkündigte der Herr selbst. Nach seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt fuhren die Apostel mit der Predigt des Evangeliums fort, wobei der Heilige Geist am Anfang durch Zeichen und Wunder bezeugte, dass diese Botschaft von Gott kam.
Weil die Hebräer damals einem äusseren Widerstand ausgesetzt waren, standen sie in Gefahr, sich vom Wort des Herrn Jesus abzuwenden und zum Judentum zurückzukehren. Das traf vor allem auf solche Juden zu, die sich nur äusserlich zum christlichen Glauben bekannt hatten. Auch heute ist es sehr ernst, wenn Menschen dem Evangelium den Rücken kehren, denn damit lehnen sie das einzige Mittel zu ihrer Errettung ab.
Ab Vers 5 wird Jesus Christus als Sohn des Menschen vorgestellt. Auch unter diesem Titel steht Er über den Engeln. Durch sein Sterben am Kreuz wurde Er zwar ein wenig unter die Engel erniedrigt, aber Er ist zur Rechten Gottes erhöht worden. Dort nimmt Er jetzt als Mensch den höchsten Platz ein, denn Gott hat Ihm alles unterworfen. Diese Tatsache ist jetzt noch nicht sichtbare Realität. Erst im Tausendjährigen Reich wird sich jedes Knie vor Ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass Er Herr ist (Philipper 2,10.11).
Der Urheber der Errettung
Als Glaubende sehen wir Jesus Christus zur Rechten Gottes mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er, der dort den höchsten Platz einnimmt, hat sich am Kreuz tief erniedrigt und durch Gottes Gnade für alles den Tod geschmeckt. Der Ausdruck «für alles» zeigt, wie umfassend sein Erlösungswerk am Kreuz ist. Er starb für alles, was durch die Sünde dem Tod und der Vergänglichkeit unterworfen worden ist.
In Vers 10 werden zwei Gedanken über den Herrn Jesus vorgestellt:
- Einerseits bringt Er aufgrund seines Todes viele Söhne zur Herrlichkeit. Kein Einziger wird auf der Strecke bleiben, alle Glaubenden werden das Ziel erreichen. Welche Sicherheit!
- Anderseits ist Er in seinem Leben bis in den Tod durch Leiden vollkommen gemacht worden. Weil Er in allen Schwierigkeiten des menschlichen Lebens erprobt wurde, ist Er jetzt vollkommen fähig, uns zu verstehen und uns zu helfen.
Der Herr Jesus und die Erlösten auf der Erde bilden eine Genossenschaft. Wir sind von der gleichen Art wie Er. Er ist als Mensch im Himmel, und wir sind himmlische Menschen auf der Erde. Daraus ergeben sich mindestens drei Vorrechte für uns:
- Der Herr offenbart uns Gott, indem Er uns seinen Namen kundtut (Vers 12).
- Der Herr stimmt das Lob und die Anbetung in unseren Herzen an (Vers 12).
- Der Herr hat uns ein vollkommenes Gottvertrauen vorgelebt, das wir nachahmen dürfen (Vers 13).
Befreiung und Hilfe
Die Verse 14 und 15 beschreiben, was der Herr Jesus vollbringen musste, um uns zu befreiten Kindern Gottes zu machen. Zuerst ist Er Mensch geworden, um in unsere Stellung zu kommen. Im Gegensatz zu uns war Er jedoch ohne Sünde. Deshalb konnte Er uns aus der Macht des Todes und des Teufels befreien. So starb Jesus Christus am Kreuz, um in seinem Tod den Teufel zu besiegen und seine Waffe (den Tod) für uns Glaubende unwirksam zu machen. Das hat zwei Auswirkungen:
- Wir sind von unserem toten Zustand befreit und fähig gemacht, nun für Gott zu leben.
- Der leibliche Tod ist für uns kein Schrecken mehr. Wenn wir sterben, gehen wir zu Christus, wo wir es viel besser haben.
Die «Nachkommen Abrahams» in Vers 16 sind alle Glaubenden, denn er wird in Römer 4 ihr Vater genannt. Der Herr Jesus hat sich also nicht der Engel angenommen, sondern der Glaubenden, um sie alle zu Priestern zu machen. Dazu war zweierlei nötig:
- Durch seinen Tod hat Christus die Sünden des Volkes vor dem heiligen Gott gesühnt (Vers 17). Dadurch ist das Problem unserer Sünden für immer gelöst worden, so dass wir als Anbeter vor Gott erscheinen können.
- In seinem Leben hat Jesus gelitten, als Er in den Schwierigkeiten erprobt worden ist (Vers 18). Darum kann Er jetzt als Hoherpriester dem Problem unserer Schwachheiten begegnen. Er hilft uns, damit wir trotz Schwierigkeiten nicht verzweifeln, sondern auf dem Weg zum himmlischen Ziel Gott mit Freuden loben und anbeten.
Eine himmlische Berufung
Wie schnell verlieren wir doch in den Situationen des Lebens den Herrn Jesus aus unserem Blickfeld! Darum heisst es in Vers 1: «Betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus.» Wenn wir im Glauben auf Ihn blicken, bekommen wir einen tiefen Eindruck von seiner Erhabenheit. Das hilft uns, unsere himmlische Berufung als Christen im Alltag besser zu verwirklichen.
Ab Vers 2 wird Christus mit Mose verglichen. Mose war ein grosser Glaubensmann und ein treuer Diener des Hauses Gottes in der Wüste. Doch der Herr besitzt grössere Herrlichkeit:
- Er ist der Schöpfer des Universums. In den Versen 3 und 4 wird die Stiftshütte in der Wüste mit dem Weltall verglichen. In ihren drei Abteilungen stellt sie die Erde und die Himmel vor, die der Herr Jesus in seiner Allmacht erschaffen hat (Hebräer 1,2). An seiner Machtfülle dürfen wir im Glauben festhalten, wenn wir in den Schwierigkeiten zu versinken drohen. Er ist in der Lage, jederzeit alle unsere Probleme zu lösen. Bei der Entrückung wird Er uns aus allen Schwierigkeiten herausnehmen. Das ist uns sicher!
- Christus ist Sohn über sein Haus (Vers 6). Dieses Haus sind wir, die Erlösten, die die Versammlung Gottes bilden. Auch davon ist das Zelt der Zusammenkunft in der Wüste ein Vorausbild. Hier steht seine Autorität als Herr in der Versammlung vor uns. Trotz mancher Schwierigkeiten auf dem gemeinsamen Weg der Christen läuft Ihm nichts aus dem Ruder. Vom Himmel her hält Er alles in seinen Händen. Das ist ein grosser Trost!
Keine Ruhe auf der Erde
Der Abschnitt von Hebräer 3,7 – 4,13 bildet einen Einschub, bevor der Schreiber in Hebräer 4,14 weiter über den Herrn Jesus als unseren Hohenpriester spricht.
In dieser Einschaltung wird unser Leben auf der Erde mit der Wüstenwanderung des Volkes Israel verglichen. Damals verhärteten viele Israeliten ihr Herz durch mangelndes Vertrauen auf Gott, obwohl sie während 40 Jahren täglich seine Güte erfuhren. Wegen ihres Unglaubens gingen sie nicht in die Ruhe des verheissenen Landes ein, sondern starben in der Wüste.
Ab Vers 12 werden wir direkt angesprochen. Obwohl der Schreiber des Briefs davon ausgeht, dass wir eine echte Glaubensbeziehung zu Gott haben, schliesst er nicht aus, dass es unter den Christen auch blosse Bekenner gibt. Wenn es auf dem christlichen Weg schwierig wird, offenbaren diese ihr böses Herz des Unglaubens durch ein Abfallen vom lebendigen Gott, indem sie sich vom christlichen Glauben abwenden. Sie gleichen dann den Israeliten, die wegen ihres Unglaubens in der Wüste gestorben sind.
Die «Genossen des Christus» in Vers 14 sind echte Christen, die mit Herzensüberzeugung zum Glauben an Ihn gekommen sind und deshalb standhaft beim christlichen Glauben bleiben.
In den Versen 16-19 werden mit drei Fragen drei Ursachen aufgegriffen, die dazu führten, dass alle Israeliten – ausser Kaleb und Josua – nicht in die Ruhe eingingen: Sünde im Leben (Vers 17), Ungehorsam gegen Gott (Vers 18) und Unglauben im Herzen als die böse Wurzel von allem.
Auf dem Weg zur Ruhe Gottes
Vers 1 richtet sich an wahre Gläubige, denen eine zukünftige Ruhe im Himmel verheissen ist. Wenn sie in der Welt Ruhe und Bequemlichkeit suchen, so scheint es, als ob sie das himmlische Ziel verfehlen würden. Doch der Herr wird dafür sorgen, dass jeder Erlöste dieses Ziel erreicht. Das bestätigt uns der erste Teil von Vers 3.
In Vers 2 wird das Grundproblem der meisten Israeliten in der Wüste und der unechten christlichen Bekenner aufgedeckt: Sie hören das Wort Gottes, glauben ihm jedoch nicht. Solche Menschen vergleicht der Herr mit jenem Mann, der sein Haus auf den Sand baute. Als der Sturm wütete und die Flut kam, fiel es zusammen (Matthäus 7,26.27).
Die verheissene Ruhe für die Glaubenden steht mit der Schöpfung in Verbindung. Nachdem Gott während sechs Tagen alles auf der Erde erschaffen hatte, ruhte Er am siebten Tag (Vers 4). Doch dann kam durch die Übertretung Adams die Sünde in die Welt. Seither gibt es auf der Erde keine echte Ruhe mehr, bis Gott zu Beginn des Tausendjährigen Reichs die Schöpfung wieder in Einklang mit sich selbst gebracht haben wird. Dann kann die Sabbatruhe für das Volk Gottes anbrechen.
Demzufolge konnte Josua die Israeliten durch die Eroberung des Landes Kanaan nicht in die Ruhe einführen (Vers 8). Als weitere Konsequenz gibt es auch für uns Christen hier auf der Erde keine echte Ruhe. Darum sollen wir die Zeit hier nutzen, um für den Herrn zu arbeiten. Gleichzeitig sehnen wir uns nach der Ruhe, die uns im Himmel erwartet (Vers 11).
Hilfsmittel auf dem Glaubensweg
Auf dem Weg zur himmlischen Ruhe besitzen wir drei Hilfsquellen, um trotz Schwierigkeiten im Glauben mutig vorwärtszugehen:
- Die Wirksamkeit des Wortes Gottes (Hebräer 4,12-13),
- die Hilfe unseres Hohenpriesters (Hebräer 4,14-15) und
- die Möglichkeit des Gebets (Hebräer 4,16).
Gott teilt uns in seinem Wort mit, wie Er über alles denkt. Wenn wir die Bibel lesen, durchdringt dieses Schwert unser Herz und stellt alle unsere Überlegungen und Empfindungen ins Licht Gottes. Es unterscheidet zwischen dem, was von uns selbst kommt, und dem, was der Geist bewirkt. Dieser beurteilende und korrigierende Prozess mag schmerzlich sein, hilft uns aber, auf dem Weg des Glaubens zu bleiben.
Nach seinem Tod und seiner Auferstehung ist der Herr Jesus als Mensch durch die Himmel gegangen und im Wert seines Opfers bis zum Thron Gottes vorgestossen. Dadurch hat Er diesen Thron der Gerechtigkeit und des Gerichts (Psalm 89,15) für die Erlösten in einen Thron der Gnade umgewandelt. Gleichzeitig ist Er dort als Hoherpriester für uns tätig. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, die uns im Glaubensleben Mühe machen. Deshalb unterstützt Er uns, damit wir nicht aufgeben, sondern mit festem Schritt weitergehen.
Vers 16 gibt uns zwei Zusagen für das freimütige Gebet am Thron der Gnade:
- Weil wir schwache und wankende Menschen sind, bekommen wir Barmherzigkeit.
- Für unseren Lebensweg, der oft kein Spaziergang, sondern ein Kampf ist, finden wir Gnade.
Das Hohepriestertum des Herrn Jesus
Die Verse 1-4 beschreiben das Priestertum von Aaron und seinen Nachkommen im Volk Israel. Drei Punkte fallen uns auf, die im Gegensatz zu Jesus Christus, unserem Hohenpriester, stehen:
- Die Hohenpriester in Israel wurden aus dem sündigen Menschengeschlecht genommen (Vers 1).
- Diese Hohenpriester waren selbst mit Schwachheiten und Fehlern behaftet (Vers 2).
- Sie mussten auch für ihre eigenen Sünden Opfer bringen (Vers 3).
Christus hingegen ist Gott und Mensch in einer Person. Weil Er sündlos ist und nie eine Sünde getan hat, musste Er für sich selbst nicht opfern. Darum ist Er unser vollkommener Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks.
Ab Vers 7 geht es um sein Leben auf der Erde, das eine Voraussetzung für seinen Priesterdienst war. Er hat hier in ständiger Abhängigkeit von Gott gelebt, was besonders in Gethsemane zum Ausdruck kam. Dort dachte Er an das Werk, das Er am Kreuz vollbringen würde. Wie schwer war es für Ihn, zur Sünde gemacht zu werden! Deshalb brachte Er seine Not im Gebet zu Gott. Obwohl Dieser dem Herrn Jesus den Sühnungstod nicht ersparen konnte, erhörte Er sein Gebet. Wegen seiner echten Frömmigkeit und Hingabe an Gott wurde Christus nach drei Tagen auferweckt und so aus dem Tod errettet.
Als Jesus in den Himmel eintrat, wurde Er von Gott mit Freude empfangen. Nach einem gehorsamen Leben, das Ihm Leiden bis in den Tod eingebracht hatte, begrüsste und bestätigte Gott Ihn als Hohenpriester.
Der geistliche Zustand der Hebräer
Ab Vers 11 folgt wieder eine ermahnende Einschaltung. Erst in Hebräer 7 setzt der Schreiber das Thema des Hohenpriesters fort. Dieser Einschub hat drei Teile:
- Hebräer 5,11 – 6,3: Ermahnungen an echte Christen, die im Glaubensleben träge geworden sind.
- Hebräer 6,4-8: Warnungen an christliche Bekenner, die kein Leben aus Gott besitzen.
- Hebräer 6,9-20: Ermutigungen an wahre Glaubende, in den Schwierigkeiten auszuharren.
Bei den gläubigen Hebräern gab es ein Hindernis für ein gesundes geistliches Wachstum: Sie hielten an den religiösen Formen und Überlieferungen des Judentums fest. Doch das verdeckte ihnen die Sicht auf den verherrlichten Christus im Himmel, der die zentrale Person des christlichen Glaubens ist.
Obwohl sie schon eine Zeit lang an den Herrn Jesus glaubten, hatten sie noch «Milch» nötig, d.h. einfache Unterweisungen in den christlichen Basiswahrheiten. Die «feste Speise» spricht von den weiterführenden Belehrungen über Jesus Christus. Wer die volle Wahrheit seiner Person aufnehmen und verstehen kann, bekommt ein besseres Unterscheidungsvermögen im Alltag.
In den ersten drei Versen von Kapitel 6 fordert der Schreiber die Hebräer auf, sich nicht mit den Wahrheiten des jüdischen Glaubens zu begnügen, sondern sich nach der vollen Erkenntnis der göttlichen Wahrheit im Christentum auszustrecken.
Zum Schluss wollen wir uns persönlich fragen: Gibt es bei mir auch etwas, das mich hindert, im Glaubensleben Fortschritte zu machen?
Warnung und Ermutigung
Die Menschen, die sich damals dem christlichen Glauben zuwandten, erfuhren etwas vom äusseren Segen des Christentums.
- Sie lernten die Gnade kennen, die Gott durch die Gabe seines Sohnes den Menschen geschenkt hatte.
- Sie bemerkten das mächtige Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben.
- Sie kamen unter den positiven Einfluss des Wortes Gottes.
- Sie erlebten die Wunder, mit denen Gott am Anfang des Christentums die Verkündigung seines Wortes bestätigte.
Doch dieser äussere Segen bewirkte bei manchen Menschen keine echte Umkehr im Herzen. Darum fielen sie nach einer Zeit vom christlichen Glauben ab und kehrten zum Judentum zurück. Dadurch kreuzigten sie für sich selbst den Sohn Gottes.
Für solche Menschen gibt es keine Möglichkeit zur Buße mehr, weil sie das Angebot der Gnade Gottes in Jesus Christus willentlich ablehnen.
Ab Vers 9 hat der Schreiber wieder die wahren Glaubenden im Blickfeld. Von ihnen war er überzeugt, dass sie errettet waren. Gerade ihr Einsatz für andere Christen bewies, dass sie neues Leben besassen.
Die Liebesdienste an den Glaubenden bringen uns meistens keine sichtbaren Vorteile im Alltag. Trotzdem sind sie nicht vergebens, denn Gott wird sie in der Zukunft belohnen. Die Hoffnung auf die kommende Zeit spornt uns an, nicht träge zu werden, sondern in den Schwierigkeiten auszuharren. Dann sind wir Nachahmer der Glaubenden des Alten Testaments.
Ein zielgerichtetes Leben
Die Verheissung an Abraham beruhte auf einem Ausspruch Gottes und wurde durch einen göttlichen Eid bestätigt (1. Mose 22,16.17). Deshalb war sie absolut sicher und unwiderruflich. Der Patriarch stützte sich vertrauensvoll auf dieses göttliche Versprechen und wartete mit Ausharren auf die Erfüllung.
Genauso sicher wie die Verheissung an Abraham ist unsere Hoffnung als Christen. Es ist unmöglich, dass Gott lügen kann. Er wird sein Wort wahr machen und uns bestimmt ans himmlische Ziel bringen. Weil wir diesen starken Trost besitzen, ergreifen wir im Glauben die vor uns liegende Hoffnung und halten auf dem Weg durch die Wüste an ihr fest.
Die zweite Sicherheit bietet Jesus Christus selbst. Er befindet sich im Himmel in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. In Ihm ist unsere Hoffnung fest verankert. Wie dies zu verstehen ist, wird an einem Vorgang aus der damaligen Schifffahrt illustriert. Wenn ein grosses Segelschiff in die Nähe eines Hafens kam, liess man ein kleines Schiff, einen «Vorläufer», zu Wasser. Ein Tau verband es mit dem grossen Schiff. Der «Vorläufer» fuhr in den Hafen und wurde dort verankert. An diesem Ankertau zog sich schliesslich das grosse Schiff in den Hafen hinein.
So ist Jesus Christus als unser «Vorläufer» in den Himmel eingegangen und zieht nun alle, die Ihm angehören, ans Ziel. Und während der Reise dorthin setzt Er sich als himmlischer Hoherpriester für uns ein. Wie gut haben wir es doch dank unserer Glaubensbeziehung zu Ihm!
Melchisedek weist auf Christus hin
In diesem Kapitel ist es das Ziel des Schreibers, uns die Erhabenheit unseres Hohenpriesters zu zeigen:
- Die Verse 1-10 beschreiben die Würde seiner Person: Christus ist erhabener als Abraham.
- Die Verse 11-25 stellen die Würde seines Amtes vor: Christus übertrifft Aaron darin klar.
Wenn der Herr Jesus in unserem Abschnitt mit Melchisedek verglichen wird, so gilt es zu beachten, dass hier die neue Ordnung des Priestertums vorgestellt wird. Jesus Christus ist Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks. Jetzt übt Er jedoch seinen Dienst nach der Weise Aarons aus. Erst in der Zukunft wird Er den hohenpriesterlichen Dienst nach der Weise Melchisedeks verrichten.
Melchisedek war sowohl Priester als auch König (Hebräer 7,1-2). Genauso wird auch Christus im Tausendjährigen Reich als Priester und König auftreten.
Melchisedek wird als einer dargestellt, der weder Vater noch Mutter hatte (Vers 3), d.h. sein Priesterdienst wurde nicht von seinen Vorfahren abgeleitet. Vollkommen trifft das auf Christus zu, der als Auferstandener direkt von Gott das Amt des Hohenpriesters bekommen hat.
Melchisedek war erhabener als Abraham, denn er bekam von ihm den Zehnten. Ausserdem segnete er den Patriarchen, was ebenfalls seine höhere Würde klarmacht (Vers 7). Weil der Herr Jesus Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks ist, überragt Er sowohl Abraham als auch die aaronitischen Priester, die von diesem Patriarchen abstammten.
Ein erhabenes Priestertum
Die Geschichte Israels im Alten Testament macht klar, dass das levitische Priestertum nicht vollkommen war. Darum entstand das Bedürfnis nach einer neuen Priesterordnung, die durch Jesus Christus eingeführt worden ist.
Weil das Priestertum der Familie Aarons im Gesetz vom Sinai verankert war, hatte der Wechsel des Priestertums auch eine Änderung des Gesetzes zur Folge, und zwar aus zwei Gründen:
- Auf der Grundlage der göttlichen Anordnungen vom Sinai hätte der Herr Jesus nicht Hoherpriester werden können, denn Er stammte nicht aus der priesterlichen Familie, sondern aus dem Stamm Juda.
- Das Gesetz richtete sich an den natürlichen Menschen und verlangte von ihm, dass er Gott durch den aaronitischen Priesterdienst anbetete. Doch der Mensch, der kein Leben aus Gott besitzt, kann dieser Aufforderung nicht nachkommen.
Zusammenfassend können wir in diesem Abschnitt also zweierlei erkennen:
- Das levitische Priestertum wird durch Christus ersetzt, der Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist (Hebräer 7,11-17). Im Gegensatz zu Aaron und seinen Nachkommen besitzt Er göttliche Kraft, um seinen Dienst als Hoherpriester ewig und vollkommen zu verrichten.
- Das Gesetz wird im Blick auf das Priestertum durch eine bessere Hoffnung ersetzt, die uns fähig macht, Gott anzubeten (Hebräer 7,18-19). Wir besitzen neues Leben und den Heiligen Geist, durch den wir freimütig in die Gegenwart Gottes treten und den Vater von Herzen anbeten können.
Ein ewiges Priestertum
Der Herr Jesus wurde mit einem göttlichen Eidschwur als Hoherpriester bestätigt. Darum kann sein Priestertum weder aufgehoben noch beiseitegesetzt werden. Es bleibt ewig bestehen.
Das Priestertum Aarons wurde auf die Nachkommen übertragen, weil mit dem Tod der Dienst des jeweiligen Hohenpriesters zu Ende ging. Diese Ablösung gab dem aaronitischen Priesterdienst einen veränderlichen Charakter. Weil Jesus Christus ewig lebt, ist sein Dienst als Hoherpriester unveränderlich.
Nachdem in den Versen 1-24 die Erhabenheit des Herrn Jesus als Priester klar betont worden ist, zeigt uns Vers 25, welche Auswirkung diese Tatsache für uns hat: Er ist fähig, uns auf dem Glaubensweg in jeder Situation zu bewahren und als Anbeter vor Gott zu führen.
Weil Gott uns aus Gnade in eine hohe Stellung versetzt hat, geziemt uns nur der Herr Jesus als Hoherpriester:
- Zuerst wird seine Reinheit hervorgehoben. Er ist heilig, unschuldig und unbefleckt.
- Dann wird uns seine erhabene Position gezeigt: Er ist höher als die Himmel geworden.
- Weiter erkennen wir, wie Er als Priester ein vollkommenes Opfer dargebracht hat. Das geschah ein für alle Mal und muss nie wiederholt werden.
- Schliesslich wird seine Befähigung vorgestellt. Weil Er Sohn Gottes ist und einmal als Mensch hier gelebt hat, kann Er unser Hoherpriester sein.
Ein himmlisches Priestertum
Vers 1 beschreibt uns den Ort, an dem sich unser Hoherpriester heute befindet: Er ist im Himmel zur Rechten Gottes am Platz höchster Ehre und Macht. Dort ist Er ein Diener des himmlischen Heiligtums. Im Alten Testament war es die Aufgabe der Priester, die Tiere zu opfern, die die Israeliten Gott brachten. Heute ist es der Herr Jesus, der unsere Anbetung unterstützt. Wie tut Er das? Durch seine Anwesenheit in der Gegenwart Gottes zieht Er Gottes Gunst auf uns, so dass wir Ihn freimütig anbeten können. Durch Ihn, d.h. in der Annehmlichkeit von Jesus Christus, bringen wir Gott unsere Opfer des Lobes dar (Hebräer 13,15).
Vers 5 zeigt, dass die Hütte in der Wüste und der Opferdienst, der dort verrichtet wurde, ein Abbild oder Schatten der Wirklichkeit im Himmel ist. Vielleicht kann man sagen, dass Gott zuerst einen Plan für die himmlische Anbetung der Christen hatte. Doch zwischenzeitlich gab Er dem Volk Israel nach diesem Muster den israelitischen Gottesdienst als ein Abbild davon. Jetzt ist die Wirklichkeit gekommen und wir können Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Doch die Opfergaben, die im Alten Testament dargebracht wurden, lassen uns in ihrer geistlichen Bedeutung besser verstehen, was wahre Anbetung ist.
Die Begriffe «Bürge» (Hebräer 7,22) und «Mittler» (Vers 6) eines besseren Bundes weisen darauf hin, dass der Herr Jesus dafür einstehen wird, dass die Verpflichtungen des neuen Bundes eingehalten werden und die Segnungen somit garantiert sind. Die Grundlage dafür ist sein Erlösungswerk am Kreuz.
Der neue Bund und seine Segnungen
Zwei Bündnisse prägen die Geschichte des Volkes Israel:
- Der Bund vom Sinai verpflichtete die Israeliten, das Gesetz zu halten. Weil sie diesen Bund gebrochen hatten, wurde ein zweites Bündnis nötig (Vers 7).
- Der neue oder bessere Bund wird ebenfalls mit Israel geschlossen werden (Verse 8 und 10). Er gründet sich auf das Blut des Herrn Jesus und hat für dieses Volk keine Verpflichtung zur Folge, sondern nur Segen.
Der Schreiber stellt uns in den Versen 10-12 vier grosse Elemente des neuen Bundes vor. Warum tut er das? Weil wir Christen den Segen des neuen Bundes geistlich schon besitzen, ohne jedoch in denselben einzutreten.
- «Indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe.» Das Wort Gottes, das dann in die Herzen der Israeliten eingeschrieben sein wird, ist heute schon durch das neue Leben in uns lebendig.
- «Ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein.» Das wird für Israel erst im Tausendjährigen Reich Wirklichkeit werden. Doch wir besitzen bereits jetzt volle Gemeinschaft mit Gott.
- «Alle werden mich erkennen vom Kleinen bis zum Grossen.» In der Zukunft wird in Israel die Erkenntnis des Herrn gross sein (Jesaja 11,9). Als Christen kennen wir heute schon unseren Gott und den Herrn Jesus.
- «Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken.» Die Israeliten werden erst im Tausendjährigen Reich wissen, dass Gott ihnen die Sünden vergeben hat. Wir aber besitzen bereits jetzt volle Sündenvergebung (1. Johannes 2,12).
Das Heiligtum in der Wüste
Der Weg in die Gegenwart Gottes war durch die Sünden des Menschen verbaut und verunreinigt. Doch nun zeigt uns Kapitel 9, dass der Herr Jesus uns den Zugang zu Gott geöffnet hat. Was durch die Opfer im Alten Testament nicht möglich war, hat Christus durch seinen Tod bewirkt: Der Weg ins Heiligtum ist für die Glaubenden offen!
Die Verse 1-5 beschreiben das Zelt der Zusammenkunft in der Wüste. Es wird ein «weltliches Heiligtum» genannt, weil es den natürlichen Menschen durch die glanzvolle Ausstattung und die gottesdienstlichen Zeremonien beeindruckte.
Diese Hütte in der Wüste wurde durch einen Vorhang in zwei Räume geteilt. Der erste Raum war das «Heilige» und wird in Vers 6 auch die vordere Hütte genannt. Dort standen der Leuchter und der Tisch mit den Schaubroten. Diesen Raum durften die Priester jederzeit betreten, um dort ihren Dienst zu verrichten.
Hinter dem Vorhang war das «Allerheiligste». Dort befand sich die Bundeslade, die die Gegenwart Gottes repräsentierte. In diesen Raum durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr – am Sühnungstag – mit Blut hineingehen. Diese Einschränkung, die die Heiligkeit Gottes forderte, macht klar, dass zu jener Zeit der Zugang zu Gott für uns Menschen nicht offen war. Obwohl immer wieder Opfer dargebracht wurden, besassen die Priester kein vollkommenes Gewissen. So blieb ihr Gottesdienst eine Verrichtung von gesetzlichen Vorschriften, ohne dass sie die völlige Gewissheit besassen, von Gott angenommen zu sein.
Das Opfer des Herrn Jesus (1)
Mit dem Kommen von Christus hat sich alles geändert:
- Er ist der neue Hohepriester, wie wir in Hebräer 7 eindrücklich gesehen haben.
- Der Himmel ist die vollkommenere Hütte oder das wirkliche Heiligtum.
- Der Herr Jesus ist auch das wirksame Opfer, denn Er hat sich selbst am Kreuz hingegeben. Mit seinem eigenen Blut hat Er eine ewige, von Gott anerkannte Erlösung geschaffen.
Vers 13 macht klar, dass das Blut der Opfertiere zur Zeit des Alten Testaments nur eine äussere Reinigung bewirken konnte. Das Blut des Christus, d.h. sein Opfertod am Kreuz, bewirkt hingegen eine innere Reinigung – eine Reinigung des Gewissens (Vers 14). Der Herr Jesus hat sich selbst durch den ewigen Geist – das ist der Geist Gottes – ohne Flecken Gott geopfert. Es geht hier um den Aspekt des Brandopfers: Christus hat Gott durch seinen Tod in Bezug auf die Sünde vollkommen befriedigt. Sein Opfer ist vollgültig und Gott hat es angenommen. Das entlastet unser Gewissen für immer, so dass wir Gott freimütig anbeten können.
Durch seinen Tod ist Jesus Christus der Mittler des neuen Bundes geworden. Er hat die Juden, die an Ihn glaubten, von den Übertretungen unter dem alten Bund erlöst und in den Segen des neuen Bundes eingeführt.
Das neue Bündnis wird mit einem Testament verglichen, das für die Erben erst rechtskräftig wird, wenn die Person, die das Testament gemacht hat, gestorben ist. So musste auch Christus sterben, damit die Glaubenden den Segen des neuen Bundes bekommen.
Das Opfer des Herrn Jesus (2)
Die Verse 21-23 zeigen uns, wie der Herr Jesus durch sein eigenes Blut den Weg zu Gott gereinigt hat. Der Schreiber nimmt hier auf die Reinigung der Geräte und der Stiftshütte im Alten Testament Bezug. Damals wurde fast alles mit Blut von Opfertieren gereinigt. Doch für uns Christen gilt: Durch das vollkommene Opfer unseres Herrn ist der Weg in das himmlische Heiligtum, d.h. in die unmittelbare Gegenwart Gottes, eingeweiht worden.
In den Versen 25-27 wird der Herr Jesus mit dem Hohenpriester im Alten Testament verglichen, der alljährlich am grossen Sühnungstag mit Blut von Opfertieren in das Allerheiligste hineinging, um für das Volk Sühnung zu tun. Der Gegensatz ist gross:
- Christus ist nach vollbrachtem Erlösungswerk in den Himmel gegangen, um jetzt für uns vor Gott zu erscheinen.
- Kraft seines eigenen Blutes hält Er sich ewig in der Gegenwart Gottes auf. Dadurch bleibt uns der Zugang zu Gott für immer offen, so dass wir Ihm ewig unsere Anbetung bringen können.
- Er musste nur einmal am Kreuz leiden und sterben, denn durch seinen Tod hat Er die Grundlage zur Abschaffung der Sünde gelegt (Johannes 1,29).
Einst hatten wir alle den Tod und das ewige Gericht verdient. Doch Christus hat für uns alle, die wir an Ihn glauben, die Strafe unserer Sünden getragen, so dass wir Ihn jetzt freudig erwarten dürfen. Er wird ein zweites Mal kommen, um unsere Errettung zum Abschluss zu bringen.
Der Wille Gottes
Die Verse 1-4 bestätigen nochmals, dass die Opfer im jüdischen Gottesdienst die Anbeter niemals vollkommen machen konnten. Gerade die ununterbrochene Darbringung der Schlachtopfer beweist, dass sie keine Sünden wegnehmen konnten. Sie erinnerten vielmehr daran, dass die Sünden noch da waren. Gleichzeitig weisen sie in ihrer geistlichen Bedeutung auf das Opfer Christi hin.
Schon vor der Zeit hatte Gott den Wunsch, einmal Menschen in seiner Nähe zu haben, die Ihn anbeten würden. Darauf weist die «Rolle des Buches» hin, die die ewigen Ratschlüsse Gottes enthält. In dieser Buchrolle steht vom Herrn Jesus geschrieben, dass Er diese ewigen Pläne erfüllen wird.
Christus war dazu bereit, denn Er sprach: «Siehe, ich komme.» Er wurde freiwillig Mensch, indem Er sich einen Leib bereiten liess, um durch seinen Tod am Kreuz gehorsam den Willen Gottes auszuführen. Wie einzigartig ist sowohl seine Freiwilligkeit als auch sein Gehorsam!
Vers 9 ist eine Zusammenfassung des Hebräer-Briefs und erfüllte sich durch den Opfertod des Herrn Jesus: Der jüdische Gottesdienst (= das Erste) wurde auf die Seite getan, um der christlichen Anbetung (= das Zweite) Platz zu machen.
In Vers 10 werden uns die Auswirkungen des Werks am Kreuz vorgestellt: Es war der Wille Gottes, aus Sündern Anbeter zu machen. Dieser Wille wurde durch das vollgültige Opfer, das Jesus Christus ein für alle Mal gebracht hat, erfüllt. Auf dieser sicheren Grundlage sind wir nun für Gott geheiligt, um Ihn anzubeten.
Das vollkommene Erlösungswerk
Unsere Stellung als Anbeter vor Gott hat ihren Ursprung im Willen Gottes (Hebräer 10,5-10), gründet sich auf das Erlösungswerk des Herrn Jesus (Hebräer 10,11-14) und wird durch den Heiligen Geist bezeugt (Hebräer 10,15-18).
Die Verse 11 und 12 zeigen uns einen beeindruckenden Kontrast:
- Zur Zeit des Alten Testaments standen die Priester täglich da und brachten immer wieder Opfer, die keine Sünden wegnehmen konnten.
- Der Herr Jesus hingegen hat durch seinen Tod nur ein Opfer dargebracht, das uns von allen unseren Sünden reinigt. Nach vollbrachtem Werk hat Er sich für immer zur Rechten Gottes gesetzt.
Sein Erlösungswerk am Kreuz ist die Grundlage unserer ewigen Annahme bei Gott. Durch sein Opfer sind wir so vollkommen gemacht, dass wir in die heilige Gegenwart Gottes passen. Sein Sitzen zur Rechten Gottes gibt uns Sicherheit, dass unsere Erlösung vollgültig und ewig ist.
Der Heilige Geist benutzt das Wort Gottes, um uns diese Heilstatsachen zu bestätigen. Mit einem Zitat aus dem Alten Testament zeigt Er uns, dass wir volle Vergebung unserer Sünden besitzen (Vers 17). Er bezieht sich dabei auf den neuen Bund, den Gott mit Israel – nicht mit uns – eingehen wird. Doch den Segen der Sündenvergebung, der diesem Volk für die Zukunft verheissen ist, geniessen wir als glaubende Christen jetzt schon. Der Abschnitt schliesst mit einer Schlussfolgerung: Wenn Gott Vergebung zusichert, braucht es nie mehr ein Opfer für die Sünde (Vers 18).
Freimütige Anbeter
Die Verse 19-22 bilden im Blick auf uns einen Höhepunkt im Hebräer-Brief. Weil wir auf der Grundlage des Erlösungswerks von Jesus Christus in die Gegenwart Gottes passen, fordert uns der Schreiber auf, als Anbeter freimütig ins himmlische Heiligtum einzutreten. Wir dürfen dieses Vorrecht gemeinsam verwirklichen, wenn wir am Sonntag versammelt sind, um das Mahl des Herrn zu halten.
Der neue und lebendige Weg in die Gegenwart Gottes steht im Kontrast zum israelitischen Weg ins Heiligtum. Damals durften nur die Männer aus der priesterlichen Familie eintreten, heute können alle Erlösten des himmlischen Volkes als Anbeter zu Gott kommen. Dieser Weg wurde uns durch Jesus Christus geöffnet. Der Ausdruck «sein Fleisch» in Vers 20 weist darauf hin, dass Er als Mensch gestorben, auferstanden und in den Himmel eingegangen ist. Dadurch hat Er uns den Zugang in die Gegenwart Gottes aufgetan.
Vers 22 zeigt uns, wie wir als Anbeter das himmlische Heiligtum betreten:
- Wir kommen zu Gott «mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens». Unsere Herzen sind von der christlichen Wahrheit erfüllt und wir besitzen eine volle Kenntnis des vollbrachten Erlösungswerks.
- Wir kommen zu Gott im Bewusstsein, dass wir seiner Gegenwart entsprechen. Das besprengte Herz spricht von der Sühnung unserer Sünden durch das Blut des Herrn Jesus und der gewaschene Leib deutet die Neugeburt durch Wasser und Geist an (Johannes 3,5).
Warnung an blosse Bekenner
In den Versen 22-25 heisst es dreimal: «Lasst uns!» Es sind drei Aufforderungen, die wir als Christen gemeinsam beherzigen sollen:
- Lasst uns am Sonntag miteinander Gott anbeten (Vers 22). Dadurch ehren wir Ihn als sein Volk.
- Lasst uns trotz Widerstand von Seiten der Welt gemeinsam das christliche Bekenntnis festhalten (Vers 23). Das geht zusammen einfacher als allein.
- Lasst uns aufeinander Acht haben, indem wir aneinander denken und uns gegenseitig im Glauben stärken (Vers 24). Damit wir dies verwirklichen können, ist es nötig, dass wir die Zusammenkünfte der Glaubenden regelmässig besuchen.
Ab Vers 26 werden nochmals die Menschen mit jüdischer Herkunft angesprochen, die sich damals nur äusserlich zum christlichen Glauben bekannten, aber nun wegen der Verfolgungen im Begriff standen, zum Judentum zurückzukehren. Sie hatten das vollgültige Erlösungswerk des Herrn Jesus kennen gelernt, aber es nicht im Glauben für sich persönlich angenommen. Wenn sie nun willentlich dieses Opfer verwarfen und dem Christentum den Rücken kehrten, gab es für sie keine Möglichkeit zur Rettung mehr. Sie hatten nur noch das göttliche Gericht zu erwarten.
Die Verse 29 und 30 machen deutlich, dass es schlimmer ist, die Gnade in Jesus Christus zu verachten, als das Gesetz Moses zu verwerfen. Man lehnt in diesem Fall ein dreifaches Zeugnis der Gnade ab: den Sohn Gottes, sein Erlösungswerk und das Wirken des Heiligen Geistes.
Ermutigung an echte Gläubige
Nach der Warnung an die unechten christlichen Bekenner in den Versen 26-31 folgt jetzt eine Ermutigung an die gläubigen Hebräer.
Zur Stärkung ihres Glaubens wird zuerst das Gute in ihrem bisherigen Leben anerkannt (Hebräer 10,32-34). Sie hatten in zweierlei Hinsicht viel für den christlichen Glauben gelitten:
- Zum einen hatten sie persönlich die Schmähungen der Ungläubigen erduldet und den Verlust ihres materiellen Besitzes freudig ertragen.
- Zum anderen hatten sie sich zu Glaubenden gestellt, die besonders bedrängt worden waren. Sie hatten sich nicht geschämt, eingesperrte Christen zu besuchen und ihnen in ihrer Notlage beizustehen.
Sind wir auch bereit, so konsequent dem Herrn Jesus nachzufolgen und den Spott unserer Mitmenschen auf uns zu nehmen?
Ab Vers 35 werden wir angespornt, mit Zuversicht und Ausdauer den Glaubensweg bis zum Ziel weiterzugehen. Es geht bestimmt nicht mehr lang, bis wir im Himmel sind, denn der Herr Jesus wird bald wiederkommen (Vers 37).
In der Wartezeit bis zu seinem Kommen leben wir im Glauben (Vers 38). Von unserer herrlichen Zukunft sehen wir noch nichts, aber wir vertrauen Gott, dass Er sein Wort auch diesbezüglich wahr machen wird.
In Vers 39 zeigt der Schreiber, was die Erlösten von den Menschen unterscheidet, die nur ein christliches Bekenntnis haben: Weil sie errettet sind, ziehen sie sich vom christlichen Glauben nicht zurück, sondern erreichen mit Sicherheit das himmlische Ziel.
Abel, Henoch, Noah
Dieses Kapitel beschreibt uns anhand vieler Beispiele aus dem Alten Testament die positiven Wirkungen, die der Glaube im Leben hervorbringen kann. Deshalb beginnen viele Verse mit den Worten «durch Glauben».
Die Verse 1 und 2 leiten dieses Thema mit einer grundsätzlichen Aussage ein: Sowohl das Zukünftige wie das Unsichtbare ist für den Glaubenden eine Realität und hat deshalb einen Einfluss auf sein Leben.
In den Versen 3-7 werden uns vier Glaubenstatsachen vorgestellt, die eine Auswirkung auf unseren Alltag haben:
- Wir glauben, dass Gott durch sein Wort die Welten gemacht hat (Psalm 33,6.9). Beeindruckt von seiner Allmacht vertrauen wir darauf, dass Er sein Wort erfüllt.
- Wie Abel glauben wir, dass Gott uns angenommen hat, weil jemand anderes für uns gestorben ist. Wir wissen, dass Gott uns auf der Grundlage des Erlösungswerks von Jesus Christus gerecht gesprochen hat. Darum besitzen wir Heilssicherheit.
- Wie Henoch glauben wir an Gott und führen deshalb ein Leben, das Ihm Freude macht. Weil wir in Einklang mit Ihm leben, geniessen wir auf der Erde seine Gemeinschaft, bis der Herr Jesus zur Entrückung wiederkommt.
- Wie Noah glauben wir, dass Gott die Welt richten wird. Weil wir bei Jesus Christus vor der zukünftigen Strafe Zuflucht genommen haben, leben wir getrennt von der ungläubigen Gesellschaft, die nichts von Ihm wissen will. Durch unser Verhalten verurteilen wir die Welt.
Abraham und Sara
Die Verse 8-22 stellen uns das Ausharren des Glaubens am Beispiel der Patriarchen vor.
Abraham wird von Gott berufen, sein Land zu verlassen und nach Kanaan zu ziehen. Wie reagiert er darauf? Er gehorcht und macht sich auf die Reise. Als er in Kanaan ankommt, hört sein Glaube nicht auf, tätig zu sein. Weil er dieses Land nicht zum Besitztum bekommt, setzt er seine Hoffnung auf die himmlische Stadt. Er weiss, dass er dort in der Zukunft eine feste Heimat bekommen wird. Darum lebt er auf der Erde viele Jahre als Fremder in Zelten. – So sind Gehorsam und die Verwirklichung, dass wir auf der Erde Fremde sind, zwei weitere Merkmale unseres Glaubenslebens.
Auch Sara gibt uns eine Lektion für praktischen Glauben. Gott hat ihr einen Sohn verheissen. Doch eine lange Zeit vergeht – bis Abraham und Sara zu alt sind, um Kinder zu bekommen. Trotz dieser Unmöglichkeit hält Sara durch Glauben am göttlichen Versprechen fest. Sie wird nicht enttäuscht, sondern bringt im Alter den verheissenen Sohn zur Welt. – Halten wir auch in jeder Situation an der Treue Gottes fest, der sein Wort mit Sicherheit erfüllen wird?
Die Patriarchen haben im Glauben gelebt und sind im Glauben gestorben. Ihre Hoffnung auf das himmlische Vaterland machte sie zu Fremden im Land Kanaan. – Genauso möchte Gott uns innerlich mit der himmlischen Heimat verbinden, damit wir mit dieser Hoffnung im Herzen als Fremde hier leben. Durch unser Verhalten können wir zeigen, dass wir nur vorübergehend auf der Erde sind und unser ewiges Zuhause im Himmel ist.
Abraham, Isaak, Jakob, Joseph
In diesem Abschnitt werden alle vier Patriarchen erwähnt. Jeder von ihnen zeigt eine Eigenschaft des Glaubens und darüber hinaus eine Herrlichkeit des Herrn Jesus.
Im Vertrauen auf Gott opfert Abraham seinen Sohn und empfängt ihn im Bild durch Auferstehung wieder. Das spricht davon, wie Jesus Christus auf seine Rechte als Messias verzichtet hat und gestorben ist. Doch nach seiner Auferstehung ist Er als Sohn des Menschen der Erbe von Himmel und Erde.
In seinen letzten Worten an Jakob und Esau unterscheidet Isaak im Glauben zwischen dem gläubigen und dem ungläubigen Sohn. Der Segen über Jakob stellt die schrankenlose Gnade für die Glaubenden dar. Der Ausspruch über Esau spricht vom Gericht über die Gottlosen. So ist der Herr Jesus sowohl Retter als auch Richter.
Jakob segnet beide Söhne Josephs. Doch im Glauben an die Gnade Gottes zieht er den Jüngeren (Ephraim) dem Älteren (Manasse) vor. Der Ältere ist ein Bild von Israel, dem irdischen Volk Gottes. Im Jüngeren können wir die Versammlung sehen. Sie ist das himmlische Volk Gottes, das einen höheren Segen als Israel besitzt. Christus ist jetzt das Haupt der Versammlung und in der Zukunft der König Israels.
Joseph glaubt, dass Israel aus Ägypten ausziehen und in Kanaan einziehen wird. Darum befiehlt er dem Volk, seine sterblichen Überreste mitzunehmen. Es ist der Glaube an die zukünftige Wiederherstellung Israels und die damit verbundene Herrschaft von Jesus Christus.
Mose und das Volk Israel
Dieser Abschnitt beschreibt die Energie des Glaubens, die sich trotz Widerstand und Hindernissen entfaltet.
Durch Glauben halten die Eltern von Mose dem Druck der Welt stand. Weil sie sehen, dass ihr Kind schön für Gott ist, entziehen sie es so lang wie möglich dem Einfluss der Welt. Gott belohnt ihren Glauben, indem Er Mose danach viele Jahre in der Welt bewahrt.
Durch Glauben trifft Mose im Alter von 40 Jahren eine Entscheidung für das Volk Gottes. Er sagt «Nein» zu einem sündigen Leben in der Welt und stellt sich klar auf die Seite Israels, obwohl es verachtet und unterdrückt wird. Ziehen wir auch die Schmach des Christus den Schätzen der Welt vor?
Mose schlägt nicht nur die Gunst der Welt aus, sondern bleibt auch gegenüber der Feindschaft der Welt standhaft (Vers 27). Der Glaubensblick auf den unsichtbaren Gott gibt ihm die Kraft dazu.
Ab Vers 28 werden vier Ereignisse in der Geschichte Israels behandelt:
- Das Passah stellt den rettenden Glauben vor dem göttlichen Gericht vor.
- Das Rote Meer spricht vom Glauben, der uns durch die Einsmachung mit dem Tod des Herrn Jesus von der Sünde, der Welt und dem Teufel befreit.
- Der Sieg über Jericho zeigt den Glauben, wie er die Hindernisse überwindet, die uns die Freude am himmlischen Segen wegnehmen wollen.
- Der lebensgefährliche Einsatz von Rahab für die Kundschafter veranschaulicht uns, wie der Glaube an Gott ein Handeln zugunsten seines Volkes hervorruft.
Richter, Propheten, Gläubige
Dieses Kapitel endet mit der Aufzählung von Glaubensmännern und Glaubenstaten. In Vers 32 steht die Energie des Glaubens im Dienst für den Herrn im Vordergrund:
- Gideon stellt den Gehorsam vor, der in jeder Aufgabe von zentraler Bedeutung ist.
- Simson, der Nasir, zeigt, dass Verzicht auf irdische Freuden und Hingabe an Gott Voraussetzungen für jeden Dienst sind.
- Das Leben von David macht klar: Im Werk des Herrn muss der Widerstand der religiösen Welt (dargestellt durch Saul) überwunden werden.
- Das Beispiel von Samuel belehrt uns, wie wichtig das Gebet in jedem Dienst für den Herrn ist.
Die Glaubenstaten ab Vers 33 lassen sich gut in zwei Gruppen einteilen:
- Die Kraft des Glaubens überwindet die Widerstände und vollbringt mächtige Taten (Verse 33 bis 35a).
- Die Ausdauer des Glaubens überwindet die Versuchungen und bleibt bis zum Tod treu (Verse 35b bis 38).
Das Leben dieser Glaubenshelden im Alten Testament war ein Zeugnis von ihrem Glauben an den lebendigen Gott. In ihrem Leben wurde klar ersichtlich, dass sie eine Beziehung zu Ihm besassen.
Gott hat für uns, die wir in der Zeit der Gnade leben, etwas Besseres vorgesehen. Wir besitzen jetzt schon in Jesus Christus den ganzen christlichen Segen. Doch wir sind wie die Glaubenden des Alten Testaments noch nicht vollkommen gemacht. Das wird erst in der Zukunft für beide der Fall sein.
Der Blick zu Jesus Christus
Nun werden wir aufgefordert, den Glaubenslauf mit Ausharren weiterzulaufen. Lassen wir uns weder durch unnötige Lasten noch durch Versuchungen zur Sünde davon abhalten!
Der Glaubensblick auf Jesus Christus zur Rechten Gottes gibt uns Kraft, Ihm entschieden nachzufolgen. Wenn Er als «Anfänger und Vollender des Glaubens» das himmlische Ziel erreicht hat, werden auch wir bald dort ankommen.
In Vers 3 wird unser Blick auf das Leben des Herrn Jesus gelenkt, das Er einst zu unserem Beispiel auf der Erde geführt hat. Keiner musste so grossen Widerstand erdulden wie Er. Trotzdem gab Er nicht auf. Darum wollen auch wir auf dem Weg zum himmlischen Ziel nicht mutlos werden, sondern mit der Hilfe des Herrn weitergehen.
Die Verse 4-11 behandeln das Thema der Erziehung Gottes. Er benutzt die Schwierigkeiten des Lebens, um unsere Einstellung und unser Verhalten mehr in Übereinstimmung mit sich zu bringen (Vers 10). In solchen Erprobungen stehen wir in Gefahr, entweder die göttliche Erziehung nicht ernst zu nehmen oder in der Prüfung zu resignieren. Das Bewahrungsmittel für beides ist die Aussage von Vers 6: Weil Gott uns liebt, erzieht Er uns! Niemals wird Er uns auf einem falschen Weg laufen lassen oder uns über Vermögen prüfen.
Die göttliche Erziehung gibt nie Anlass zur Freude. Doch sie bewirkt ein Resultat: Je mehr wir praktisch mit Gott übereinstimmen, desto tiefer ist der Friede, den wir in seiner Gegenwart geniessen.
Gegenseitige Hilfe
In den Schwierigkeiten auf dem Glaubensweg
- gibt uns Jesus Christus im Himmel Kraft zum Ausharren (Hebräer 12,1-3);
- erzieht uns der himmlische Vater, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden (Hebräer 12,4-11);
- helfen wir uns gegenseitig, indem wir uns im Glauben und in der Gnade stärken (Hebräer 12,12-17).
Die Verse 12 und 13 begegnen zwei Gefahren. Einerseits können wir innerlich ermatten: Die Hände falten sich nicht mehr und die Knie beugen sich nicht mehr zum Beten. Dann soll einer den anderen zu einer lebendigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus im Gebet ermutigen. Anderseits ist es möglich vom rechten Weg abzukommen. In diesem Fall wollen wir uns gegenseitig zu einer Nachfolge anspornen.
Im gemeinschaftlichen Leben der Glaubenden gilt es, dem Frieden nachzujagen, ohne der Heiligkeit Gottes Abbruch zu tun. Der Herr kann uns diese Ausgewogenheit schenken.
Wer die Gnade Gottes aus den Augen verliert (Vers 15), wird entweder hart oder mutlos. Darum wollen wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir alles in unserem Leben der göttlichen Gnade verdanken. Sie steht uns täglich in uneingeschränktem Mass zur Verfügung.
Ein Hurer ist im übertragenen Sinn ein Christ, der sich mit der Welt verbindet. Ein Ungöttlicher schliesst Gott aus seinem Leben aus und verachtet seine Gaben. Durch eine Rückkehr zum Judentum hätten sich die Hebräer mit der Welt, die den Herrn gekreuzigt hatte, vereint und den christlichen Segen verschmäht.
Der Berg der Gnade
Als solche, die an den Herrn Jesus glauben, sind wir nicht zum Berg Sinai gekommen. Dort hatte sich Gott einst in Macht und Heiligkeit offenbart und dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Doch die Demonstration seiner Heiligkeit versetzte die Menschen in Furcht und hielt sie auf Distanz zu Ihm.
Als glaubende Christen sind wir zum Berg Zion gekommen. Es ist der Berg der Gnade. Unsere Beziehung zu Gott ist durch die Gnade geknüpft worden. Seither hängt alles – das Leben hier und die Zukunft im Himmel – von der unermesslichen Gnade Gottes ab.
Die weiteren Ausdrücke ab Vers 22 beschreiben unsere himmlischen Vorrechte, die sich auf die Gnade gründen und im Tausendjährigen Reich Wirklichkeit werden. Der Schreiber will damit unsere Gedanken in die himmlische Zukunft lenken:
- Wir werden ins himmlische Jerusalem eingehen, die die Hauptstadt des Reichs im Himmel sein wird.
- Wir werden dort Myriaden von Engeln begegnen.
- Wir werden zur Versammlung der Erstgeborenen kommen. Das sind die Erlösten der Zeit der Gnade.
- Wir werden zu Gott, dem Richter aller Menschen, gebracht werden und ohne Furcht bei Ihm sein.
- Wir werden in der himmlischen Stadt die vollendeten Gerechten, d.h. die Glaubenden des Alten Testaments, antreffen.
- Wir werden zu Jesus Christus kommen, der im himmlischen Jerusalem der Mittelpunkt sein wird.
- Wir werden dort den Wert seines Blutes, das von Gnade spricht, beständig vor Augen haben.
Ein unerschütterliches Reich
In Vers 25 wird das Christentum nochmals mit dem Judentum verglichen:
- Mose richtete auf der Erde göttliche Aussprüche an das irdische Volk Gottes. Die Israeliten, die dieses Wort ablehnten, wurden bestraft.
- Christus spricht in der christlichen Zeit vom Himmel her durch seinen Geist. Wer diese Botschaft verwirft, indem er dem christlichen Glauben den Rücken kehrt, hat genauso das göttliche Gericht zu erwarten.
Die Verse 26 und 27 machen klar, dass alles, was mit der ersten Schöpfung in Verbindung steht, irgendwann erschüttert werden wird. Das betrifft auch das Judentum. Es wird einmal ein Ende finden.
Aber die Vorrechte der glaubenden Christen bleiben ewig. Sie empfangen ein unerschütterliches Reich. Darum werden sie im ewigen Zustand ihre Vorzugsstellung beibehalten (Offenbarung 21,2).
An diese herrliche Aussicht werden in Vers 28 drei Ermahnungen geknüpft:
- Lasst uns täglich und überall in der Gnade leben, die uns errettet hat.
- Auf dem Weg zum Ziel haben wir den Auftrag, Gott die Ihm gebührende Anbetung zu bringen.
- Unsere Einstellung und unser Verhalten sollen durch echte Gottesfurcht und Ehrfurcht vor Gott geprägt sein.
Vergessen wir im Alltag nie: Unser Gott ist heilig und übt ein gerechtes Gericht über das Böse aus.
Ermunterung und Ermahnung
Obwohl uns auf dem Weg des Glaubens Schwierigkeiten begegnen, soll die praktische Bruderliebe nicht aufhören. Sie kann sich auf zweierlei Art zeigen:
- Wir laden unsere Mitchristen ein und pflegen Gemeinschaft mit ihnen. Diese Aufgabe fordert oft einen grossen Einsatz. Aber Gott wird ihn belohnen.
- Wir kümmern uns um kranke und alte Glaubensgeschwister und unterstützen sie in ihrem Leben. Für diesen Dienst ist echtes Mitgefühl und Weisheit nötig.
Auf dem Weg zum himmlischen Ziel lauern zwei Gefahren, die in der Bibel mehrmals zusammen erwähnt werden: sexuelle Verfehlungen und Habsucht (Epheser 5,3; Kolosser 3,5). Wir können vor beiden Sünden bewahrt werden, wenn wir jeglichen Geschlechtsverkehr vor und ausserhalb der Ehe konsequent verurteilen und wenn wir uns mit dem begnügen, was der Herr uns an materiellem Besitz schenkt. – Gott ermahnt uns nicht nur, Er ermutigt uns auch durch sein Wort:
- Er versichert uns seine Hilfe: «Ich will dich nicht versäumen.»
- Er verspricht uns seine Gegenwart: «Ich will dich nicht verlassen.»
Diese göttlichen Zusagen lassen uns kühn auf den Herrn vertrauen. Wenn Er unser Helfer ist, brauchen wir uns vor möglichen Anfeindungen durch Menschen nicht zu fürchten.
Die in Vers 7 erwähnten Führer haben uns das Wort Gottes erklärt und ihre Laufbahn als Christen gut beendet. Nun sollen wir ihren Glauben nachahmen.
Ausserhalb des Lagers
Jesus Christus verändert sich nie. Er bleibt ewig derselbe. Was Er gestern für uns war, wird Er sowohl heute als auch morgen für uns sein. Weil wir in seiner Person alles besitzen, was wir als Glaubende nötig haben, sollen wir alle fremden Lehren ablehnen und täglich von seiner Gnade leben.
Der Altar Gottes als einzige Grundlage der Gemeinschaft mit Ihm gehört jetzt den Christen (Vers 10). Wer am jüdischen Glauben festhielt, hatte kein Anrecht daran. Darum wurden die Christen mit jüdischer Herkunft aufgefordert, aus dem israelitischen Lager zu Jesus Christus hinauszugehen (Vers 13) und dort durch Ihn Gott anzubeten (Vers 15). Der Schreiber begründet diesen wichtigen Schritt in den Versen 11 und 12:
- Zuerst erinnert er an die Opfer am grossen Sühnungstag. Das Blut dieser Opfertiere wurde ins Innere des Heiligtums getragen und ihre Leiber ausserhalb des Lagers verbrannt.
- Dann spricht er von der Erfüllung dieser Opfer. Jesus Christus, dessen Blut in der Gegenwart Gottes für uns spricht (Hebräer 9,12), hat ausserhalb Jerusalems gelitten.
Die Konsequenz ist für uns klar: Aufgrund seines Werks ist es uns möglich, freimütig in den Himmel einzutreten (Hebräer 10,19). Demzufolge gehen wir auf der Erde zu Jesus Christus hinaus und tragen ausserhalb des religiösen Lagers gemeinsam seine Schmach. An diesem Platz bringen wir Gott sowohl ein Opfer des Lobes (Vers 15) als auch das materielle Opfer (Vers 16). Er freut sich an beidem.
Der Gott des Friedens
Im Gegensatz zu Vers 7 handelt es sich in Vers 17 um geistliche Führer, die noch leben. Wir sollen ihnen bereitwillig gehorchen, damit sie ihren Dienst mit Freude tun können.
Weil der Schreiber des Hebräer-Briefs ein gutes Gewissen hat und ein ehrbares Leben zu führen wünscht, kann er die Briefempfänger freimütig um ihre Gebetsunterstützung bitten. Er nennt ihnen ein konkretes Anliegen: Sie sollen für seine Freilassung beten, damit er den Glaubenden besser dienen kann.
In den Versen 20 und 21 betet der Schreiber für die Hebräer. Er bittet den Gott des Friedens, der Leben aus dem Tod hervorbringen kann, dass Er in uns Glaubenden eine vielfältige Frucht bewirke:
- Ausharren in jedem guten Werk,
- Gehorsam im Vollbringen des göttlichen Willens und
- praktische Übereinstimmung mit Gott, damit alles zu seiner Freude geschieht.
Diese Frucht kann nur in einer lebendigen Glaubensbeziehung zu Jesus Christus entstehen und hat nur ein Ziel: die Verherrlichung Gottes.
Dieser Brief enthält neben vielen Aussagen über den Herrn Jesus auch manche Ermahnung für uns. Nehmen wir sie zu Herzen, damit wir auf dem Glaubensweg bewahrt bleiben!
In den Versen 24 und 25 kommt das Wort «alle» dreimal vor. Der Schreiber hat ein Hirtenherz und denkt an alle Glaubenden. Er weiss, dass sie alle zur Herde Gottes gehören und die Gnade jeden Tag brauchen.
Einleitung
Haggai diente zeitgleich mit Sacharja. Gott sandte ihn zu seinem Volk, nachdem die Juden aufgrund des Widerstands die Arbeit am Bau des Tempels eingestellt hatten. Seine Botschaft bewirkte, dass sie die Bautätigkeit wieder aufnahmen.
Haggai 1,1-15:
Tadel wegen Selbstsucht und Aufruf zum Bauen
Haggai 2,1-9:
Ermutigung zum Weiterbau des Tempels
Haggai 2,10-19:
Tadel wegen mangelnder Heiligkeit
Haggai 2,20-23:
Ermutigung durch den Blick in die Zukunft
Buchtipp: Ich habe euch geliebt!
Gott fordert zum Tempelbau auf
Der Prophet Haggai übte seinen Dienst unter den Juden aus, die mit Serubbabel aus dem babylonischen Exil nach Jerusalem zurückgekehrt waren. Dieser Überrest hatte zuerst den Altar Gottes an seiner Stätte wieder aufgerichtet und dann mit dem Wiederaufbau des Tempels des Herrn begonnen. Durch Feindschaft und Widerstand von aussen kam diese Arbeit zum Erliegen.
Nun richtete sich der Prophet Haggai mit einem Wort des Herrn der Heerscharen an das Volk und seine Führerschaft. Gott, der Herzenskenner, hatte gesehen, dass die innere Energie für die Arbeit am Haus Gottes nachgelassen hatte. Stattdessen verfolgten die Juden ihre persönlichen Interessen und bauten ihre eigenen Häuser. Der äussere Widerstand diente ihnen als Vorwand für ihr Verhalten (Vers 2). Das Aufgeben des Tempelbaus hatte jedoch Konsequenzen nach sich gezogen. Gott hatte seinen Segen zurückgezogen. Ja, Er musste sie sogar mit einer Dürre züchtigen, so dass sie Mangel litten.
Der Herr hielt den Juden nicht nur ihr Fehlverhalten vor. Er erinnerte sie nicht nur an die bitteren Folgen ihres selbstsüchtigen Verhaltens. Er zeigte ihnen auch den Weg zurück (Haggai 1,7.8). Mit Herzensentschluss und neuer Energie sollten sie sich wieder für den Bau seines Hauses einsetzen. Ist das nicht eine grosse Gnade? Wenn wir den Herrn verlassen und eigene Wege eingeschlagen haben, müssen wir zwar die Folgen davon tragen. Aber wir brauchen nicht zu verzweifeln. Auch für uns gibt es einen Weg zurück (1. Johannes 1,9).
Das Volk nimmt die Ermahnung an
Die Worte des Herrn und die Botschaft des Propheten verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Führer und das Volk hörten nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen auf Gott. Sie waren bereit, zu gehorchen und den in Vers 8 aufgezeigten Weg einzuschlagen.
Am Schluss von Vers 12 heisst es: «Das Volk fürchtete sich vor dem Herrn.» Das war nicht Angst vor einem zürnenden Gott, denn sie hatten ja auf sein Wort gehört und wollten auch gehorchen. Gottesfurcht meint hier ein ehrfürchtiges Vertrauen zu Ihm, das gleichzeitig mit dem Verurteilen des verkehrten Verhaltens verbunden ist. Als Kinder Gottes haben wir keine Angst vor Gott – Er ist ja unser Vater, der uns liebt. Aber wir fürchten uns vor uns selbst, dass wir etwas tun, was Ihn traurig macht.
Auf dieses gottesfürchtige Vertrauen antwortete der Herr umgehend. Er sprach ihnen Mut zu, indem Er ihnen verhiess: «Ich bin mit euch.» Das muss für den Überrest eine grosse Ermunterung gewesen sein. Sie kannten ja ihre Schwachheit. Doch gerade ihnen versprach der Herr seine Gegenwart. Das bedeutete Schutz und Sicherheit für sie. – Der Herr Jesus will auch uns in jeder Lage beistehen (Matthäus 28,20).
Am Anfang von Vers 14 wird uns das Wirken Gottes am inneren Menschen mit den Worten gezeigt: «Der Herr erweckte den Geist Serubbabels …, den Geist Josuas … und den Geist des ganzen Überrests des Volkes.» Als Folge davon nahmen die Juden ungefähr drei Wochen nach dem Auftreten des Propheten Haggai den Bau des Hauses Gottes wieder in Angriff.
Gott ermutigt die Bauenden
Einige Wochen nach der Wiederaufnahme der Arbeit am Haus Gottes sandte der Herr den Propheten Haggai mit einer neuen Botschaft zum Volk und seinen Führern. Er sah die Gefahr der Entmutigung bei den Bauenden. Deshalb hatte Er ein aufmunterndes Wort an sie.
Nicht nur die Bauenden, auch Gott sah, wie viel kleiner dieser Tempel im Vergleich zum salomonischen war. Er sah die Schwachheit des Überrests, gleichzeitig freute Er sich an ihrer Entschiedenheit und ihrem Einsatz. Deshalb bekannte der Herr sich zu ihnen und versprach: «Ich bin mit euch» (Vers 4; Haggai 1,13). Zudem wies der Herr sie auf die unversiegbaren und immer gleich bleibenden Hilfsquellen hin: sein ewig gültiges Wort und seinen Geist in ihrer Mitte.
Diese Hilfen stehen auch uns zur Verfügung, wenn wir durch unser Zusammenkommen im Namen des Herrn das geistliche Haus Gottes, die Versammlung, zu verwirklichen suchen. Wir möchten uns in allem auf die Anweisungen des Wortes Gottes stützen und uns unter die Leitung des Heiligen Geistes stellen, der bis heute in der Versammlung wohnt (1. Korinther 3,16).
Weil die materiellen Ressourcen des Überrests gering waren, sagt der Herr: «Mein ist das Silber und mein das Gold.» Dann lenkt Er den Blick der Bauenden in die Zukunft. Wenn das «Ersehnte aller Nationen» kommen wird – es ist Christus bei seinem machtvollen und herrlichen Erscheinen auf der Erde –, wird Gott selbst sein Haus wieder mit Herrlichkeit füllen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses (im Tausendjährigen Reich) wird grösser sein als die erste (zur Zeit Salomos).
Gott ermahnt zur Heiligkeit
Am 24. Tag des neunten Monats bekam der Prophet erneut einen Auftrag von Gott. Er sollte den Priestern zwei Fragen über das Gesetz vorlegen. Erstens: Wenn ich heiliges Fleisch im Zipfel meines Kleides trage, wird dann irgendeine Speise, die ich mit diesem Gewand berühre, heilig? Antwort: Nein. Zweitens: Wenn eine Person, die wegen einer Leiche unrein ist, die oben genannten Speisen berührt, werden sie unrein werden? Antwort: Ja, sie werden unrein werden.
Die beiden Fragen betrafen die Menschen des zurückgekehrten Überrests. Doch sie gelten sinngemäss auch für uns. Das Kleid redet von unserem Bekenntnis oder von dem, was man von aussen an uns sieht. Eine äussere Frömmigkeit genügt nicht. Gott wünscht von uns praktische Reinheit des Herzens. Beim zweiten Punkt geht es um unsere Verbindungen. Jeder Kontakt mit etwas, was in Gottes Augen sündig ist, verunreinigt uns. Das ist auch dann der Fall, wenn wir mit Menschen – ob gläubig oder ungläubig – Gemeinschaft pflegen, die Verkehrtes in ihrem Leben dulden oder im Widerspruch zur Bibel leben. Wir werden dadurch verunreinigt (2. Korinther 6,14-17; 2. Timotheus 2,19-21).
Mit diesen zwei Fragen deckte Gott den schlechten geistlichen Zustand des Volkes auf (Vers 14). Deshalb hatte Er sie züchtigen müssen. Doch nun rief Er alle auf, ihre Herzen zu reinigen, wie David es einst getan hatte (Psalm 51,12). Dann wollte Gott seinen Segen nicht mehr zurückhalten (Vers 19). Bis heute ist Er ein segnender Gott, wenn wir bereit sind, bis zu Ihm umzukehren.
Gott richtet den Blick in die Zukunft
Am gleichen Tag, an dem der Prophet den Priestern die zwei wichtigen Fragen vorlegen musste, bekam er noch eine Botschaft von Gott. Diese richtete sich ganz persönlich an den Statthalter Serubbabel. Gott schenkte ihm einen Blick in die Zukunft.
Die Juden lebten damals unter Fremdherrschaft. Es war die Zeit, in der Gott die Regierung der Erde den Nationen übergeben hatte. Diese Zeit dauert heute immer noch an. Doch der Tag kommt, da Gott diese Regierung durch Gericht beenden wird.
«An jenem Tag» wird der Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit erscheinen und die Regierung über die Welt, ja, die Herrschaft über das Weltall antreten. Serubbabel, ein Nachkomme Davids, ist hier ein schwaches Bild von Christus, dem wahren Sohn Davids. Der Herr nennt ihn hier «meinen Knecht». Der wahre Knecht des Herrn ist der Herr Jesus als Mensch (Matthäus 12,18). Der Siegelring spricht von Macht und Autorität (1. Mose 41,42), ein Hinweis auf Den, der einmal als Herr der Herren und König der Könige anerkannt werden wird (Offenbarung 19,16).
Die letzte Botschaft Haggais an Serubbabel hat auch eine praktische Seite. Es sind Mut machende Worte, die zeigen, wie der Herr Treue und Einsatz im Dienst für Ihn belohnt. Serubbabel hatte in einer schweren Zeit eine grosse Aufgabe erfüllt. Dafür ehrte ihn Gott.
Doch der Prophet endet nicht mit dem Lohn für erwiesene Treue, sondern mit der Gnade Gottes, die diesen Mann erwählt hatte. Sie hat auch uns erwählt, um Kinder und Söhne Gottes zu sein (Epheser 1,4-6).
Einleitung
Sacharja lebte und wirkte zur gleichen Zeit wie der Prophet Haggai. Während Haggai vor allem über den Bau des Tempels sprach, beschäftigte sich Sacharja mehr mit der Stadt Jerusalem. Sacharja machte auch ausführliche Mitteilungen über zukünftige Ereignisse:
- Der Messias kommt das erste Mal zum Volk Israel und wird abgelehnt. Er ist der Hirte, der von Gott geschlagen wird.
- Der Herr Jesus kommt ein zweites Mal zu seinem Volk und wird von bußbereiten Gläubigen als Messias angenommen.
- Er richtet sein Reich auf und regiert über die ganze Erde. Die Nationen anerkennen seine Herrschaft.
Kapitel 1 – 6
Einleitung und acht Nachtgesichte
Kapitel 7 – 8
Anfrage wegen der Fastentage
Kapitel 9 – 11
Erster Ausspruch über den Messias
Kapitel 12 – 14
Zweiter Ausspruch über den Messias
Aufruf zur Buße und Umkehr
Der Prophet Sacharja weissagte in der nachexilischen Zeit, d.h. nachdem ein Teil der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft in das Land Israel und nach Jerusalem zurückgekehrt war. Sacharja wird auch in den Büchern Esra und Nehemia erwähnt (Esra 5,1; 6,14; Nehemia 12,16). Aus der Nehemia-Stelle kann man schliessen, dass er nicht nur Prophet, sondern zugleich auch Priester war. Seine Prophetie beginnt unmittelbar.
Das Thema der einleitenden Verse ist der Aufruf zur Umkehr zum Herrn. Die früheren Propheten hatten immer wieder versucht, die Menschen aus Israel zur Umkehr zu ihrem Gott zu bewegen. Dazu hätten diese aber ihre verkehrten Wege verlassen und ihr böses Tun aufgeben müssen. Doch das wollten sie nicht. So blieb Gott nichts anderes übrig, als im Zorn mit ihnen zu reden und ein zeitliches Gericht über sie zu bringen. Welch eine Warnung an die Juden, zu denen Sacharja gesandt war!
Ihnen werden zwei wichtige Wahrheiten gesagt. Die erste finden wir in Vers 3, die zweite in Vers 6.
In Vers 3 verspricht der Herr als Antwort auf die Umkehr des Volkes zu Ihm: «Ich werde zu euch umkehren.» Welch eine Gnade verheisst Er ihnen!
In den Versen 5 und 6 vergleicht Gott die Menschen mit seinen Worten und Beschlüssen. Menschen sterben; auch Propheten leben nicht ewig. Aber «das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit» (1. Petrus 1,25). Das wird hier bestätigt. Das Wort unseres Gottes ist das einzige, das in dieser Welt, in der sich alles verändert, wirklich Bestand hat und in Ewigkeit bleibt.
Der Reiter zwischen den Myrten
Etwa drei Monate nach den ersten und einleitenden Worten des Herrn an den Propheten Sacharja hatte dieser die erste Vision. Er sah einen Mann auf einem roten Pferd. In Vers 11 wird dieser Reiter als Engel des Herrn bezeichnet. Es ist der Herr Jesus, der im Alten Testament oft in dieser Gestalt erscheint (2. Mose 3,2; Richter 6,11; Psalm 34,8).
Sacharja bittet den Engel um eine Erklärung für das, was er sieht. Diese Pferde, die ausgesandt sind, um die Erde zu durchziehen, stellen die Regierungen der Nationen dar. Ihnen hat Gott seit dem Fall von Jerusalem und dem Ende der nationalen Selbstständigkeit Israels die Regierung der Erde anvertraut.
Seit der Wegführung der Juden in die babylonische Gefangenschaft war es jahrzehntelang ruhig geblieben. Aber jetzt folgt auf die Frage an Gott: «Wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen?», seine gute und tröstliche Antwort.
Der fürsorgliche und gnädige Eifer Gottes hatte das Böse in seinem Volk zwar nicht aufhalten können, so dass Er mit Gericht eingreifen musste. Doch die Nationen, die Er als Zuchtrute seines Volkes benutzt hatte, waren über ihr Mass hinaus gegangen. Darum wollte Gott sich Jerusalem wieder mit Erbarmen zuwenden. Zion sollte wieder aufgebaut werden und die Städte in Israel wieder von Gutem überfliessen. Das erfüllte sich zum Teil, als eine Anzahl Juden nach Jerusalem zurückkehrte und den Tempel und die Stadt wieder aufbauten. Die volle Erfüllung ist aber noch zukünftig.
Vier Hörner
Nach der Vision mit den Pferden sieht Sacharja vier Hörner. Dann lässt der Herr ihn noch vier Schmiede sehen. Wieder fragt der Prophet nach der Bedeutung dieser Symbole und der Engel gibt ihm Antwort.
Es geht um die in Sacharja 1,15 erwähnten Nationen. Das Horn ist ein Symbol der Macht. Gott hat heidnische Mächte benutzt – es sind Weltreiche, wie wir dies aus Daniel 7 und anderen Stellen entnehmen können –, um sein irdisches Volk mit Gericht heimzusuchen und zu zerstreuen.
Im Gegensatz zu den Hörnern, die einfach vor den Augen des Propheten standen, heisst es von den Schmieden: «Der Herr liess mich vier Schmiede sehen.» Gott selbst hat in seiner Vorsehung Kräfte bestellt, die das Fundament dieser Reiche erschütterten, so dass sie schliesslich untergingen. Auch wenn Gott nicht mehr direkt ins Weltgeschehen eingreift, wirkt Er durch seine Vorsehung. Die vier Schmiede zeigen, wie Er sich gegen die Feinde seines Volkes wendet (Psalm 48,5-7).
Diese Verse deuten sicher auch in eine heute noch zukünftige Zeit. In der kommenden Drangsalszeit wird Gottes irdisches Volk durch grosse Nöte zu gehen haben. Aber dann wird der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen und den treuen Überrest des Volkes aus der Hand seiner Bedränger befreien. Alle Feinde seines Volkes sind auch seine Gegner, die Er dann endgültig besiegen wird. Unter diesem Blickwinkel lassen uns die vier Schmiede an Jesus Christus denken, der uns in den vier Evangelien unter vier Charakterzügen vorgestellt wird.
Zukunft der Stadt Jerusalem und Appell zur Rückkehr
In diesen Versen geht es um die Zukunft der Stadt Jerusalem. Aber es ist nicht das damalige Jerusalem, das zur Zeit Sacharjas in Trümmern lag und das unter Nehemia wieder aufgebaut wurde. Hier ist die Rede von der Stadt Jerusalem zur Zeit des Endes, wenn Jesus Christus als König in Macht und Herrlichkeit von diesem Ort aus seine Universalherrschaft ausüben wird.
Im Tausendjährigen Reich wird Jerusalem als offene Stadt, d.h. in unbegrenzter Ausdehnung, bewohnt werden. Ihr Schutz wird keine materielle Stadtmauer sein. Nein, der Herr selbst wird rings um sie her eine feurige Mauer sein. Die «Herrlichkeit in seiner Mitte» lässt an die Gegenwart Gottes denken, die dann wieder durch die Wolke seiner Herrlichkeit sichtbar werden wird (Hesekiel 43,1-6).
Die Verse 10-13 sind ein Appell an das zerstreute Volk Israel, in sein Land und nach Jerusalem zurückzukehren. Auch wenn heute viele Juden nach Israel zurückgekehrt sind und noch zurückkehren, werden sich diese Worte doch erst in der Zukunft ganz erfüllen, denn in den Versen 12 und 13 spricht der Messias, der sich dann für sein Volk einsetzen wird.
Welch ein Jubel und welch eine Freude wird es für den gläubigen Überrest bedeuten, wenn der Herr wieder in seiner Mitte wohnen wird! Gott wird diese Treuen, die sich weigern werden, den Antichristen anzuerkennen, als sein Volk annehmen und sich zu ihnen bekennen.
Der Hohepriester Josua
Der Hohepriester Josua gehörte mit dem Statthalter Serubbabel zu den Führern, die eine Anzahl Juden aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem und Juda zurückbrachten (Esra 2,2). In dieser Vision Sacharjas repräsentiert Josua den gläubigen Überrest der Juden in der Zukunft. Die Verse zeigen, wie Gott am Ende der Drangsalszeit seine Beziehung zu Israel wieder anknüpfen und es als sein Volk anerkennen wird. Satan ist bei dieser Szene auch zugegen. Er ist der grosse Widersacher Gottes und Feind seines Volkes (Offenbarung 12). Er versucht durch berechtigte Anklagen wegen den Sünden Israels dem Engel des Herrn zu widerstehen. Doch dieser hat eine Antwort, der Satan nichts entgegnen kann.
Der treue Überrest aus Israel gleicht einem Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist. Alle seine Ungerechtigkeit wird ihm aufgrund des Opfertodes des Herrn Jesus vergeben werden. Die Feierkleider reden von der Gnade, die diesem Volk zuteil werden wird. Wir werden dabei an Römer 11,26-32 erinnert.
Ja, die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und seinem irdischen Volk ist ein Wunder der Gnade, das sich nur auf das Sühnungswerk von Christus am Kreuz gründet. Der Knecht, Spross genannt, erinnert an das Kommen des Herrn Jesus als Mensch auf diese Erde und der Stein spricht von Ihm als dem Fundament (Jesaja 28,16). Auch das Lamm in Offenbarung 5,6 hat sieben Augen (Vers 9). Der letzte Vers des Kapitels illustriert, was auf die Begnadigung Israels folgt: der Segen des Tausendjährigen Reiches.
Der Leuchter und die zwei Olivenbäume
Der Engel, der dem Propheten schon manches gezeigt hat, weckt ihn, damit er eine neue Vision sehe. Es geht um einen Leuchter, dessen sieben Lampen mit Öl gespeist werden. Er sieht auch zwei Olivenbäume, die das Öl zum Licht liefern.
Das Öl ist in der Bibel oft ein Bild des Heiligen Geistes. In der Stiftshütte stand ein goldener Leuchter, dessen Lampen mit Öl versorgt wurden. Dieser Leuchter war das einzige Licht im Heiligtum. Er redet vom Licht des Heiligen Geistes, der uns alles so zeigt, wie Gott es sieht. Der Geist Gottes ist es, der uns hilft, die Bibel zu verstehen, und der uns Licht über die in der Bibel offenbarten Gedanken Gottes gibt. Menschliche Weisheit kann uns da nicht weiterhelfen.
Gott will den zurückgekehrten Juden zeigen, dass sie sich für ihren Glaubensweg, auf dem es Schwierigkeiten gab, ganz auf die Kraft und Wirkung des Geistes Gottes stützen sollten. Das gilt auch für uns. Wir brauchen unser Leben als gläubige Christen nicht aus eigener Kraft und Willensanstrengung zu führen – was wir ohnehin nicht schaffen. Wir dürfen uns auf den Herrn und die Kraft durch seinen Geist stützen.
Der Schlussstein redet wieder von unserem Herrn. Er ist nicht nur das Fundament unseres Glaubens (Sacharja 3,9), er führt auch alles zu seinem Ziel. Über allen Wegen Gottes mit den Menschen – seien es die Gläubigen der Versammlung oder der gläubige Überrest Israels – steht das herrliche Wort «Gnade». Alles verdanken wir dem Reichtum und der Herrlichkeit der Gnade Gottes (Epheser 1,4-7).
Der Bau wird vollendet
Vers 9 erinnert an den Wiederaufbau des Tempels Gottes in Jerusalem unter der Führung Serubbabels. Aus dem geschichtlichen Bericht im Buch Esra wird ersichtlich, dass jenes Haus tatsächlich vollendet wurde. Zweimal heisst es dort, dass die Bauenden von den Propheten unterstützt wurden (Esra 5,1.2; 6,14.15). In seinen Abmessungen war das wieder aufgebaute Haus Gottes viel kleiner als der zerstörte salomonische Tempel. Doch die Menschen sollten sich dadurch nicht entmutigen lassen, sondern bedenken, dass es ein Tag kleiner Dinge war.
Heute ist das Zeugnis der Versammlung, des geistlichen Hauses Gottes, sehr schwach geworden. Doch wir wollen den Tag kleiner Dinge nicht verachten und an unserem Platz dem Herrn treu sein.
Mit «jenen Sieben» sind die sieben Augen in Sacharja 3,9 gemeint. Nehmen wir noch Offenbarung 5,6 dazu, dann finden wir dort die Erklärung: «Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die gesandt sind über die ganze Erde.» Diese Aussage korrespondiert mit dem Schluss von Vers 10. Gott sieht alles und freut sich an allem, was Er an Treue bei den Seinen vorfindet.
Interessant ist die Aussage von Vers 14. Da wird der Leuchter mit den sieben Lampen als Herr der ganzen Erde bezeichnet. Der Geist des Herrn (das Öl) und der Herr selbst sind eng miteinander verbunden. Im Herrn Jesus konnte der Geist Gottes ungehindert wirken und sich entfalten. So konnte der Mensch gewordene Sohn Gottes z.B. sagen: «Ich bin das Licht der Welt.»
Die Fluchrolle und die Frau im Epha
Die zwei Visionen in diesem Kapitel weisen auf eine wichtige Tatsache hin. Sowohl zur Zeit Sacharjas als auch in der Endzeit, auf die seine Weissagungen vor allem hinweisen, sehen wir eines: Nicht alle aus dem Volk Israel werden am Segen Gottes teilhaben. Viele werden im Unglauben verharren. Da sie nie Buße getan haben, wird Gott sie für ihre Sünden richten.
Es werden zwar nur jene Menschen erwähnt, die gestohlen und jene, die beim Namen Gottes falsch geschworen haben. Doch diese zwei Taten stehen stellvertretend einerseits für die Sünden gegenüber Menschen und anderseits für die Sünden gegenüber Gott. Der Herr spricht über alle sein Urteil (den Fluch) aus.
Die Verse 5-11 sagen sinngemäss das Gleiche aus wie die Verse 1-4. Wieder geht es um das Gericht Gottes über all jene in seinem Volk, die im Unglauben verharren und über ihre Sünden nicht Buße tun. Aber in diesem Abschnitt geht es nicht um Einzelpersonen, sondern um das ungläubige Volk als Ganzes.
Es wird bildlich durch eine Frau dargestellt, die als die Gottlosigkeit bezeichnet wird. Das Epha ist ein Hohlmass. Es lässt uns an Gewerbe und Handel denken. Eng damit verbunden ist der Gedanke, dass viele in dieser Welt reich werden wollen (1. Timotheus 6,9.10). Andere Stellen in der Bibel beschreiben das in den Versen 9-11 angetönte Gericht. Es wird über das ungläubige Volk Israel kommen, das dem Antichristen folgen wird.
Vier Wagen zwischen den Bergen
Diese vier Wagen, die von verschieden farbigen Pferden gezogen werden, deuten auf die vier Weltreiche hin, die vor allem im Propheten Daniel ausführlich behandelt werden. Es sind das babylonische, das medo-persische, das griechische unter Alexander dem Grossen und das römische Weltreich. Auf diesem vierten Weltreich liegt eine besondere Betonung, denn nur von den starken Pferden wird gesagt, dass sie die Erde durchziehen.
Diese Wagen kommen aus der Gegenwart des Herrn der ganzen Erde. Es sind seine Werkzeuge, durch die Er seine Rechte an die Erde geltend macht. Doch Er regiert durch Vorsehung. Das ist bis heute so. Wenn Christus in Macht und Herrlichkeit erscheinen und die Herrschaft antreten wird, dann wird seine Regierung wieder eine unmittelbare sein (durch seine Person). Das Zentrum seiner Herrschaft wird die Stadt Jerusalem sein.
Diese Wagen fahren zwischen zwei Bergen von Kupfer. Ihr Lauf ist also klar bestimmt. Sie können nur diesen Weg nehmen und weder nach rechts noch nach links ausweichen. Diese Bildersprache enthält eine ermunternde Botschaft für jeden Glaubenden, der noch in dieser Welt lebt. Obwohl Gott die Regierung der Völker in die Hand der Nationen gelegt hat, lenkt Er durch seine Vorsehung den Lauf des Weltgeschehens nach seinem Willen. Nichts läuft Ihm aus dem Ruder. Es kommt alles so, wie Er es nach seinem Plan und Willen festgelegt hat. Ist das nicht ein grosser Trost für uns?
Die Krönung des Hohenpriesters Josua
Nach den verschiedenen Visionen, die Sacharja gesehen hat, redet der Herr direkt mit ihm. Er soll den Hohenpriester Josua wie einen König krönen. Damit wird jener Mann zu einem schönen Hinweis auf Christus selbst. Und der Herr bestätigt es durch seine Worte in Vers 12.
Bereits in Sacharja 3,8 hat Gott vom Herrn Jesus als dem Spross gesprochen. Hier tut Er es wieder. Dieser Mann, genannt Spross, ist Christus als Mensch, der bei seinem Kommen in Herrlichkeit sowohl Priester als auch König sein wird. Ähnlich wie einst Melchisedek, der sowohl König als auch Priester Gottes war, verbindet der Herr Jesus diese beiden Ämter in seiner Person (1. Mose 14,18; Hebräer 7,1-3). Während das Königtum seine Autorität begründet, redet sein Priestertum von Fürsorge und Gnade (Hebräer 4,14-16).
In Israel bestand nicht immer Übereinstimmung zwischen dem König und den Priestern. Bei Christus dagegen sind Königtum und Priestertum in einer Person vereint (Vers 14). Autorität und Gnade sind bei Ihm vollkommen im Gleichgewicht. Beide kommen entsprechend dem Ratschluss Gottes völlig zur Geltung.
Zweimal wird gesagt, dass dieser Priesterkönig den Tempel wiederaufbauen wird. Die in Vers 14 erwähnten Personen sind ein Bild des gläubigen Überrests. Ähnlich wie diese Männer wird der Überrest die Krone zum Gedächtnis im Tempel des Herrn Jesus empfangen. Das wird Gottes Belohnung dafür sein, dass sie sich vom Tempel des Antichristen, in dem dieser sich als Gott verehren lässt, distanzieren werden.
Über das Fasten
Kapitel 7 beginnt mit einer neuen Zeitangabe. Die hier aufgezeichneten Worte hat Gott ungefähr zwei Jahre nach der Zeit gesprochen, da das Wort des Herrn zum ersten Mal an Sacharja erging (Sacharja 1,1). Die Einwohnerschaft von Bethel sandte eine Delegation unter der Führung von Sarezer und Regem-Melech mit einer Frage zu den Priestern und Propheten in Jerusalem.
Die Juden hatten in Babel zum Gedenken an die Hauptereignisse bei der Einnahme und Zerstörung Jerusalems vier Fasten ausgerufen: im vierten, fünften, siebten und zehnten Monat. Das Fasten im fünften Monat erinnerte an die Zerstörung des Tempels (2. Könige 25,8.9). Nun ging der Wiederaufbau des Tempels unter Serubbabel seiner Vollendung entgegen. Da fragten die Leute von Bethel, ob das Fasten im fünften Monat noch nötig sei. Auch wenn der Tempel durch Gottes Gnade wieder aufgebaut werden konnte, war der Zustand des Volkes doch sehr schwach. Hatten sie kein Empfinden dafür?
Gott gab dem Propheten eine Antwort. Doch er sollte sie nicht nur den Einwohnern von Bethel, sondern dem ganzen Volk sagen. Herzerforschend fragt der Herr: «Habt ihr bei eurem Fasten überhaupt an mich gedacht?» Als diese Fasten eingesetzt wurden, war der Beweggrund sicher echte Trauer. Aber jetzt war das Halten dieser Tage zu einer leblosen Form geworden, die für den Herrn wertlos geworden war. Gott hatte schon früher, als Jerusalem noch bewohnt und ruhig war, in ähnlicher Weise mit dem Volk reden müssen (Vers 7; Jesaja 58,3-7). Hatten sie dies vergessen?
Gerechtes und gütiges Verhalten
Nun ergeht das Wort des Herrn ein weiteres Mal durch den Propheten Sacharja an das Volk. Es ist ein ernster Appell an das Gewissen der Menschen. Gott rief sein Volk zu einem korrekten Handeln und Beurteilen auf und ermahnte sie, einander Güte und Barmherzigkeit zu erweisen, die Schwachen nicht zu bedrücken und über den Nächsten nichts Böses zu denken. Von uns Christen möchte Gott nicht nur, dass wir das Böse meiden, sondern wir sollen positiv Gutes tun (Galater 6,10).
Die Verse 11-14 beschreiben eigentlich die ganze Geschichte des irdischen Volkes Gottes. Sie weigerten sich nicht nur einmal oder zweimal, auf Gott zu hören. Nein, immer wieder verhielten sie sich widerspenstig und waren taub für das, was Gott ihnen durch die Propheten sagen wollte.
Nichts ist härter als Diamant, und so hart war das Herz des Volkes gegenüber Gott und seinem Wort geworden. Alle seine Worte prallten an ihnen ab, so dass nur noch Gericht übrig blieb.
Dieser Zorn des Herrn, der über sein rebellisches Volk kam, zeigte sich nicht nur in der Verwüstung des Landes Israel und der Zerstreuung der Israeliten unter alle Völker. Zum Gericht Gottes gehörte auch, dass sie in ihrer Bedrängnis riefen und Er nicht darauf reagierte. Sie mussten ernten, was sie gesät hatten: «Wie er gerufen hatte und sie nicht gehört hatten, so riefen sie, und ich hörte nicht, spricht der Herr der Heerscharen.» Im Blick auf Gottes Regierungswege gilt der gleiche Grundsatz auch für uns (Galater 6,7).
Der HERR eifert für Juda und Jerusalem
Nachdem Gott auf die Frage des Volkes in Sacharja 7,3 ernst zum Gewissen der Menschen geredet hat, öffnet Er nun sein Herz voller Liebe und Gnade. Er eröffnet den damals zurückgekehrten Juden seine Ziele mit Jerusalem. Was wir in diesen Versen finden, geht weit über den damaligen Wiederaufbau des Tempels und später der Stadt mit ihrer Mauer hinaus. Gott spricht von einer noch zukünftigen Zeit.
Als der Tempel unter Serubbabel eingeweiht wurde, lesen wir nicht, dass das Haus von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt wurde wie bei Salomo (Esra 6,14-18; 1. Könige 8,10.11). Doch im Blick auf die Zukunft sagt Gott: «Ich kehre nach Zion zurück und will inmitten Jerusalems wohnen.»
Jerusalem war eine Stadt der Unaufrichtigkeit, der Heuchelei, der toten Formen geworden. Das sehen wir besonders in den Evangelien, wo der Geist Gottes immer wieder die Gesinnung der Führerschaft der Juden aufdeckt (z.B. Matthäus 23). Im Tausendjährigen Reich aber wird Jerusalem den Namen «Stadt der Wahrheit» tragen.
Gottes Gnade – davon spricht der Name Zion für Jerusalem – wird die Zerstreuten seines Volkes nach Israel zurückbringen. Mit dem gläubigen Überrest wird Er die lange unterbrochene Beziehung wieder anknüpfen. «Sie werden mein Volk, und ich werde ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit.» Welch eine herrliche Zukunft steht dieser heute noch von vielen Seiten umkämpften Stadt bevor! Gott wird Wunderbares zustande bringen.
Der Segen für das Land und das Volk
Der Blick in eine damals und heute noch zukünftige Zeit sollte die in jener Zeit Bauenden ermuntern. Gott selbst ruft ihnen zu: «Stärkt eure Hände!» Zweimal wiederholt Er: «Fürchtet euch nicht!» Auch wenn es damals noch nicht so herrlich werden sollte wie einmal im Tausendjährigen Reich, so hatte Gott doch manches Gute bewirkt. Das war die Garantie dafür, dass sich alles Weitere zu seiner Zeit erfüllen würde.
Wenn Gott in Vers 13 davon spricht, dass Juda und Israel ein Fluch unter den Nationen waren, dann fallen darunter sicher auch all die Judenverfolgungen, die es im Lauf der Jahrhunderte immer wieder gegeben hat. Auch heute gehen die Meinungen der Völker über das Volk Israel weit auseinander. Doch das wird sich einmal ändern. Im Tausendjährigen Reich wird dieses Volk unter der Regierung seines Messias ein Segen für die ganze Erde sein.
Es fällt auf, wie oft der Geist Gottes die Aussage wiederholt: «So spricht der Herr der Heerscharen.» Es ist, als ob Gott seinem Volk damit seine Treue in der Ausführung seines Wortes versichern wollte.
Wenn Gott ihnen in seiner Gnade eine derart herrliche Zukunft vorstellte, dann durfte Er von ihnen eine aufrichtige Antwort erwarten, ein Verhalten wie es die Verse 16 und 17 aufzeigen. Redet das nicht auch zu unseren Herzen? Beantworten wir die Gnade und Liebe unseres Herrn und Erlösers mit einem Ihm wohlgefälligen Leben in Gottesfurcht? Möchten wir Ihm würdig leben!
Festzeiten statt Fasten
Nun kommt der Herr auf das Fasten in den verschiedenen Monaten des Jahres zu sprechen (siehe Fussnote zu Sacharja 7,3). Die Zeit würde kommen, da diese Tage der Trauer und der Beugung über die Zerstörung Jerusalems und des Tempels zu fröhlichen Festzeiten werden würden. Aber damals war es noch nicht so weit. Sie lebten noch in den Tagen kleiner Dinge, genauso wie wir. Was sie damals tun konnten, dürfen auch wir ausleben: Die Wahrheit und den Frieden lieben. Gott sagt die Wahrheit. Etwas zu denken, das seinen in der Bibel offenbarten Gedanken entgegensteht, würde bedeuten, dass man den Frieden nicht liebt.
Die Schlussverse des Kapitels weisen noch auf eine andere Seite des Volkes Israel im Tausendjährigen Reich hin. Hier steht nicht sein eigener Segen und der Segen, den es für die Welt sein wird, im Vordergrund, sondern die Ehre Gottes. Die Menschen werden dann erkennen, dass der Gott Israels der wahre Gott ist, und dass Er im Tempel in Jerusalem seinen Wohnplatz auf dieser Erde hat. Nun wollen die Menschen aus den Völkern den Herrn der Heerscharen suchen und Ihn anflehen. Dazu schliessen sie sich den Juden mit den Worten an: «Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.» Israel wird eine Mittlerfunktion zwischen Gott und den übrigen Nationen einnehmen. – Heute darf jeder Mensch, unabhängig von Volkszugehörigkeit, Geschlecht oder sozialer Stellung, durch den Glauben an Jesus Christus direkt zu Gott kommen. Welch eine Gnade!
Die Nachbarvölker werden besiegt
Mit Kapitel 9 ändert sich der Charakter dieses prophetischen Buches. Nun finden wir keine Zeitangaben und keine Visionen mehr. Aber zweimal heisst es: «Ausspruch des Wortes des Herrn» (Sacharja 9,1; 12,1). Es folgen schwerwiegende Aussprüche Gottes über verschiedene Nachbarvölker von Israel und über Gottes Volk selbst.
Das Auge des Herrn ist auf die Menschen und auf sein Volk gerichtet. Nichts entgeht Ihm. Aber nicht nur das. Auch das prophetische Wort geht in Erfüllung, wenn es heisst: «Es lässt sich nieder.»
Die Verse 3 und 4 fanden eine Vorerfüllung in der Eroberung von Tyrus durch Alexander den Grossen. Doch es war eigentlich der Herr, der es einnahm. Das Küstengebiet von Philistäa wird den Fall von Tyrus miterleben und soll sich fürchten, denn das Gericht Gottes wird auch die Philisterstädte treffen. Der Herr geht vor allem gegen den Hochmut der Philister und ihren Götzendienst (seine Gräuel) vor. Aber alle diese Aussagen haben sich zur Zeit Alexanders des Grossen nur zum Teil erfüllt. Eine endgültige Erfüllung steht noch aus. Dann wird Gott auch dafür sorgen, dass ein Überrest von den Philistern bleiben und von Ihm anerkannt werden wird.
In Vers 8 kündigt Gott den Schutz seines Hauses, des Tempels, vor den feindlichen Armeen an, die das Land durchziehen werden. Aber nachher wird auch die Zeit kommen, da kein Bedränger mehr das Land Israel bedrohen wird.
Der König kommt und befreit sein Volk
Vers 9 fand eine erste Erfüllung, als der Herr Jesus als rechtmässiger König Israels, aber in Demut in Jerusalem einzog (Matthäus 21,4.5; Lukas 19,36-38; Johannes 12,12-15). Doch es vergingen damals nur wenige Tage, da rief die Volksmenge, die Ihm zugejauchzt hatte: «Kreuzige, kreuzige ihn!» Die endgültige Erfüllung dieser Verse liegt noch in der Zukunft. Doch der Augenblick wird kommen, da der Herr Jesus nicht nur als König Israels, sondern als König der Könige von Jerusalem aus über die ganze Erde herrschen wird.
Die Verse 11 und 12 deuten auf den treuen Überrest aus Israel hin, der am Ende der schrecklichen Drangsalszeit vom Herrn selbst befreit werden wird. Wie herrlich wird der Segen sein, mit dem diese Treuen überschüttet werden! «Das Doppelte werde ich dir erstatten.» Das erinnert uns an Hiob und wie Gott ihn nach seiner Prüfung gesegnet hat (Hiob 42,10).
Die «Söhne Griechenlands» lassen an die Teilreiche nach dem Tod Alexanders des Grossen denken. Unter diesem Blickwinkel kann man von einer teilweisen Erfüllung der Verse 13-17 während der Makkabäerkämpfe reden. Doch der Hauptgedanke ist der Sieg des Herrn Jesus über die Feinde Israels bei seinem Kommen in Herrlichkeit. Die Krone wird Christus gehören, aber die Glaubenden aus Israel, die neues Leben besitzen, werden wie Edelsteine in dieser Krone funkeln. Sie werden das reine Licht Gottes in seinem Land strahlend widerspiegeln. Der Herr hat sie dazu gemacht, und zwar zu ihrem Segen und zu seiner Herrlichkeit.
Die Rettung Israels
Der Regen ist in der Bibel oft ein Bild des Segens, der von Gott zu uns Menschen kommt. In Vers 1 wird Israel aufgerufen, den Spätregen vom Herrn zu erbitten. Und der Frühregen? Dieser war mit dem Kommen des Herrn in Niedrigkeit und mit dem Herniederkommen des Heiligen Geistes bereits ausgegossen worden. Aber die Juden haben sowohl den Herrn gekreuzigt als auch das Zeugnis des Geistes verworfen. Seither verharrt dieses Volk im Unglauben. Und es muss noch durch die Drangsalszeit gehen, bis Gott den gläubigen Überrest mit dem Spätregen segnen kann (Hosea 6,3; 10,12).
Zur Zeit als Christus hier in Niedrigkeit lebte, gab es keinen Götzendienst in Israel. Doch am Ende der Zeit, unter dem Antichristen, wird der Götzenkult einen traurigen Höhepunkt erreichen. Welch eine Verführung des Volkes wird es dann geben! Doch bereits zur Zeit Jesu führten die Führer des Volkes die Menschen nicht zu Gott, sondern in die Irre. Die Zeit wird kommen, da Gottes Zorn gegen diese Verführer entbrennen wird. Gleichzeitig wird Er sich seiner Herde (des treuen Überrests) annehmen. Doch das liegt noch in der Zukunft.
Wenn sich diese Verse erfüllen, wird das irdische Volk Gottes wieder so gestärkt sein, dass es mit Gottes Hilfe alle seine Feinde besiegen wird. Aber nicht nur das. Das Volk – es sind alle Glaubenden des Überrests – wird sich freuen und im Herrn frohlocken. Israel wird sich in seinem Land ausbreiten und im Namen des Herrn wandeln, d.h. in Gottesfurcht und zu seiner Ehre. Wie herrlich wird das sein!
Der wahre Hirte wird abgelehnt
Wir haben zu Beginn von Sacharja 10 gesagt, dass der Frühregen – jener Segen, der mit dem Kommen des Herrn Jesus in Niedrigkeit verbunden war – nicht erwähnt wird. Christus, der Messias, wurde damals von seinem Volk verworfen, so dass Gott mit Gericht reagieren musste. Das wird in diesem Kapitel gezeigt. Und um die Voraussage Gottes zu unterstreichen, musste Sacharja bildlich den Platz des leidenden Messias einnehmen.
Das Kapitel beginnt – wie es scheint – mit einer Illustration des Niedergangs, ja, der Verwüstung des Volkes Israel, besonders der Führungsschicht (die Herrlichen, die Hirten). Wenn wir an die Zeit des Herrn Jesus in den Evangelien denken, dann seufzte dort das Volk unter der Herrschaft der Römer und die eigenen Hirten versagten völlig. Noch viel schlimmer wird es dem irdischen Volk Gottes in der Endzeit ergehen.
Sacharja bekommt den Auftrag, die «Herde des Würgens» zu weiden. Dieser Herde steht die Vernichtung bevor. Als Jesus hier lebte, war Er innerlich bewegt über die Menschen seines Volkes, «weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben» (Matthäus 9,36). In der Endzeit wird es noch schlimmer sein. Da sagt Gott: «Ich überliefere die Menschen, jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs.» Der König wird niemand anders als der Antichrist sein, der nicht das Wohl des Volkes suchen, sondern die Ungläubigen aus Israel verführen wird. Gott wird dies zulassen, weil sie einst den wahren Messias verworfen haben.
Der falsche Hirte schadet der Herde
Nun nimmt Sacharja bildlich den Platz des Herrn Jesus ein, der in der Fülle der Zeit gekommen war. Er hatte sich der Elenden der Herde angenommen. Doch Er wurde verworfen.
Die beiden Stäbe, die Sacharja nehmen muss, heissen «Huld» und «Verbindung». Der erste spricht von der Beziehung Israels zu Gott, der zweite von der Einheit des Volkes, also von der Beziehung untereinander. Die drei Hirten, die er vertilgt, sind vermutlich Personengruppen, die in ihrer Führung des Volkes versagt haben (Priester, Propheten, Hirten).
Vom zweiten Teil des Verses 8 an geht es um die Verwerfung des Herrn Jesus, als Er in Demut zu seinem Volk kam. Es war Judas Iskariot, der seinen Meister für 30 Silberstücke verriet. Als der Verräter sah, wie die Sache verlief, reute es ihn und er warf dieses Geld in den Tempel (Matthäus 26,14.15; 27,3-10). Der Stab «Huld» wurde zerbrochen. Gott unterbrach für eine Zeit seine Beziehung zu seinem Volk. Die Elenden der Herde – es sind die wenigen, die damals an Christus glaubten – erkannten die Situation im Licht Gottes.
Die Verse 15-17 beschreiben prophetisch das Kommen und Auftreten des Antichristen. Dieser nichtige Hirte wird dem Volk Gottes nur schaden. Er wird im Buch der Offenbarung als das Tier beschrieben, das aus der Erde aufsteigt, einem Lamm gleicht, aber wie ein Drache redet (Offenbarung 13,11). Bei seinem Erscheinen in Macht und Herrlichkeit wird der Herr Jesus diesen bösen Hirten mit dem Hauch seines Mundes vernichten (2. Thessalonicher 2,8).
Jerusalem als Taumelschale
Wie bereits in Sacharja 9,1 haben wir hier wieder einen Ausspruch des Wortes des Herrn. Diese wichtige und schwerwiegende Botschaft betrifft vor allem die Zukunft der Stadt Jerusalem. Gott selbst will sich dieser Stadt annehmen, die immer wieder im Brennpunkt der Weltpolitik stand und steht.
Der in diesem Kapitel wiederholt vorkommende Ausdruck «an jenem Tag» weist auf den Tag des Herrn hin, an dem Gott seine Ziele mit der Erde und mit seinem Volk Israel erreichen wird. Es geht hier um den letzten Angriff auf die heilige Stadt Jerusalem vor der Aufrichtung des Tausendjährigen Reiches.
Der Herr wird zugunsten seines Volkes eingreifen und den angreifenden Heeren hindernd entgegentreten. Die «Bewohner von Jerusalem» sind hier die Gläubigen des Überrests, denn sie haben eine Beziehung zum Herrn der Heerscharen, der ihr Gott ist. Die Fürsten sind hier nicht mehr jene bösen Hirten, die dem Volk nur schadeten, sondern solche, die sich mit den Treuen verbinden (Vers 5).
Das Ziel Gottes mit Jerusalem wird sein, dass seine Bewohner dort in Frieden wohnen können. Sie soll in Wahrheit die Stadt des Friedens und das Zentrum der Regierung des Friedefürsten werden.
Aber so weit wird es erst «an jenem Tag» sein. Bis jener Moment kommen kann, muss sich noch manches prophetische Wort erfüllen, vor allem die Zeit der Gerichte, die nach der Entrückung aller Glaubenden beginnen wird.
Der Überrest tut Buße
«An jenem Tag» wird Gott selbst seine gute und schützende Hand über den Bewohnern Jerusalems halten. Er wird sich auch gegen alle Nationen wenden, die diese Stadt angreifen werden.
Doch bevor Er die Stadt wirklich befreien und zu dem machen kann, was Er schon längst geplant hat, muss in den Herzen des gläubigen Überrests etwas Entscheidendes geschehen.
Bis dahin haben die Treuen aus Israel den Antichristen nicht anerkannt. Sie haben sich geweigert, ihn anzunehmen, und haben weiter auf das Kommen des wahren Messias gewartet. Doch nun müssen sie zur Einsicht kommen, dass Jesus von Nazareth ihr Messias ist. Sie werden Den sehen, den ihr Volk gekreuzigt hat, und bitterlich darüber Leid tragen. Diese tiefe, echte Buße, die sich dann beim gläubigen Überrest zeigen wird, finden wir in den Versen 10-14 ausführlich beschrieben.
Jene Glaubenden werden in ihrer tiefen Trauer und Wehklage auch erkennen, dass Jesus Christus, ihr Messias, damals am Kreuz auf Golgatha die Sünde des Volkes Israel (= die Verwerfung und Kreuzigung ihres Messias) gesühnt hat.
Auf der Grundlage dieses vollbrachten Sühnungswerks wird Gott dem treuen Überrest, der Buße tun wird, vergeben können (siehe auch Sacharja 13,1). Und so wird an jenem Tag Jerusalem endgültig befreit und zum Zentrum der Herrschaft des Herrn Jesus über Israel und die ganze Erde werden.
Der wahre Hirte wird geschlagen
Dieses Kapitel schliesst unmittelbar an die Buße des Volkes in den Schlussversen von Sacharja 12 an. Es ist Gottes Antwort auf die Wehklage des Überrests. Die geöffnete Quelle lässt uns an den Sühnungstod Jesu am Kreuz denken. Als Er das Erlösungswerk vollbracht hatte, durchbohrte ein römischer Soldat mit einem Speer die Seite des Heilands. «Sogleich kam Blut und Wasser heraus.» Das Blut ist zur Sühnung der Sünden und das Wasser zur moralischen Reinigung. Gott wird seinem Volk vergeben, aber Er wird auch dessen Haltung völlig verändern. Jeder Götzendienst und jede Unreinheit samt der Erinnerung daran werden weggeschafft werden. Es wird auch keine falschen Propheten mehr geben. Eine solch vollständige Reinigung kann nur Gott bewirken!
Ab Vers 5 spricht der Prophet wieder vom leidenden Messias. Die Wunden in seinen Händen lassen uns an die Wundmale von den Nägeln des Kreuzes denken, die der Herr Jesus für immer tragen wird (Johannes 20,20). In alle Ewigkeit werden wir an sein Werk am Kreuz erinnert und Ihn dafür preisen und anbeten.
Vers 7 weist auf die drei Stunden der Finsternis am Kreuz hin. Da hat der heilige Gott den Sündlosen geschlagen, weil Er die Stelle derer einnahm, die glauben würden und ihre Sünden trug. Gott hat das Gericht, das wir verdient haben, an unserem Stellvertreter vollzogen, damit wir frei ausgehen können.
Er hat den Hirten auch für die Sünden seines Volkes geschlagen. Darum wird Israel nach der Läuterung wieder Gottes Volk und Er wieder ihr Gott sein.
Der HERR erscheint
In den ersten zwei Versen geht es um den letzten Angriff der Nationen gegen Jerusalem. Gott selbst versammelt sie zu jenem Brennpunkt der Erde. Er lässt sogar zu, dass die Stadt eingenommen wird und die Bewohner Schreckliches erleiden müssen.
Aber dann erscheint der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit. Seine Füsse werden auf dem Ölberg bei Jerusalem stehen. Wenn es in Vers 3 heisst: «Der Herr wird ausziehen …», dann wird klar, dass Jesus Christus die gleiche Person wie der Herr im Alten Testament ist. Gott kommt in der Person seines Sohnes, der einst als demütiger Mensch hier gelebt hat und am Ende gekreuzigt worden ist, auf diese Erde. Es ist niemand anders als der verachtete Jesus von Nazareth.
Er wird nicht allein erscheinen. Alle himmlischen Heiligen – die auferstandenen und entrückten Gläubigen – werden Ihn begleiten. Das bestätigen verschiedene Stellen im Neuen Testament (Vers 5; 1. Thessalonicher 3,13; 4,14; Offenbarung 19,14).
Das Kommen des Herrn in Herrlichkeit ist ein einzigartiger Tag für diese Erde. Seit der Kreuzigung des Sohnes Gottes wird es in dieser Welt moralisch zunehmend finsterer.
Doch in dem Augenblick, da man das Eintreten der völligen Dunkelheit der Nacht erwartet, wird es Licht sein. Wie? Durch das Einschreiten Gottes und durch seine Gegenwart in der Person seines Sohnes, der als Sohn des Menschen erscheinen wird.
Jerusalem im Tausendjährigen Reich
Jener Tag – der Tag der Erscheinung des Herrn Jesus in Herrlichkeit auf dieser Erde – wird zu einem Tag des Segens für viele werden. Davon reden die lebendigen Wasser, die aus Jerusalem nach Osten und nach Westen fliessen werden. Sie fliessen im Sommer und im Winter, d.h. sie versiegen nie.
Dann wird der Herr Jesus nicht nur König über Israel, sondern über die ganze Erde sein. Und dieser König ist zugleich Gott, der Herr. Dann wird Gott der einzig wahre Gott sein, den die Menschen anerkennen und dem sie sich unterwerfen werden. Dann wird es auf der Erde nur noch eine Religion geben. Vor allem die Menschen aus Israel, aber auch die übrigen Menschen werden dann wie nie zuvor die Wahrheit der Worte des Herrn Jesus verstehen: «Ich und der Vater sind eins» (Johannes 10,30).
In jener zukünftigen Zeit wird es nach Vers 10 im Land Israel auch geologische Umwälzungen geben. Die grossen Höhenunterschiede werden verschwinden. «Das ganze Land wird sich umwandeln wie die Ebene.» Aber Jerusalem wird erhaben bleiben und seine Bewohner werden in Sicherheit wohnen. Eine herrliche Zeit wird dann anbrechen.
So wunderbar die Befreiung Jerusalems durch den Herrn sein wird, so schrecklich wird das göttliche Gericht über all jene sein, die gegen diese Stadt Krieg geführt haben. Sie werden sich gegenseitig vernichten. Die riesige Beute, die jene Angreifer zurücklassen werden, kommt in Jerusalem zur Verteilung (vergleiche Vers 1).
Die Nationen im Tausendjährigen Reich
Mit den Übriggebliebenen von allen Nationen sind wohl all jene Menschen gemeint, zu denen der Herr Jesus beim Gericht der Lebenden sagen wird: «Erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an» (Matthäus 25,34). Im Tausendjährigen Reich wird es das Volk Israel geben, das wieder eine lebendige Beziehung zu seinem Gott und zu Christus, seinem Gesalbten, haben wird. Aber es werden auch verschiedene Nationen unter jener Friedensherrschaft leben. Doch sie müssen Jahr für Jahr nach Jerusalem hinaufziehen, «um den König, den Herrn der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern». Jene Stadt wird der Mittelpunkt der Welt sein.
Das Laubhüttenfest, das die Israeliten im Alten Testament jedes Jahr feiern sollten, war ein Fest der Ruhe und der Freude (3. Mose 23,39.40). Es wies prophetisch auf die hier beschriebene Zeit hin. Als Bestätigung dafür wird es auch dann gefeiert werden.
Die Verse 20 und 21 drücken im Blick auf «jenen Tag», d.h. den Beginn des Tausendjährigen Reiches, eine wichtige Tatsache aus. Der Herr sagte einmal zu Nikodemus: «Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.» So werden zu Beginn des Reiches nur von neuem geborene Menschen auf der Erde leben. Es wird dann kein «Kanaaniter», d.h. kein Ungläubiger, im Haus des Herrn sein. Alles – die Menschen und das, was ihnen gehört – wird dem Herrn geweiht sein. Alles ist für Ihn und alle leben für Ihn. Eine unvorstellbar gesegnete Zeit!
Einleitung
Als Maleachi mit einer Botschaft zum irdischen Volk Gottes geschickt wurde, befanden sich die Juden in einem traurigen Zustand. Sie waren zwar am richtigen Ort, hatten aber eine falsche Einstellung. Sie dienten nicht mehr den Götzen, doch sie verhielten sich gegenüber Gott völlig gleichgültig.
Um die Herzen der Juden anzusprechen, stellte der Herr ihnen seine unwandelbare Liebe vor. Er versprach ihnen einen Segen, wenn sie ihre Einstellung und ihr Verhalten korrigierten.
Gott sprach auch ihr Gewissen an: Er prangerte ihre Sünden und ihr Abweichen von seinen Geboten an. Er forderte sie zur Umkehr auf und kündigte eine schwere Gerichtszeit an, die heute noch in der Zukunft liegt. Gott wird die Ungläubigen in Israel bestrafen, bevor der Tag des Herrn mit dem vollen Segen für den bußbereiten Überrest anbrechen wird.
Gottes Liebe zu Israel
Die Gunst der Perserkönige hatte es den Juden im Exil ermöglicht, in ihr Land zurückzukehren. Ein Überrest aus ihnen war in mehreren Phasen nach Juda und Jerusalem gekommen. Nach und nach bauten sie den Altar und den Tempel Gottes wieder auf. Sie richteten den Gottesdienst ein und schützten das Heiligtum durch den Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem. Auch das Buch des Gesetzes Moses wurde wieder vorgelesen. Äusserlich stellten sie erneut das Volk Gottes dar. Doch mit der Zeit wurde ihr innerer Zustand immer schlechter. Ihre Herzen entfernten sich weit vom Herrn.
Da sandte Gott einen letzten Propheten zu ihnen. Durch die Botschaft Maleachis versuchte Er zum Herzen der Juden in Jerusalem zu reden. Vers 2 beginnt mit der grossartigen Aussage Gottes: «Ich habe euch geliebt.» Doch sofort kommt eine böse Entgegnung: «Worin hast du uns geliebt?» Viele Menschen reagieren heute ähnlich, wenn ihnen Gott vorgestellt wird, der die Welt so geliebt hat, dass Er seinen eingeborenen Sohn als Mensch auf die Erde und ans Kreuz gab. Obwohl Er auf Golgatha den Beweis dafür erbracht hat, dass Er Liebe ist, fragen die Leute: Wie kann Er all das Böse zulassen?
Nun zeigt Gott anhand des Lebens von Jakob und Esau, wie Er Jakob geliebt hat, weil dieser Mann trotz all seiner Fehler und Ränke nach Gott und seinem Segen verlangte. Im Herzen Jakobs hatte der Herr einen Platz, während Esau Ihn völlig aus seinem Leben ausklammerte. Das Neue Testament nennt ihn einen Ungöttlichen. Darum hasste Gott Esau.
Unheilige Opfer
Ab Vers 6 richtet sich der Herr an eine besondere Gruppe aus dem Volk Israel: an die Priester. Von ihnen erwartet man, dass sie nahe bei Gott sind, Gemeinschaft mit Ihm haben und Ihm dienen. Gerade darin haben sie damals versagt, so dass Gott sie tadeln muss. Doch anstatt ihre Schuld einzusehen, fordern sie von Gott Rechenschaft für seinen Vorwurf. Weil Er ihr Herz und Gewissen erreichen möchte, antwortet Er ihnen in Gnade.
Der Tisch des Herrn in den Versen 7 und 12 ist der Brandopferaltar. Anstatt Tiere ohne Fehler zu opfern, brachten sie minderwertige dar, die blind, lahm und krank waren. Nicht einmal der Statthalter hätte solche angenommen. Welch eine Verachtung Gottes! Wir verstehen gut, dass Er kein Gefallen an solchen Priestern hatte und ihre Opfergaben nicht annehmen konnte (Vers 10).
Der Herr der Heerscharen lässt diese bösen Leute wissen, dass eine Zeit kommen wird, in der sein Name nicht nur in Jerusalem, sondern überall gross sein wird. An jedem Ort werden seinem Namen reine Opfergaben dargebracht werden. Was für eine wunderbare Zeit wird das sein! Welch ein Gegensatz zu damals, als die Priester es als eine Anstrengung betrachteten, Gott etwas zu bringen. Sie hielten den Opferdienst zwar äusserlich fest, aber ohne Herzensbeziehung zum Herrn.
Am Ende des Kapitels prangert Gott die Unaufrichtigkeit der Opfernden an. Gleichzeitig stellt Er sich als ein grosser König vor, der sich für die Ehre seines Namens einsetzt.
Wie kommen wir am Sonntag in die Gegenwart des Herrn, um Gott als heilige Priester anzubeten?
Schlechtes Verhalten der Priester
Wie sehr ist Gott bemüht, unser Herz zu erreichen! Das sehen wir auch hier. Er hat den Priestern ihre Verfehlungen aufgezeigt. Werden sie es zu Herzen nehmen? Wenn sie nicht hören und Gott die Ehre verweigern, wird Er Fluch statt Segen über sie bringen. Seine Worte in Vers 3 zeigen, wie schlimm das Verhalten der Priester in seinen Augen war.
Um die Priester von ihrer verkehrten Einstellung zu überführen, bringt Gott einen weiteren Punkt vor. Er erinnert an seinen Bund mit dem Stamm Levi, zu dem sie gehörten. Wir denken an das goldene Kalb in der Wüste. Wie entschieden traten damals die Söhne Levis auf die Seite des Herrn! (2. Mose 32,26). Vielleicht denkt der Heilige Geist auch an 4. Mose 25, als das Volk in den Ebenen Moabs in Hurerei und Götzendienst verfiel. Da wird uns berichtet, wie der Priester Pinehas sich mit Entschiedenheit und Eifer für die Ehre Gottes einsetzte (4. Mose 25,10-13).
Zu den Aufgaben der Priester gehörte auch die Belehrung des Volkes durch das Gesetz (5. Mose 33,10). Voraussetzung war natürlich, dass sie selbst das Wort Gottes kannten und seine Gebote beachteten. Doch der Herr muss ihnen durch den wirklichen «Boten Gottes» (= Maleachi) vorhalten: Ihr seid abgewichen. Ihr seid gar keine «Boten des Herrn». Dadurch habt ihr viele zu Fall gebracht. Wie ernst ist Gottes Urteil: «So habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich gemacht.»
Als Christen sind wir eine heilige und eine königliche Priesterschaft (1. Petrus 2,5.9). Kommen wir als solche unserer Verantwortung nach?
Schlechtes Verhalten des Volkes
Mit den Fragen in Vers 10 erinnert der Prophet die Juden und uns daran, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Verhalten wir uns auch so, wie der Schöpfer es von uns erwarten kann?
Gott muss den Menschen in Juda Treulosigkeit vorwerfen (Maleachi 2,10.11.14.15.16). Aber nicht das Volk hatte sich mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt, sondern die einzelnen Menschen haben heidnische Frauen geheiratet. Das führte zu dieser traurigen Situation und war eine Beleidigung des wahren Gottes, der sein Volk immer noch liebte!
Aus dem Zusammenhang der Verse kann man den Schluss ziehen, dass viele Juden sich von ihren israelitischen Frauen scheiden liessen, um heidnische Frauen zu heiraten. Diese Sünden wiegen sehr schwer in Gottes Augen. Er kann die Opfergaben dieser treulosen Leute nicht mehr annehmen. Dennoch fragen sie trotzig: «Warum nicht?» In seiner Langmut gibt Gott ihnen auch darauf eine Antwort. Er hat alles gesehen, was zwischen den Eheleuten passiert ist. Mit Nachdruck macht Er jedoch klar, dass Er es hasst, wenn eine Ehe geschieden wird (siehe auch Matthäus 5,32; 19,6).
Die bösen Menschen haben damals Gottes Geduld erschöpft. Sie haben Ihn mit ihren leeren Worten ermüdet. Sie meinten, sie seien ja das Volk Gottes. Darum komme es nicht darauf an, wie sie sich verhielten. Arrogant fragten sie: «Wo ist der Gott des Gerichts?» Wohl ist Gott langmütig und ein Gott der Liebe. Aber Er ist auch heilig und wird zu seiner Zeit ein gerechtes Gericht ausüben.
Die Sendung des Boten
Der erste Satz dieses Kapitels weist prophetisch auf Johannes den Täufer hin. Er war der Vorläufer des Messias (Markus 1,2). Aber dann spricht der Prophet nicht vom Kommen des Herrn Jesus in Gnade, wie es uns die Evangelien berichten, sondern von seinem Erscheinen in Herrlichkeit. Von dieser heute noch zukünftigen Zeit lesen wir beispielsweise in Matthäus 24.
Vers 2 ist die Antwort auf die freche Frage: «Wo ist der Gott des Gerichts?» Der Herr wird kommen, und zwar um die Ungläubigen zu bestrafen und die Gläubigen für das Reich zu läutern. Wie ein Silberschmied wird Er sein Volk ins Feuer des Gerichts bringen. Er spricht hier ausdrücklich vom Stamm Levi, zu dem die Priester gehörten. Diese zukünftige Läuterung durch Gott wird für das Volk Israel sehr schmerzhaft sein. Doch aus dieser Drangsalszeit wird ein treuer Überrest hervorgehen, der dem Herrn Opfergaben darbringen wird, die Er annehmen kann.
In Vers 5 zeigt Gott auf, dass das Versagen der Priester und die Ehen mit heidnischen Frauen längst nicht alles Böse war, das im Volk Gottes vorkam. Es gab auch Zauberer, Ehebrecher und falsch Schwörende. Zudem wurden die Schwachen in der Gesellschaft unterdrückt. Vor allem fehlte die Gottesfurcht.
Gott droht und warnt. Doch Er erklärt auch, dass Er nicht den Tod des Sünders will, sondern dass dieser sich bekehren und leben soll. In Vers 6 sagt der ewige Gott den Gläubigen seine Bewahrung zu. Den Überrest wird Er durch die Drangsal bringen, die Erlösten der Gnadenzeit jedoch vor der Drangsal bewahren.
Gott berauben
Gottes Urteil über das Volk Israel ist sehr schwer. Von Anfang an sind die Israeliten von den Satzungen des Herrn abgewichen. Nachdem Er das Volk aus Ägypten befreit hatte, forderte Er die Menschen zum Gehorsam auf und versprach ihnen seinen Segen (2. Mose 15,26). Doch sie lehnten sich gegen Ihn auf und machten ein goldenes Kalb. Trotzdem gab Er sie nicht auf, sondern rief sie in Gnade zur Umkehr auf – wie auch hier.
Gleichen wir Menschen nicht dem Volk Israel? Gott, unser Schöpfer, sagt etwas, und wir tun es nicht. Der Mensch von Natur will nicht das, was Gott will. Dennoch ruft uns der Heiland bis heute zu: «Tut Buße und glaubt an das Evangelium!»
Israel antwortete: «Worin sollen wir umkehren?» – Sind wir Christen manchmal nicht ebenso von uns selbst überzeugt, wenn Gott unser Versagen anspricht?
Der Herr verlangte von den Menschen aus Israel den Zehnten. Doch sie behielten ihn für sich und beraubten Gott, so dass Er den Fluch über sie bringen musste. Wenn sie Ihm das geben würden, was Ihm zustand, war Er bereit, aufs Neue zu segnen. – Wie steht es da mit uns Christen? Der Herr möchte unsere Zuneigungen, unser Herz haben. Manchmal denken wir jedoch nur an uns und vernachlässigen Ihn!
Die Juden haben dem Herrn auch keine Hebopfer gebracht. – Und wir? Sind wir sonntags nicht schon gleichgültig beim Brotbrechen gewesen? Wir waren da, aber wir haben Gott, dem Vater, nicht die Anbetung gebracht, die Er erwartete. Wir haben Ihn «beraubt», weil unser Herz nicht von Christus erfüllt war.
Ein gottesfürchtiger Überrest
Auf die Ermahnungen des Herrn durch den Propheten haben die Menschen stets mit rebellischen Fragen geantwortet. Sogar jetzt, wo Er sie auf ihre trotzigen Worte anspricht, bleiben sie die Antwort nicht schuldig. Frech fragen sie: «Was haben wir miteinander gegen dich beredet?» In seiner Langmut gibt ihnen Gott nochmals eine Antwort. Seine Worte zeigen, wie gut Er unser Herz kennt.
Sie dachten bei sich: Was bringt es mir, wenn ich dem Herrn nachfolge und Ihm diene? Was nützt es mir, wenn ich Buße tue? Von einer ähnlichen Einstellung lesen wir auch in 1. Timotheus 6,5. Dort ist von bösen, egoistischen Menschen die Rede, «die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn». Welch ein verwerflicher Gedanke!
Die zunehmende Treulosigkeit in Juda veranlasste die Treuen, sich miteinander zu besprechen, um sich gegenseitig die Hände zum Guten zu stärken. Sie versuchten in dieser schwierigen Situation, einen Gott wohlgefälligen Weg zu gehen. Weil sie Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott hatten, wollten sie nichts tun, was Ihm missfällt.
Von ihnen nimmt der Herr besonders Kenntnis. Das Gedenkbuch zeigt, wie wichtig das gottesfürchtige Verhalten dieses Überrests für Ihn ist. Diese Treuen sind dem Herzen Gottes ein besonderer Schatz. Er verschont sie, wenn «an dem Tag», d.h. am Tag des Herrn, das Gericht über die Gottlosen kommt. Ja, wenn der Herr an jenem Tag erscheinen wird, werden alle sehen, wie Er einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen macht (Matthäus 25,31-46).
Der Tag des Herrn kommt
Der kommende Tag ist der «Tag des Herrn». Dann wird der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen und an allen Übermütigen und Gottlosen ein schonungsloses Gericht ausüben. Für den gottesfürchtigen Überrest aus dem Volk Israel aber wird Er als die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Diese Treuen werden dann mit Ihm in den Segen des Tausendjährigen Reichs eingehen.
Wir Christen erwarten nicht den Tag des Herrn, sondern sein Kommen zur Entrückung. Für uns ist der Herr Jesus der glänzende Morgenstern. Wenn Er kommt, holt Er uns zu sich und bringt uns in das ewige Haus des Vaters, wo wir für immer daheim sein werden.
Für die Zeit vor dem Kommen des Herrn lenkt der Geist Gottes am Schluss des Buches unsere Blicke sowohl zurück als auch nach vorn. Das Gesetz ist das Wort von Gott, das Er seinem Volk am Anfang seiner nationalen Geschichte gegeben hat. Bei der Erwähnung von Elia geht es um eine Persönlichkeit, die in der Kraft und nach den Grundsätzen des historischen Propheten Elia auftreten und das Volk auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird.
Unser gegenwärtiges Leben als Christen orientiert sich ebenfalls an diesen zwei Seiten: am Wort Gottes, das Er niederschreiben liess, und am Kommen des Herrn zur Entrückung. Während wir Ihn erwarten, wollen wir uns in allen Belangen an die Bibel halten und dem Wort Gottes gehorchen.
Das Alte Testament schliesst mit der Erwähnung des Gerichts, während das Neue Testament mit einem Wort der Gnade endet (Offenbarung 22,21).
Einleitung
Die ersten 15 Kapitel des zweiten Buches Mose können wie folgt eingeteilt werden:
Kapitel 1: Die Unterdrückung Israels
Kapitel 2: Moses Geburt, Erziehung und Flucht
Kapitel 3 – 4: Gott gibt Mose einen Auftrag
Kapitel 5 – 6: Lass mein Volk ziehen!
Kapitel 7 – 11: Die zehn Plagen
Kapitel 12 – 13: Das Passah und der Auszug
Kapitel 14: Der Durchzug durch den Jordan
Kapitel 15: Das Lied der Erlösung
Das Volk Israel wird unterdrückt
Aufgrund der siebenjährigen Hungersnot war Jakob mit seinen Söhnen und ihren Familien zu Joseph nach Ägypten gezogen. Dort blieben sie auch, nachdem Jakob, Joseph und seine Brüder gestorben waren. Nun machte Gott sein Versprechen an Abraham wahr: Seine Nachkommen vermehrten sich in Ägypten sehr stark (1. Mose 12,2; 15,5; 22,17). Das ist zu unserer Ermutigung geschrieben. Wir dürfen uns vertrauensvoll auf alle Verheissungen Gottes stützen, die Er uns in seinem Wort gibt. Er wird sie alle erfüllen!
Bald veränderte sich die Situation für das wachsende Volk Israel zum Schlechten. Der neue ägyptische König, der keine Beziehung zu Joseph mehr hatte, sah in den zahlreichen Nachkommen Abrahams eine Bedrohung für sich und sein eigenes Volk. Darum setzte er Fronvögte über sie ein und bedrückte sie mit schwerer Sklavenarbeit. – Wir erkennen in Ägypten ein Bild der gottlosen Welt. Der Pharao stellt Satan dar, der Fürst und Gott dieser Welt ist (Johannes 14,30; 2. Korinther 4,4). Er bringt die Menschen durch die Sünde unter seine Herrschaft.
Die Israeliten mussten für den Pharao die Vorratsstädte Pithom und Raemses bauen. Durch diese Zwangsarbeit wurde ihr Leben hart und bitter. – So ist es auch mit den ungläubigen Menschen, die durch die Sünde und den Teufel beherrscht werden (Johannes 8,34; Hebräer 2,15). Sie leiden unter den Folgen ihres sündigen Lebens und unter den okkulten Belastungen. Aus eigener Kraft kommen sie davon nicht frei. Sie brauchen einen Erlöser.
Die hebräischen Hebammen
Der Pharao ging in der Bedrückung Israels noch einen Schritt weiter. Um eine weitere Ausbreitung dieses Volkes zu verhindern, befahl er den beiden Hebammen Schiphra und Pua, jedes männliche Kind der Israeliten nach der Geburt zu töten. – Diese grausame Absicht verfolgt auch der Teufel, wenn er die Menschen unter seine Gewalt bringt. Er stellt ihnen zwar manches Begehrenswerte in Aussicht, aber in Wirklichkeit ist er ein Menschenmörder (Johannes 8,44). Er verführt sie zur Sünde und stachelt sie zum Widerstand gegen Gott auf, um sie schliesslich ins Verderben zu treiben.
Die Hebammen gehorchten dem Pharao nicht. Warum? Weil sie gottesfürchtig waren! Sie wollten sich nicht gegen den Schöpfer versündigen, der das menschliche Leben gibt (Apostelgeschichte 17,25). Deshalb verwirklichten sie den wichtigen Grundsatz: «Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen.»
Der Herr beantwortete den Glauben von Schiphra und Pua auf eindrucksvolle Weise:
- Er bewahrte sie vor dem Pharao, indem Er ihnen die richtigen Worte in den Mund legte. So konnten sie sich vor dem ägyptischen Herrscher verantworten, ohne lügen zu müssen.
- Er belohnte ihre Gottesfurcht, indem Er ihnen Ehemann und Kinder schenkte. Sie besassen nun eine Familie, was damals wie heute ein grosser irdischer Segen ist.
Der Pharao gab seinen Widerstand gegen Israel noch nicht auf. Er befahl seinem eigenen Volk, jeden neugeborenen Sohn der Israeliten zu töten.
Das Kind Mose
Die Eltern von Mose kannten den Tötungsbefehl des Pharaos. Trotzdem sagten sie sich nicht: Jetzt können wir keine Kinder haben. Als Mose geboren wurde, erkannte die Mutter, dass er schön für Gott war (Apostelgeschichte 7,20). Zuerst verbarg sie ihn drei Monate, um ihn dem Zugriff des ägyptischen Königs zu entziehen. Als sie ihn nicht mehr versteckt halten konnte, legte sie ihn in einem wasserdichten Kästchen in den Nil.
Auch wir leben in einer gottlosen Welt, die unsere Kinder für sich gewinnen will. Darum können wir als Eltern viel aus dieser Geschichte lernen:
- Unsere Kinder sind wertvoll für Gott. Darum sollen wir sie nicht unnötig dem schädlichen Einfluss der Welt aussetzen.
- Im Vorschulalter haben wir die Möglichkeit, unsere Kinder vor der Welt abzuschirmen und ihnen durch biblische Geschichten den Herrn Jesus gross zu machen.
- Wenn unsere Kinder in die Schule gehen, sind sie den Gefahren der Welt ausgesetzt. Aber wir wissen, dass sie vom Herrn – der durch das Kästchen dargestellt wird – umgeben sind. Er kann sie bewahren.
In Hebräer 11,23 lesen wir, dass die Eltern von Mose im Gottvertrauen handelten. Sie wurden nicht enttäuscht. Der Herr beantwortete ihren Glauben und verschonte Mose vor dem Tod. In seiner Vorsehung sorgte Er sogar dafür, dass Mose die ersten Lebensjahre bei seinen Eltern verbringen durfte. Die Gottesfurcht, die in dieser Familie herrschte, wirkte sich auf sein ganzes Leben aus.
Mose tötet einen Ägypter
Zwischen Vers 10 und 11 liegen die Jahre, die Mose am Hof des Pharaos verbrachte und eine erstklassige Ausbildung erhielt. Was war das Resultat? «Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken» (Apostelgeschichte 7,22). Aus menschlicher Sicht war er nun bestens ausgerüstet, um eine grosse Aufgabe in der Welt zu erfüllen.
Aber in seinem Herzen lebte der Glaube an Gott und die Liebe zum Volk Gottes. Darum verzichtete er im Alter von 40 Jahren auf Ehre und Reichtum in der Welt. Er wollte nicht mehr als Sohn der Tochter Pharaos gelten, sondern ein echter Israelit sein. Bewusst stellte er sich auf die Seite dieses verachteten und versklavten Volkes (Hebräer 11,24-26). Diese Entscheidung war gut und richtig.
Doch der Zeitpunkt war für ihn noch nicht gekommen, als Retter seines Volkes aufzutreten. Auch seine Einstellung passte noch nicht zu seiner Aufgabe als Befreier und Führer Israels. Das wird aus unserem Abschnitt deutlich. Eigenwillig und unüberlegt tötete er den Ägypter, der einen israelitischen Mann geschlagen hatte. Doch damit änderte Mose nichts an der traurigen Lage seines Volkes. Seine Tat rief vielmehr das Unverständnis seiner Landsleute und den Hass des Pharaos hervor. So musste er ins Ausland fliehen.
Mose weist in seiner Person auf den Herrn Jesus hin, der als Retter zu seinem Volk gekommen ist. Obwohl Christus – im Gegensatz zu Mose – in Abhängigkeit von Gott den Menschen in Israel zum richtigen Zeitpunkt und in der rechten Gesinnung helfen wollte, lehnten sie Ihn ab.
Mose flieht nach Midian
Mose kam als Flüchtling nach Midian und setzte sich an einen Brunnen. Als er sah, wie die Töchter Reghuels beim Tränken ihres Kleinviehs von anderen Hirten belästigt wurden, setzte er sich für sie ein. Wieder betätigte er sich als Befreier und Helfer in der Not. Trotz seines Versagens in Ägypten hielt er im Glauben daran fest, dass Gott ihn als Retter gebrauchen wollte.
Doch der Herr musste ihn noch für seine grosse Aufgabe als Befreier Israels bereit machen. Dazu benutzte Er die Lebensumstände in den folgenden 40 Jahren. Als Hirte lernte Mose, dass Gott sein draufgängerisches Naturell nicht gebrauchen konnte. Stattdessen musste er mit den Tieren Geduld und nochmals Geduld lernen.
Mose blieb bei Reghuel und heiratete dessen Tochter Zippora. Darin erkennen wir wieder einen Hinweis auf den Herrn Jesus. Nachdem Ihn das Volk Israel als Retter abgelehnt hatte, bekam Er die Versammlung als seine Braut. Sie ist wie Er fremd auf der Erde und verachtet von der Welt.
Unterdessen nahm in Ägypten der Druck auf die Israeliten zu. Sie seufzten unter der Last der Sklavenarbeit und schrien wegen der ungerechten Behandlung. Gott hörte ihr Schreien und dachte an die Verheissungen, die Er ihren Vorfahren gemacht hatte. Nun wollte Er zu ihrer Errettung einschreiten.
In unserer Not beten wir zum gleichen Gott. Er hört auf uns, hält die Versprechungen in seinem Wort und kümmert sich um uns.
Der brennende Dornbusch
Mose lernte in der Wüste als Viehhirte während 40 Jahren manche Lektion für seine zukünftige Aufgabe als Führer Israels. Der Herr Jesus hielt sich 40 Tage in der Wüste auf, bevor Er seinen öffentlichen Dienst begann. Doch im Gegensatz zu Mose diente diese Zeit der Prüfung dazu, seine Vollkommenheit ans Licht zu stellen (Matthäus 4,1-11).
Der brennende Dornbusch, den Mose am Berg Horeb sah, stellte das Volk Israel dar, wie es in Ägypten bedrückt und geplagt wurde. Doch das Feuer der Prüfung und der Leiden konnte Israel nicht aufreiben. Warum? Weil der Herr mitten im Dornbusch war. Er hielt sein Volk in der Sklaverei Ägyptens aufrecht. – Genauso ist Gott bei uns und steht uns in den Schwierigkeiten bei. Er hat verheissen: «Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen» (Jesaja 43,2).
Zuerst musste Mose lernen, dass Gottes Gegenwart Heiligkeit erforderte. Dann hörte er, welche Pläne der Herr mit seinem bedrängten Volk hatte:
- Zuerst stellte Gott sich selbst vor. Er verband sich mit den Patriarchen, weil Er nun seine Verheissungen an sie wahrmachen wollte (Vers 6).
- Dann sprach Er über die elende Situation seines Volkes in Ägypten (Vers 7).
- Im Weiteren teilte Er Mose seine Pläne mit Israel mit. Er wollte sein Volk aus Ägypten befreien und in ein gutes, fruchtbares Land bringen (Vers 8).
- Schliesslich übertrug der Herr Mose die Aufgabe, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen (Vers 10).
Der Auftrag an Mose
Mose war zunächst nicht bereit, den Auftrag Gottes auszuführen. Von 2. Mose 3,11 – 4,17 lesen wir von vier Einwänden, die er dagegen vorbrachte.
Als Erstes sagte er: «Wer bin ich?» Wie sollte er diese grosse Aufgabe bewältigen können? Daraus wird deutlich, dass sich seine Einstellung in den vergangenen 40 Jahren total verändert hatte. Seine Selbstsicherheit war verschwunden. Die gnädige Antwort Gottes lautete: Ich werde mit dir sein! Was braucht ein Diener des Herrn mehr als den göttlichen Beistand?
Doch Mose war noch nicht überzeugt. Er machte einen zweiten Einwand: Was sollte er den Israeliten sagen, wenn sie fragten, was der Name Gottes sei, der ihn gesandt habe? Nun stellte sich Gott mit einem neuen Namen vor: «Ich bin, der ich bin.» Er ist der Ewige, der sich nie verändert. Als solcher wollte Er eine Beziehung zu Israel eingehen. Den Patriarchen hatte Er sich als der Allmächtige offenbart (1. Mose 17,1; 28,3). Für das Volk Israel war Er der Herr, d.h. Jahwe oder der ewig Seiende.
Um Mose Mut zu machen, teilte Gott ihm auch im Einzelnen mit, wie Er zugunsten der Israeliten handeln würde. Aus Gnade wollte Er sie aus Ägypten befreien und ins Land Kanaan bringen. Diese göttliche Gunst hatten sie nicht verdient. Sie konnten auch selbst nichts an ihrer elenden Situation ändern. Durch Wunder würde der Herr seine Macht entfalten, um den König von Ägypten zu zwingen, sein Volk ziehen zu lassen. – Wir lernen hier, dass niemand Gott daran hindern kann, seine Pläne auszuführen (Daniel 4,32).
Drei göttliche Zeichen
Der dritte Einwand von Mose lautete: «Sie werden mir nicht glauben.» Wieder begegnete der Herr in Gnade seinem schwachen Glauben. Er gab ihm mehrere Zeichen, die er vor dem Volk tun konnte. Sie offenbarten die Macht Gottes und bestätigten dadurch, dass der Herr seinen Diener Mose zur Befreiung Israels gesandt hatte.
Alle drei Wunder haben auch eine geistliche Bedeutung für uns. Im übertragenen Sinn ermutigen sie uns im Dienst für den Herrn:
- Der Stab Moses, der zur Schlange wurde, spricht von der Macht Gottes. Sie steht den Dienern des Herrn zur Verfügung, wenn sie mit der Macht Satans konfrontiert werden. Jederzeit können sie wissen: Gott ist stärker als der Teufel.
- Die Hand Moses, die zuerst aussätzig und dann wieder gesund wurde, lehrt uns, dass Gott Menschen von den Auswirkungen der Sünde heilen kann. Das ist besonders für Diener, die das Evangelium verkünden und verbreiten, eine grosse Ermutigung.
- Das Wasser aus dem Nil, das zu Blut wurde, spricht vom Gericht Gottes über die Welt. Seit der Kreuzigung seines Sohnes ist sein Urteil über sie ausgesprochen. Die Tatsache, dass die Welt dem Gericht entgegengeht, prägt unser Zeugnis und unseren Dienst.
Diese drei Zeichen weisen prophetisch auf Christus hin. Wenn Er öffentlich in Macht und Herrlichkeit auf der Erde erscheinen wird, wird Er der Herrschaft Satans ein Ende machen, sein irdisches Volk von den Auswirkungen der Sünde heilen und die gottlose Welt richten.
Mose will den Auftrag nicht ausführen
Mose war immer noch nicht bereit, nach Ägypten zu gehen und den Auftrag Gottes auszuführen. Er brachte einen vierten Einwand vor: «Ich bin kein Mann der Rede.» Als Schafhirt in der Wüste hatte er gelernt, dass geschulte Rhetorik nicht genügt, um im Auftrag des Herrn zu den Menschen zu reden. Die eigene Redegewandtheit kann das Wirken Gottes sogar behindern, weil sie den Diener in den Vordergrund stellt.
Die Antwort des Herrn ist zweiteilig: Zum einen hat Er als Schöpfer die Befähigung zum Reden gegeben. Zum anderen will Er seinen Dienern die Worte in den Mund legen, so dass sie sein Sprachrohr sein können.
Alle vier Einwände, die Mose gemacht hatte, waren seinem schwachen Glauben entsprungen. Doch Gott war gnädig auf sie eingegangen. Als sich Mose dennoch weigerte, den Auftrag zu übernehmen, offenbarten sich Eigenwille und Unglauben. Damit konnte der Herr keine Nachsicht haben. Er wurde zornig. Die Tatsache, dass Mose seinen Bruder als Helfer bekam, war aus göttlicher Sicht kein Vorteil. Aber sie kam dem mangelnden Gottvertrauen seines Dieners entgegen. In dieser Hinsicht gleichen wir ihm leider allzu oft: Wir stützen uns lieber auf menschliche Hilfe als auf göttliche Versprechen.
Mose nahm von seinem Schwiegervater Abschied und machte sich mit seiner Familie auf die Reise nach Ägypten. Bevor er loszog, erklärte ihm der Herr, dass alle, die nach seinem Leben getrachtet hatten, gestorben waren. Mit welcher Geduld und Rücksichtnahme ging doch Gott mit seinem Diener um!
Mose kehrt nach Ägypten zurück
Noch bevor Mose in Ägypten ankam, bereitete der Herr ihn durch weitere Mitteilungen für seine Aufgabe vor:
- Israel besass in den Plänen Gottes mit der Erde einen bevorzugten Platz. Es sollte von Ihm – wie damals der erstgeborene Sohn in einer Familie – einen besonderen Segen bekommen.
- Trotz der Wunder würde der Pharao sein Herz verhärten und Israel nicht ziehen lassen. Sein Widerstand gegen dieses bevorrechtigte Volk würde seinem erstgeborenen Sohn das Leben kosten.
Auf der Reise nach Ägypten musste der Herr auch noch etwas in der Familie von Mose korrigieren. Die Eltern hatten ihren Sohn nicht beschnitten, obwohl Gott die Beschneidung Abraham und seinen Nachkommen verordnet hatte (1. Mose 17,9-14). Als der Herr erziehend einschritt, begriff Zippora sofort, wo die Ursache dafür lag. Ohne zu zögern, erfüllte sie die bis dahin vernachlässigte Verordnung der Beschneidung. Wir lernen aus dieser Begebenheit zweierlei:
- Wer es als Vater in der Familie an Gottesfurcht und Gehorsam fehlen lässt, kann nicht für das Volk Gottes Sorge tragen (1. Timotheus 3,4.5).
- Ein konsequentes Selbstgericht, das durch die Beschneidung dargestellt wird, ist Voraussetzung für jeden segensreichen Dienst.
Das Zusammentreffen von Mose und Aaron war von Liebe und Einmütigkeit geprägt. Gemeinsam gingen sie zu ihrem Volk und erlebten, wie es positiv auf die Worte Aarons und die Zeichen Moses reagierte. Es glaubte ihnen und betete Gott an, der Israel einen Retter gegeben hatte.
Der Pharao erhöht den Druck
Nun gingen Mose und Aaron zum ersten Mal zum Pharao. Sie hatten eine Mitteilung Gottes an ihn: «Lass mein Volk ziehen!» – Auch wir haben eine Botschaft von Gott an die ungläubigen Menschen. Wir bitten sie an Christi statt: «Lasst euch versöhnen mit Gott!»
Doch der Pharao wollte die Autorität des lebendigen Gottes nicht anerkennen. Frech fragte er: «Wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören soll?» – So sprechen auch heute viele Menschen. Sie zweifeln an der Existenz Gottes und fragen ungläubig: Wo ist der Gott der Bibel?
Der Pharao schenkte der Bitte von Mose kein Gehör, weil er nicht an Gott glaubte. – Wer nicht an Gott glaubt, ist auch nicht bereit, sein Wort zu befolgen, sondern führt das Leben nach eigenem Gutdünken.
Anstatt die Israeliten ziehen zu lassen, erhöhte der Pharao den Druck auf sie. Sie mussten ab sofort das Stroh für die Herstellung der Ziegel selbst sammeln. Trotz dieser zusätzlichen Arbeit waren sie verpflichtet, jeden Tag gleich viele Ziegel wie zuvor herzustellen.
Der Pharao stellt nicht nur einen ungläubigen Menschen dar, der die Existenz Gottes infrage stellt. Er ist auch ein Bild von Satan, der keinen Menschen freigeben will. Wenn der Geist Gottes durch das Wort an einem Sünder wirkt, um ihn zur Buße und zur Errettung zu führen, erhöht der Teufel seinen Druck. Die Lage eines solchen Menschen, der seine Sünden zwar einsieht, sich aber noch nicht bekehrt hat, ist wirklich schlimm. Er fühlt seine Sündenlast und seine Gebundenheit zutiefst.
Die Not wird grösser
Als die Bedrängnis der Israeliten grösser wurde, gingen ihre Vorsteher zum Pharao und beklagten sich über ihr schweres Los. Doch der ägyptische Herrscher schenkte ihnen kein Gehör. Als sie beim Pharao nichts erreichen konnten, beschwerten sie sich bei Mose und Aaron. Waren nicht diese beiden Männer Schuld daran, dass die Israeliten geschlagen wurden, weil sie die zusätzliche Arbeit nicht schafften?
Mose wandte sich in seiner Not an den Herrn und schüttete sein Herz vor Ihm aus. Er konnte auch nicht verstehen, warum sein Vorstoss beim Pharao gerade das Gegenteil von dem bewirkte, was Gottes Absicht war. Anstatt freizukommen, wurde das Volk Israel noch mehr bedrückt.
Mose bekam vom Herrn eine Antwort. Obwohl es danach aussah, als ob alles in die verkehrte Richtung lief, führte Gott seinen Plan mit Israel doch Schritt für Schritt aus. Auch der erhöhte Widerstand des Pharaos gehörte dazu.
- Der Herr benutzte diesen Druck, um dem Volk Israel das Elend, in dem es sich befand, deutlich vor Augen zu führen.
- Diese ausweglose Situation sollte auch den Diener Mose dazu bringen, im Glauben alles vom allmächtigen Gott zu erwarten.
- Schliesslich nahm der Herr die hartnäckige Gegenwehr des Pharaos zum Anlass, um seine Macht auf deutliche Weise zu entfalten.
Für uns lernen wir daraus, dass Gott in unserem Leben alle Dinge zum Guten mitwirken lässt (Römer 8,28).
Gott ermutigt Mose
Um seinen niedergeschlagenen Diener zu ermutigen, stellte sich Gott als der Herr (Jahwe) vor, der als Bundesgott Israels zugunsten dieses Volkes handeln würde. Dann wies Er Mose auf seine Verheissungen an die Patriarchen hin, die Er nun erfüllen wollte.
Ab Vers 6 gibt der Herr seinem versklavten Volk ein siebenfaches Versprechen, das im übertragenen Sinn den Segen des Evangeliums Gottes beschreibt:
- Ich werde euch unter den Lastarbeiten der Ägypter weg herausführen. – Wer an den Herrn Jesus glaubt, wird aus der Welt herausgenommen (Galater 1,4).
- Aus ihrem Dienst werde ich euch erretten. – Alle, die sich zu Gott bekehren, sind von der Sklaverei Satans befreit worden (Hebräer 2,15).
- Mit ausgestrecktem Arm werde ich euch erlösen. – Durch den Glauben an den Opfertod des Heilands werden wir von der Macht der Sünde erlöst (Römer 6,18).
- Ich will euch mir zum Volk annehmen. – Wer sich in der Zeit der Gnade bekehrt, gehört zum himmlischen Volk Gottes (1. Petrus 2,9).
- Ich will euer Gott sein. – Jeder Erlöste kommt in eine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott.
- Ich werde euch in das Land Kanaan bringen. – Als Glaubende sind wir in eine himmlische Stellung versetzt worden (Epheser 2,6).
- Dieses Land werde ich euch zum Besitz geben. – Gott hat allen Erlösten in Christus geistliche Segnungen geschenkt (Epheser 1,3).
Leider hörten die Israeliten nicht auf diese herrlichen Zusagen Gottes.
Der Stammbaum von Mose und Aaron
An dieser Stelle fügt der Geist Gottes den Abstammungsnachweis von Mose und Aaron ein. Ihre Vorfahren und Familien werden detailliert angegeben.
Zuerst werden die drei ältesten Söhne Jakobs erwähnt: Ruben, Simeon und Levi. Alle drei führten ihr Leben nicht zur Ehre Gottes. Darum hatte Jakob in seinem Segen an die zwölf Söhne nichts Gutes über sie zu sagen (1. Mose 49,3-7).
Bei den Nachkommen Levis triumphierte jedoch die Gnade Gottes über die Sünde. Der Herr konnte aus diesem Stamm zwei Männer als seine Diener gebrauchen: Mose, den Gesetzgeber, und Aaron, den Priester. Bei der Sünde mit dem goldenen Kalb stellte sich dann der ganze Stamm treu auf die Seite Gottes (2. Mose 32,26-29). Als Folge davon sonderte der Herr die Leviten anstelle aller Erstgeborenen für sich ab und gab ihnen die Aufgabe am Zelt der Zusammenkunft (4. Mose 3,5-13).
Hier werden die gottesfürchtigen Eltern von Mose zum ersten Mal mit Namen genannt. Amram und Jokebed gehörten beide zum Stamm Levi. Elischeba, die Frau Aarons, hingegen stammte von Juda ab. Ihr Vater Amminadab und ihr Bruder Nachschon gehörten zur königlichen Linie in diesem Stamm (4. Mose 2,3; Matthäus 1,4). Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen der priesterlichen und der königlichen Familie gab es auch später (2. Chronika 22,11).
Mose war aufgrund des Widerstands vom Pharao immer noch mutlos. Wie sollte der ägyptische Herrscher überhaupt auf ihn, der nicht gut reden konnte, hören?
Der Stab Aarons wird zur Schlange
Der Herr begegnete nun dem Kleinglauben von Mose mit einem klaren Auftrag: «Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde.» Die Folgen, die daraus entstanden, konnte er Gott überlassen. Der Herr selbst würde dann die Sache in die Hand nehmen, den Pharao richten und das Volk Israel befreien.
In Vers 6 heisst es von Mose und Aaron: «So wie der Herr ihnen geboten hatte, so taten sie.» Sie gehorchten einfach Gott und überliessen alles Weitere Ihm. Der Hinweis auf ihr Alter macht klar, dass Mose nun ein anderer Mensch war als vor 40 Jahren. Damals hatte er nicht nach dem Willen Gottes gefragt, sondern eigenmächtig einen Ägypter getötet. Jetzt aber hörte er auf die Anweisungen Gottes und gehorchte Ihm.
Aus diesem Abschnitt ergeben sich zwei wichtige Lektionen für jeden Diener des Herrn:
- Es erfordert Abhängigkeit von Gott, damit wir das sagen können, was Er uns aufträgt.
- Wenn wir unseren Eigenwillen verurteilen und Gott gehorchen, sind wir nützliche Mitarbeiter.
Mose und Aaron traten erneut vor den Pharao. Diesmal wirkten sie ein Wunder, um die göttliche Forderung zur Freilassung des Volkes Israel zu unterstreichen. Aaron warf den Stab hin und er wurde zur Schlange. Als die Zauberer Ägyptens dieses Wunder in der Kraft Satans nachahmten, verhärtete sich das Herz des Pharaos. Die Macht Gottes beeindruckte ihn nicht, weil auch der Teufel seine Macht demonstrierte. – In der christlichen Zeit versucht der Feind ebenfalls durch Nachahmung dem Wirken Gottes zu widerstehen (2. Timotheus 3,8).
Das Wasser des Nils wird zu Blut
Die verhärtete Herzenseinstellung des Pharaos löste eine Reihe von Plagen aus, die Not und Tod über Ägypten brachten. Sie weisen prophetisch auf die Strafgerichte hin, die in der zukünftigen Drangsalszeit die Menschen auf der Erde treffen werden.
Auf diese Plagen reagierte der Pharao mit erneuter Unnachgiebigkeit. Erst nach dem Gericht über die Erstgeborenen im Land Ägypten liess er das Volk Israel ziehen. Eine ähnliche Reaktion werden die Ungläubigen in der Zukunft zeigen, wenn das göttliche Gericht sie heimsuchen wird: «Sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken» (Offenbarung 16,11).
Bevor die erste Plage über Ägypten kam, wiederholten Mose und Aaron die göttliche Forderung vor dem Pharao: «Lass mein Volk ziehen!» Dann nahm Aaron den Stab und streckte seine Hand über alle Flüsse, Kanäle und Teiche Ägyptens aus. Da wurde alles Wasser zu Blut. Die Fische im Nil starben und die Menschen hatten nichts mehr zu trinken. Diese Notsituation hielt sieben Tage an. Doch der ägyptische Herrscher blieb innerlich davon unberührt, weil seine Wahrsagepriester ebenfalls Wasser in Blut verwandeln konnten. In Vers 23 heisst es: «Der Pharao wandte sich um und ging in sein Haus und nahm auch dies nicht zu Herzen.»
Wie traurig, wenn sich die Menschen dem Wort und Wirken Gottes verschliessen! Schon Elihu sagte: «In einer Weise redet Gott und in zweien, ohne dass man es beachtet» (Hiob 33,14).
Die Froschplage
Als zweite Plage kamen zahlreiche Frösche aus allen Gewässern und bedeckten das Land Ägypten. Sie drangen überall ein und belästigten die Menschen. Wieder konnten die ägyptischen Zauberer dieses Wunder nachahmen. Doch es gelang ihnen nicht, die Invasion der Frösche zu stoppen.
Der Pharao wollte von diesem Übel befreit werden. Deshalb versprach er, das Volk Israel ziehen zu lassen, wenn die Froschplage aufhören würde. Mose versuchte nun dem ägyptischen König klarzumachen, dass alles von der Macht des Herrn abhing. Darum sollte der Pharao den Zeitpunkt festlegen, an dem die Frösche die Menschen nicht mehr belästigen sollten. Er würde dann erkennen, dass Gott eingegriffen und der Plage gewehrt hatte.
Als der Herr das Gebet von Mose erhörte und die Frösche starben, war der Pharao erleichtert. Aber er hielt sein Wort nicht. Anstatt Gottes Allmacht anzuerkennen und das Volk Israel freizulassen, verstockte er sein Herz.
Dieses Verhalten des ägyptischen Königs ist leider kein Einzelfall. Gott hat schon manche Menschen in Notsituationen, vielleicht sogar in Lebensgefahr, gebracht, um sie zur Buße und zur Umkehr zu führen. In ihrer ausweglosen Lage haben sie angefangen zu beten. Sie haben zu Gott gerufen und Ihm versprochen, ihr Leben zu ändern. Als Er auf sie gehört und sie aus der Schwierigkeit befreit hat, was ist dann geschehen? Da haben sie ihr Versprechen vergessen und sind zur Tagesordnung übergegangen. Damit haben sie Gott beleidigt und ihr Herz für das Evangelium verhärtet.
Stechmücken und Hundsfliegen
Die dritte Plage folgte ohne Ankündigung an den Pharao. Aaron schlug mit dem Stab auf die Erde, so dass aller Staub zu Stechmücken wurde. Diese Insekten quälten Menschen und Tiere im Land Ägypten.
Auch dieses Mal versuchten die Wahrsagepriester mithilfe okkulter Kräfte das Wunder zu kopieren. Aber es gelang ihnen nicht. Warum? Weil weder Satan noch der Mensch Leben hervorbringen kann. Nur Gott ist in der Lage, aus einer toten Materie etwas Lebendiges zu schaffen. Das war sogar diesen ägyptischen Gelehrten klar, die mit dem Teufel in Verbindung standen. Darum erklärten sie: «Das ist Gottes Finger!» Doch diese verstandesmässige Überzeugung von einer höheren Macht, die dieses Wunder gewirkt hatte, veränderte weder in ihren Herzen noch im Herzen des Pharaos etwas.
Bevor die vierte Plage über Ägypten kam, sollte Mose die Forderung Gottes vor dem Pharao wiederholen: «Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen!» Doch der verhärtete Herrscher war nicht dazu bereit. Da kamen Hundsfliegen und plagten das ägyptische Volk. Das Volk Gottes, das im Land Gosen wohnte, wurde davon verschont. Zum ersten Mal lesen wir, dass Gott einen Unterschied zwischen den Israeliten und den Ägyptern machte.
Das wird auch in der zukünftigen Gerichtszeit so sein. Gott wird den glaubenden Überrest aus Israel mitten in der Drangsal für sich bewahren. Als Folge davon erklärt Er in Maleachi 3,18: «Ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient.»
Der Pharao verstockt sein Herz
Unter dem Druck der Umstände war der Pharao bereit, ein Zugeständnis zu machen. Weil ihm durch die Plagen klar wurde, dass er im offenen Kampf gegen Gott keinen Erfolg hatte, versuchte er das Volk Israel mit List unter seinem Einflussbereich zu behalten. Er schlug Mose und Aaron vor, sie sollten ihrem Gott im Land Ägypten opfern.
Doch Mose ging nicht auf diesen Vorschlag ein. Er erkannte, dass ein Gottesdienst mitten in einer götzendienerischen Umgebung unweigerlich zu einer Vermischung führen würde. Deshalb bestand er auf einer klaren Trennung von Ägypten: «Drei Tagereisen weit wollen wir in die Wüste ziehen.»
Die gleiche List, die Mose damals durchschaute und ablehnte, hat Satan mit Erfolg in der Christenheit angewandt. Er hat dafür gesorgt, dass die Christen in der Welt einen anerkannten Platz bekamen. Dann durchmischte er den christlichen Gottesdienst mit weltlichen Grundsätzen. Aus diesem Grund erfordert heute die Gott gemässe Anbetung am Tisch des Herrn nicht nur eine klare Trennung vom heidnischen Götzendienst (1. Korinther 10,14-22), sondern auch eine entschiedene Absonderung von der christlichen Welt (2. Timotheus 2,19-22).
Weil die Plage der Hundsfliegen schwer auf den Ägyptern lastete, bat der Pharao: «Fleht für mich!» Obwohl Mose dahinter eine trügerische Absicht vermutete, flehte er zum Herrn, so dass die Hundsfliegen verschwanden. Da wollte der Pharao vom Auszug der Israeliten nichts mehr wissen.
Die Pest und die Blatterngeschwüre
Gott änderte seine Forderung gegenüber dem Pharao nicht. Wieder liess Er ihm sagen: «Lass mein Volk ziehen!» Weil der ägyptische König nicht darauf einging, brachte der Herr als fünfte Plage eine Pest über das Vieh der Ägypter. Ihre Tiere starben an dieser Epidemie. Das Vieh der Israeliten war jedoch nicht davon betroffen. Es blieb am Leben, wie sich der Pharao durch seine Boten davon überzeugen konnte. Trotzdem weigerte er sich, der Aufforderung Gottes Folge zu leisten.
Das sechste Gericht traf die Ägypter wieder unangekündigt. Als Mose vor den Augen des Pharaos den Ofenruss zum Himmel streute, brachen an Menschen und Vieh Blattern-Geschwüre auf. Auch die Wahrsagepriester, die dem ägyptischen Herrscher als Ratgeber dienten, wurden von dieser Krankheit befallen. Nun konnten sie nicht mehr vor Mose stehen und den Pharao nicht mehr im Widerstand gegen Gott unterstützen.
Bis jetzt haben wir fünfmal gelesen, dass der König von Ägypten sein Herz verhärtete oder verstockte (2. Mose 7,13.22; 8,11.15.28). Nun folgt in Vers 12 die schwerwiegende Aussage: «Der Herr verhärtete das Herz des Pharaos.» Wir wissen, dass Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und gross an Güte ist (Psalm 103,8). Aber wenn die Menschen die Gelegenheiten, die Er ihnen zur Buße und Umkehr gibt, nicht nutzen, ist es für sie auf einmal zu spät. Gott verhärtet ihr Herz, so dass sie nicht mehr glauben können. Das ist eine ernste Warnung an alle, die von Kind auf das Evangelium gehört haben, sich aber nicht bekehren wollen.
Der Hagel
Nachdem der Herr das Herz des Pharaos verhärtet hatte, setzte Er ihn über die Absicht in Kenntnis, die Er mit den weiteren Plagen verfolgte:
- Der ägyptische Herrscher sollte persönlich erkennen, dass es auf der ganzen Erde niemand gibt, der so ist wie Gott (Vers 14).
- Der Pharao sollte für alle Zeiten ein Beispiel dafür sein, wie Gott sich an Menschen, die Ihm hartnäckig widerstehen, im Gericht verherrlicht (Vers 16).
Die siebte Plage war ein heftiger Hagelschlag. Noch nie hatte es in Ägypten so schlimm gehagelt – denn der Herr hatte dieses Unwetter für die Zeit der Bedrängnis aufgespart (Hiob 38,22.23). Durch die Ankündigung gab Gott den Menschen die Möglichkeit, sich und ihr Vieh vor dem Tod in Sicherheit zu bringen. Die Reaktion fiel unterschiedlich aus:
- Einige nahmen das Wort des Herrn ernst. Sie schützten ihre Knechte und ihr Vieh vor dem Hagelwetter.
- Andere reagierten gleichgültig auf die göttliche Mitteilung. Bei ihnen starben alle Menschen und alle Tiere, die vom Hagel getroffen wurden.
Auch heute kommt es darauf an, wie der Mensch auf die Botschaft des Evangeliums reagiert. Wenn er an das Wort Gottes glaubt und Jesus Christus als seinen Heiland annimmt, wird er vor der göttlichen Strafe gerettet.
In Vers 26 heisst es: «Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israel waren, war kein Hagel.» Diese Aussage lässt uns wieder an die zukünftige Gerichtszeit denken. Am Tag des Unglücks wird der Herr die Glaubenden aus dem Volk Israel bewahren (Psalm 91,9-11).
Der Pharao verhärtet sich
Das göttliche Gericht durch das Hagelwetter war so schwer, dass der Pharao unter dem Druck der Umstände bekannte: «Ich habe dieses Mal gesündigt.» Er rang sich zu diesem Bekenntnis durch, weil er danach verlangte, dass die Not aufhörte.
Aus der Antwort Moses in den Versen 29 und 30 wird zweierlei deutlich:
- Einerseits war er bereit, für die Ägypter zum Herrn zu rufen, damit der Hagel aufhöre. – Daraus lernen wir, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Er hört auf das Flehen der Menschen und hat keine Freude daran, sie zu plagen (Klagelieder 3,33).
- Anderseits war Mose keineswegs von einer echten Umkehr des Pharaos überzeugt. – Nur Gott erkennt sofort, ob jemand wirklich Buße tut und seine Sünden aufrichtig bekennt. Die Menschen hingegen können die Echtheit eines Bekenntnisses nur anhand des veränderten Verhaltens prüfen, das sich danach zeigt.
Mose hatte mit seinen Zweifeln recht. Als die Bedrängnis zu Ende war, verstockte der ägyptische Herrscher sein Herz und wollte das Volk Israel nicht ziehen lassen.
Wir lesen in der Bibel noch von anderen Menschen, die schnell ein Sündenbekenntnis abgelegt haben. Aber ihr weiteres Leben bewies, dass es nicht echt war und keine bleibende Umkehr bewirkte. Oft bedauerten sie nur die Folgen ihres Unrechts, sahen aber nicht ein, wie schwer ihre Sünde Gott beleidigt hatte. Beispiele dafür sind Bileam, Achan, Saul und Judas Iskariot (4. Mose 22,34; Josua 7,20; 1. Samuel 15,24; Matthäus 27,4).
Gott verstockt das Herz des Pharao
Mose und Aaron gingen wieder zum Pharao und stellten ihm im Auftrag des Herrn die ernste Frage: «Bis wann weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen?» Diese Frage deckt bis heute die Ursache auf, warum die Menschen das Evangelium nicht annehmen wollen. Sie weigern sich, die Autorität ihres Schöpfers über sich anzuerkennen und sich für ihre Sünden vor Ihm zu demütigen. Als Folge davon meinen sie, auch keinen Erretter nötig zu haben.
Als Gott durch seine Diener eine Heuschreckenplage ankündigte, versuchten die Knechte des Königs, ihn zum Nachgeben zu bewegen. Der Pharao liess Mose und Aaron tatsächlich nochmals zu sich rufen. Doch er machte ihnen ein listiges Angebot: «Zieht doch hin, ihr Männer, und dient dem Herrn.» Die Kinder sollten in Ägypten bleiben. Dann würden auch die Väter wieder dorthin zurückkehren.
Genauso versucht der Teufel heute die Alten von den Jungen zu trennen:
- Einerseits will er mit menschlichen Argumenten die Eltern davon abhalten, ihre Kinder in den christlichen Gottesdienst mitzunehmen.
- Anderseits bemüht sich der Feind, die Kinder in die Welt zu ziehen und sie dort festzuhalten, damit sie sich vom Glauben ihrer Eltern abwenden.
Nehmen wir uns wie Mose vor dieser doppelten List in Acht! Lasst uns mit unseren Jungen und mit unseren Alten im Namen des Herrn zusammenkommen und Ihn anbeten! Lasst uns mit unseren Kindern getrennt von der Welt leben!
Die Heuschreckenplage
Weil Mose und Aaron nicht auf den listigen Vorschlag des Pharaos eingingen, schickte er sie weg. Nun traf das achte Gericht Gottes ein: Eine schwere Heuschreckenplage vernichtete alles, was der Hagel nicht zerstört hatte. An den Bäumen und auf den Wiesen blieb nichts Grünes mehr übrig.
Von dieser Plage heisst es in Vers 14: «Vor ihnen sind nicht derart Heuschrecken gewesen wie diese, und nach ihnen werden nicht derart sein.» Das lässt uns an die zukünftige Gerichtszeit denken, die mit ähnlichen Worten beschrieben wird: «Dann wird grosse Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird» (Matthäus 24,21). Doch bevor diese Strafgerichte über die Erde hereinbrechen, wird der Herr Jesus wiederkommen und die Seinen in den Himmel entrücken (Offenbarung 3,10.11).
Wieder bekannte der Pharao: «Ich habe gesündigt gegen den Herrn, euren Gott, und gegen euch.» Auch dieses Bekenntnis war nicht echt, sonst hätte der Herr das Herz des ägyptischen Herrschers nicht verhärtet. – Wir lernen daraus, dass ein schön klingendes Bekenntnis, das nur aus hohlen Worten besteht, die Lage des betroffenen Menschen vor Gott verschlimmert.
Was mag wohl während dieser Zeit in den Herzen der versklavten Israeliten vorgegangen sein? Wurden sie vielleicht nach jeder Plage in ihrer Hoffnung enttäuscht, weil der Pharao nicht einlenkte? – Auch wir meinen in einer Notsituation, Gott müsse nun eingreifen und uns helfen. Aber seine Zeit ist oft nicht unsere Zeit. Dennoch wollen wir Ihm weiter vertrauen.
Die Finsternis
Ohne Vorwarnung an den Pharao brachte Gott die neunte Plage über Ägypten. Drei Tage lang war es im ganzen Land stockdunkel. Nur die Israeliten hatten Licht in ihren Wohnungen.
In der Symbolik von Finsternis und Licht liegt eine wichtige Belehrung. Die Welt, die nichts von Gott wissen will, ist durch moralische Dunkelheit gekennzeichnet. Diese Finsternis nimmt immer mehr zu. In der zukünftigen Gerichtszeit wird es in der Welt stockdunkel sein. Mit Gewalt wird jedes Licht der göttlichen Wahrheit ausgelöscht werden. Im Gegensatz zur Welt haben die Glaubenden zu allen Zeiten Licht, weil sie Gott kennen und seine Wahrheit ins Herz aufnehmen. Ist es nicht eine grosse Gnade, dass wir in einer dunklen Welt das göttliche Licht besitzen und sogar verbreiten können?
Nochmals war der Pharao zu einem gewissen Zugeständnis bereit: Das Volk Israel sollte in die Wüste ziehen und dort dem Herrn dienen, aber ihre Tiere sollten in Ägypten bleiben. Doch ohne ihr Kleinvieh und ihre Rinder konnten die Israeliten dem Herrn keine Opfer bringen. Darum gab Mose keinen Millimeter nach: «Nicht eine Klaue darf zurückbleiben.»
So ist es auch bei uns. Alles, was wir sind und haben, gehört Gott. Darum soll es nicht dazu verwendet werden, um in der Welt vorwärtszukommen. Im Gegenteil, Gott hat uns Fähigkeiten und Besitz anvertraut, damit wir sie dem Herrn zur Verfügung stellen. Nicht in einer gesetzlichen Einstellung, sondern aus Liebe zu unserem Erlöser dienen wir Ihm mit dem, was wir besitzen.
Ankündigung der letzten Plage
Der Herr wollte noch ein Strafgericht über den Pharao und über die Ägypter bringen. Diese zehnte Plage würde für das Volk Gottes die entscheidende Veränderung bringen:
- Die Israeliten würden als freie Menschen aus dem Land ihrer Knechtschaft ausziehen (Vers 1). Die Erlösung stand also kurz bevor.
- Vorher durften sie von den Ägyptern Gold und Silber fordern (Vers 2). Das war eine angemessene Entschädigung für ihre jahrelange Sklavenarbeit.
- Aufgrund des göttlichen Eingreifens zugunsten Israels würde niemand mehr wagen, dieses Volk zu beleidigen oder zu beschimpfen (Vers 7).
- Der Unterschied zwischen den Israeliten und den Ägyptern würde noch einmal deutlich zutage treten (Vers 7).
Dieses Mal konnte der Unterschied nicht durch einen göttlichen Machtbeweis herbeigeführt werden, wie es bei früheren Gelegenheiten der Fall gewesen war (2. Mose 8,18; 9,4.26; 10,23). Die Israeliten waren keine besseren Menschen als die Ägypter. Aber sie hatten ein Rettungsmittel vor dem Gericht an den Erstgeborenen.
Auch heute gilt: «Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes» (Römer 3,22.23). Der Gegensatz zwischen den Geretteten und den Verlorenen liegt im persönlichen Glauben an den Erlöser: «Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes» (Johannes 3,18).
Einleitung
An Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Erde, um in den Gläubigen zu wohnen. Mit seinem Kommen wurde die Versammlung gebildet, die aus allen Erlösten der Gnadenzeit besteht. Nun verkündigten die Apostel die Botschaft vom Kreuz und bezeugten die Auferstehung des Herrn Jesus. Viele Menschen nahmen das Evangelium im Glauben an. Aber die jüdische Führungsschicht in Jerusalem widerstand den Verkündigern der guten Botschaft und verfolgte die Jünger des Herrn. Ihre Feindschaft führte aber nur zur weiteren Ausbreitung des Evangeliums.
Die Apostelgeschichte kann wie folgt eingeteilt werden:
Kapitel 1
Die Himmelfahrt des Herrn Jesus
Kapitel 2 – 12
Der Dienst von Petrus mit den Elfen
- Der Aufruf zur Buße an die Juden
- Das Evangelium für alle Menschen
Kapitel 13 – 28
Der Dienst von Paulus mit Mitarbeitern
- Drei segensreiche Missionsreisen
- Gefangennahme und Reise nach Rom
Der Auferstandene bei den Jüngern
Die Apostelgeschichte ist der zweite Bericht, den der inspirierte Schreiber Lukas einem Mann mit Namen Theophilus sandte. Im ersten, dem Lukas-Evangelium, schildert er das Leben und den Dienst des Menschen Jesus Christus, der zugleich der Sohn Gottes ist. Jetzt geht es um die Apostel des Herrn und ihr Wirken.
Vers 1 fasst den Inhalt des Lukas-Evangeliums zusammen. Jener Bericht erzählt das in allem Gott wohlgefällige Leben unseres Erlösers und was Er die Menschen gelehrt hat. Er endet mit der Himmelfahrt des Herrn (Vers 2; Lukas 24,50.51).
Bevor Er in den Himmel zurückkehrte, gab Er seinen Aposteln bestimmte Anweisungen. Sie sollten in Jerusalem bleiben, bis der Heilige Geist – die Verheissung des Vaters – auf sie kommen würde. Nur in der Kraft des Geistes Gottes waren sie in der Lage, Zeugen für ihren Herrn und Heiland zu sein (Vers 8).
Um ein wirkungsvolles Zeugnis von einem auferstandenen Christus ablegen zu können, brauchten sie nicht nur den Heiligen Geist, sondern auch die Gewissheit, dass ihr Herr wirklich auferstanden war. Darum hat Er sich nach seinen Leiden während 40 Tagen «in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt». Es gibt absolut keine Zweifel darüber, dass Jesus Christus auferstanden ist und jetzt als Mensch im Himmel lebt (siehe auch 1. Korinther 15,4-8).
Das Reich Gottes ist der Bereich, wo Menschen sich Ihm unterwerfen und das tun, was Er möchte. Heute trägt es einen verborgenen Charakter. Im Tausendjährigen Reich wird es öffentlich sichtbar sein.
Die Himmelfahrt des Herrn
Die Apostel lebten immer noch im Gedanken an eine Aufrichtung des Reiches in Macht und Herrlichkeit. Sie mussten lernen, dass jene Zeit einmal kommen würde, aber nicht jetzt war. Für sie galt, dass sie nun als Zeugen des Herrn in die ganze Welt ausgehen sollten, aber in der Hoffnung und Erwartung leben durften: Jesus kommt wieder (Vers 11). Wann dies sein wird, darüber sagt uns die Bibel nichts Konkretes. Sie endet aber mit den Worten unseres Heilands: «Ja, ich komme bald.» Darauf dürfen wir antworten: «Amen, komm, Herr Jesus!» (Offenbarung 22,20).
Nachdem der Herr den Aposteln bezeugt hatte, dass der Heilige Geist auf sie kommen würde und sie Kraft für ihren Dienst empfangen sollten, kehrte Er in den Himmel zurück. Sie konnten dies verfolgen, bis eine Wolke Ihn vor ihren Augen wegnahm. Dieser letzte Blick auf Ihn gab ihnen die Überzeugung: Er lebt jetzt als Mensch im Himmel. Sobald sie Ihn mit ihren Augen nicht mehr sahen, brachten ihnen die Engel die tröstliche Botschaft, dass Er wiederkommen werde.
Mit diesem Trost im Herzen kehrten die elf Apostel nach Jerusalem zurück. In dem Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, warteten sie auf das Kommen des Heiligen Geistes. Wie füllten sie die Zeit aus? Indem sie einmütig im Gebet verharrten. Wie wichtig war ihnen jetzt diese Verbindung zum Himmel, nachdem ihr Herr nicht mehr leibhaftig bei ihnen war! Maria, die Mutter Jesu, wird hier zum letzten Mal ausdrücklich erwähnt. Auch seine leiblichen, früher ungläubigen Brüder waren jetzt dabei.
Matthias als Ersatz für Judas Iskariot
Diese Verse sind der inspirierte Bericht über die Wahl des zwölften Apostels, der an die Stelle von Judas Iskariot treten sollte. Sie fand vor dem Kommen des Heiligen Geistes statt, also vor Beginn der Zeit der Versammlung, in der wir heute leben. Das ganze Vorgehen erinnert an das Alte Testament, vor allem das Bestimmen durch das Los. Doch die wichtigen und nützlichen Hinweise in diesen Versen gelten auch für uns.
Als Petrus aufstand und zu reden begann, stützte er sich auf das geschriebene Wort Gottes und stellte sich unter seine Autorität. Möchten auch wir immer auf das hören, was die Bibel sagt. Die Schrift hatte das traurige Ende von Judas Iskariot prophetisch vorausgesagt. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass ein anderer sein Amt empfangen sollte (Psalm 109,8). Dem wollten die versammelten Gläubigen nun entsprechen.
Die Verse 21 und 22 nennen die Kennzeichen eines Apostels. Zwei Männer entsprachen ihnen. Einer wurde durchs Los erwählt. In diesem Sinn gab es nur diese zwölf von Gott anerkannten Apostel. Später berief Gott noch den Apostel Paulus, aber sonst keinen mehr. Heute gibt es diese apostolische Autorität nicht mehr.
Bevor die Versammelten die Entscheidung durch das Los trafen, beteten sie. Auch wir sollten unsere Entscheidungen nie unabhängig von Gott treffen.
Es fällt auf, dass Petrus hier vom Herrn Jesus spricht, was er früher nie getan hat. Möchten auch wir, wenn wir von unserem Erlöser reden, Ihn Herr Jesus nennen und nicht einfach von Jesus sprechen.
Die Entstehung der Versammlung
Der Tag der Pfingsten entsprach dem Fest der Wochen, das die Israeliten gemäss der Anweisung in 3. Mose 23 50 Tage nach der Darbringung der Erstlingsgarbe feiern sollten. Das erste der sieben Feste des Herrn, das Passah, spricht vom Tod unseres Erlösers, die Darbringung der Erstlingsgarbe von seiner Auferstehung. Das sieben Wochen später stattfindende Fest der Wochen ist ein Vorausbild auf das Herniederkommen des Heiligen Geistes und die Bildung der Versammlung. Hier in Apostelgeschichte 2 erfüllte sich dies.
Wir haben in diesen Versen ein einmaliges, von Gott bewirktes Ereignis. Der Heilige Geist kam als göttliche Person vom Himmel, um fortan in jedem Glaubenden und in der Versammlung, d.h. in der Gesamtheit aller Erlösten, zu wohnen (1. Korinther 6,19; 3,16). Das wird hier durch die Zungen von Feuer, die sich auf jeden Einzelnen der anwesenden Gläubigen setzten, und durch die Bemerkung, dass alle mit Heiligem Geist erfüllt wurden, vorgestellt.
In Apostelgeschichte 1,5 sprach der Herr von der Taufe mit Heiligem Geist. Diese geschah hier. Dadurch wurden alle Glaubenden miteinander zu einem Leib verbunden. Seither bilden sie eine Einheit. Jeder ist ein Glied an diesem Leib, der Herr Jesus ist das Haupt (1. Korinther 12,12-14; Epheser 4,15.16). Die Taufe mit Heiligem Geist ist ein einmaliges Ereignis. Wenn heute ein Mensch zum Glauben kommt, empfängt er den Heiligen Geist und wird ein Glied an diesem bereits bestehenden Leib. – Das Wunder des Redens in fremden Sprachen zeigte, dass Gott dahinter stand.
In Sprachen reden
Anlässlich des Pfingstfestes hatten sich Juden aus allen Teilen des Römischen Reichs in Jerusalem eingefunden. Sie befolgten damit eine Anordnung des mosaischen Gesetzes (5. Mose 16,16). Viele dieser Juden beherrschten das Hebräische wohl nicht so gut. Sie sprachen die Mundart der jeweiligen Gegend im Römischen Reich, in der sie wohnten. Und nun hörten sie auf einmal, wie ungelehrte Galiläer ihre Sprache redeten und die grossen Taten Gottes verkündigten. Man kann sich die Bestürzung und Verlegenheit, die unter ihnen herrschten, gut vorstellen.
Mit diesem Wunder übersprang Gott in seiner Gnade die Grenzen, die Er einst zur Eindämmung des Hochmuts des Menschen eingesetzt hatte. Damals in Babel verwirrte Gott die eine Sprache der Menschen, die sie bis dahin hatten (1. Mose 11,1-9). Auf diese Weise zeigte Gott den Juden, dass das Neue, das an jenem Tag entstand – die Einheit der Versammlung, bestehend aus allen Glaubenden –, von Ihm kam.
Die Gläubigen benutzten diese Sprachen nicht, um das Evangelium zu verkünden, sondern von den grossen Taten Gottes zu reden. Es war ein Lobpreis Gottes für sein gewaltiges Wirken. Die Verkündigung der frohen Botschaft finden wir ab Vers 14 in der Predigt von Petrus.
Es gab zwei unterschiedliche Reaktionen auf dieses Wunder Gottes: Verwunderung und Spott. Die einen fragten ernsthaft: «Was mag dies wohl sein?» Die anderen meinten spottend, die Jünger seien betrunken.
Petrus erklärt die Situation
Nun stand Petrus mit den anderen Aposteln auf, um den spottenden Juden eine Antwort zu geben. Es war der gleiche Mann, der einige Wochen zuvor aus Angst um sein Leben seinen Herrn dreimal verleugnet hatte. Jetzt zeigte er keinerlei Furcht. Es war der Heilige Geist, der ihm nun Mut und Kraft gab.
Was Petrus zu sagen hatte, ging vor allem die Juden in Judäa und Jerusalem an. Vermutlich kannten und verstanden sie diese fremden Sprachen gar nicht. Deshalb dachten sie, die Jünger seien betrunken. Doch dem war nicht so.
Als Grundlage für seine Erklärung über das, was soeben vorgegangen war, nahm Petrus eine Stelle aus dem Propheten Joel. Jener Abschnitt weist jedoch auf eine heute noch zukünftige Zeit hin, wo Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgiessen wird. Damals zu Pfingsten gab es ein ähnliches Ausgiessen. Es beschränkte sich aber auf die versammelten Gläubigen. Petrus nahm diese alttestamentliche Stelle und machte durch die Weisheit Gottes eine Anwendung dieser Weissagung.
Wichtig ist der letzte Vers des Zitats aus dem Propheten Joel (Vers 21). Er wird auch in Römer 10,13 zitiert und dort auf die heutige Zeit angewandt. Die Aufforderung, den Namen des Herrn anzurufen, um errettet zu werden, richtet sich an alle Menschen. Doch man kann den Namen des Herrn nicht mit einem blossen Lippenbekenntnis anrufen. Um errettet zu werden, muss es ein Ruf echten Glaubens sein.
Petrus spricht über Jesus Christus
Mit Vers 22 kommen wir zum zentralen Thema der Predigt von Petrus. Es geht um den Herrn Jesus; zunächst um sein Leben, das den Zuhörern bekannt war. Aber dann stellt er den Kreuzestod von Christus vor und zeigt dabei zwei Seiten auf: den Ratschluss Gottes und die Verantwortung des Menschen.
Der Herr Jesus ist das Lamm ohne Fehl und ohne Flecken, «zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt». Als Gott in seiner Liebe seinen eingeborenen Sohn gab, gab Er ihn als Opfer für sündige Menschen in den Tod am Kreuz. Nur auf Grund dieses Opfertodes konnte sein Plan – Sünder zu begnadigen und sie zu seinen geliebten Kindern zu machen – in Erfüllung gehen.
Doch die Menschen, die den Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen und umgebracht haben, sind trotzdem für ihr Tun voll verantwortlich. So sollte der zweite Teil von Vers 23 das Gewissen der Zuhörer aufrütteln.
Aber dann fährt Petrus fort und spricht von der Auferstehung des Herrn Jesus. David hatte diese in Psalm 16 bereits prophetisch angekündigt. Petrus und die bei ihm stehenden Apostel waren Zeugen der Auferstehung von Jesus Christus. Nach seiner Rückkehr zum Vater hatte Dieser nun den Heiligen Geist ausgegossen – «was ihr seht und hört». Christus aber, den die Juden gekreuzigt hatten, nimmt bei Gott den Ehrenplatz zu seiner Rechten ein. Gott hat Ihn – den auferstandenen und verherrlichten Menschen – sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Diese offizielle Stellung nimmt Er jetzt ein.
Petrus ruft zur Buße auf
Die Predigt von Petrus verfehlte ihre Wirkung nicht. Seine unter der Leitung des Geistes ausgesprochenen Worte drangen den Zuhörern durchs Herz. Sie trafen ihr Gewissen. Was sollten sie tun, nachdem ihnen klar geworden war, dass sie ihren Messias gekreuzigt hatten? Gab es noch Hoffnung für sie? Ja, Gott sei Dank!
Petrus konnte ihnen auf ihre bange Frage sofort eine klare Antwort geben. Sein erstes Wort lautete: «Tut Buße!» Buße ist eine Sinnesänderung. Die Juden mussten die Schwere ihrer begangenen Sünde – die Kreuzigung von Christus – einsehen und zutiefst empfinden. Dann sollten sie sich durch die Taufe bewusst und öffentlich auf die Seite des Herrn Jesus stellen, den sie bis dahin verworfen hatten. So konnten sie in den Genuss der Vergebung ihrer Sünden kommen. Die gläubig gewordenen Juden mussten sich entschieden zu dem von ihrem Volk Gekreuzigten bekennen, um den Heiligen Geist zu empfangen. Bei den Menschen aus den Nationen, die Buße tun und an den Heiland glauben, erfolgt der Empfang des Heiligen Geistes als Antwort auf ihren Glauben (Apostelgeschichte 10,43.44).
Wenn es in Vers 41 heisst: «Die nun sein Wort aufnahmen …», dann bedeutet das: Sie glaubten dem Wort, das sie gehört hatten. Sie stellten sich bewusst und im Vertrauen auf die Seite des Gekreuzigten, indem sie sich taufen liessen. An jenem Tag wurden etwa 3000 glaubende Menschen zur Versammlung Gottes, die erst seit einigen Stunden bestand, hinzugefügt. So begann das christliche Zeugnis zu wachsen.
Die Gemeinschaft der ersten Christen
Die vier in Vers 42 genannten Stücke waren den ersten Christen wichtig. Darin verharrten sie. Die Lehre der Apostel wurde damals in mündlicher Form weitergegeben. Heute besitzen wir sie im Neuen Testament in schriftlicher Form. Verharren wir in dieser einen Lehre, die Gott uns durch die inspirierten Schreiber hinterlassen hat? Oder richten wir uns nach den Meinungen und Lehren der Menschen? Sie verharrten auch in der Gemeinschaft, d.h. sie wollten miteinander den Weg des Glaubens gehen. Am Anfang haben die Gläubigen täglich das Brot gebrochen, später wurde es zur Gewohnheit, dies am ersten Tag der Woche zu tun (Apostelgeschichte 20,7). Durch das Brotbrechen wird einerseits die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander und mit dem Herrn Jesus ausgedrückt (1. Korinther 10,16.17). Anderseits halten wir beim Brotbrechen das Gedächtnismahl des Herrn. Wir denken an Ihn, der für uns gestorben ist (1. Korinther 11,23-26). Der vierte Punkt ist das gemeinsame Gebet. Deshalb kommen wir auch heute noch regelmässig zum Gebet zusammen. Lasst uns keine Gebetsstunde versäumen!
In der ersten Frische ihres Glaubenslebens waren die Christen beisammen und teilten das, was sie besassen, mit den anderen. Was sie auszeichnete, war die Freude und die Schlichtheit ihrer Herzen. So stieg Lob zu Gott auf, und die Mitmenschen achteten sie.
Am Anfang des christlichen Zeugnisses gab es eine klare Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen (Vers 43; Apostelgeschichte 5,13). Täglich bekehrten sich Menschen, indem sie an den Herrn Jesus glaubten.
Ein Gelähmter wird geheilt
Am Anfang der christlichen Zeitperiode wirkte Gott durch die Apostel manche Wunder und Zeichen (Apostelgeschichte 2,43). Ein solches wird in diesen Versen beschrieben. Damit wollte Gott vor allem die Juden ansprechen (1. Korinther 1,22). Das sehen wir hier besonders, denn die Heilung dieses gelähmten Mannes führte Petrus dazu, eine Predigt zu halten, die speziell an das jüdische Volk gerichtet war.
In der Anfangszeit waren die Christen noch sehr mit dem Tempeldienst verbunden. So sehen wir hier auch die Apostel Petrus und Johannes, wie sie um die Stunde des Gebets in den Tempel gingen. Gott hatte Geduld, aber Er wollte die Christen, die der Abstammung nach Juden waren, ganz vom jüdischen Gottesdienst lösen und sie in das «Bessere» des Christentums einführen. Das sehen wir besonders im Brief an die Hebräer.
Als die beiden Apostel den armen Bettler an der Tempelpforte sahen, gaben sie ihm kein Almosen, wie er es von ihnen erbat. Sie schenkten ihm viel mehr. In dem Namen Jesu Christi, dieses verachteten und von den Juden gekreuzigten Menschen, der aber auferstanden war und jetzt im Himmel lebt, sprachen sie ihm Heilung zu. «Sogleich aber wurden seine Füsse und Knöchel stark, und er sprang auf, stand da und ging umher.» Nun trat er selbst in den Tempel und lobte Gott.
Viele Menschen konnten dieses Wunder mit eigenen Augen verfolgen. Der Mann wurde dem ganzen Volk zu einem lebendigen Zeugen von der Macht des auferstandenen Christus. Sie erstaunten und waren verwirrt. War das alles?
Die Schuld der Juden
Als der Geheilte seine Wohltäter festhielt, entstand ein Volksauflauf. Alles lief zusammen, um von dieser Sensation etwas mitzubekommen. Das bot dem Apostel Petrus die Gelegenheit, eine ernste und eindringliche Rede an das Volk – die Männer von Israel – zu halten.
Als Erstes lenkte er die Blicke der Menge von sich weg auf den Herrn Jesus. Nicht die Apostel hatten etwas aus ihrer Kraft und Frömmigkeit bewirken können. Sie waren nur Werkzeuge in der Hand eines Höheren und wollten alles vermeiden, diese Person – Jesus Christus – zu verdunkeln. Petrus begann seine Rede mit dem Gott ihrer Väter, dem Gott des Volkes Israel. Er hat seinen Knecht Jesus verherrlicht – diesen Menschen, der gleichzeitig sein Sohn war, der hier zum Wohlgefallen Gottes gelebt hatte und am Kreuz gestorben war.
Doch dann redete Petrus seinen Zuhörern direkt ins Gewissen. Sie hatten Jesus überliefert. Sie hatten den Heiligen und Gerechten verleugnet und seinen Tod gefordert. Das war ihre Seite.
Gott aber hatte den Urheber des Lebens aus den Toten auferweckt. Sie – die Apostel – waren Zeugen dieser Auferstehung und forderten ihre Zuhörer nun zum Glauben an diese Person auf. Der Gelähmte war aufgrund des Glaubens an diesen Namen gesund geworden. Wenn heute an einem Menschen das Wunder der Errettung geschehen soll, dann geht dies nur durch Glauben. «Durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es» (Epheser 2,8).
Das Gnadenangebot Gottes
Weil der Herr bei seiner Kreuzigung gebetet hatte: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun» (Lukas 23,34), konnte Petrus seinen Zuhörern sagen: «Ich weiss, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt», und ihnen Worte der Barmherzigkeit sagen.
Wie wollte Gott diesem Volk gegenüber barmherzig sein? Petrus rief sie zur kollektiven Buße und zur Umkehr auf. Gott gab den Juden nochmals eine Chance. Er verhiess ihnen Zeiten der Erquickung, wenn sie ihre Sünden einsehen – vor allem die Kreuzigung ihres Messias – und von ihren bösen Wegen umkehren würden. Christus würde aus der Herrlichkeit wiederkommen.
Wir werden gleich sehen, dass die Juden als Volk diese Barmherzigkeit abgelehnt haben. Deshalb sind die «Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge» (das Tausendjährige Friedensreich), wovon die Propheten im Alten Testament geredet haben, bis heute noch nicht gekommen. Sie werden erst eintreten, wenn die Zeit der Versammlung abgelaufen ist und die Gläubigen in den Himmel entrückt sind.
Nun zeigt Petrus weitere Herrlichkeiten des Herrn auf. Sein Herz war von Ihm erfüllt. Nachdem er vom Heiligen und Gerechten und vom Urheber des Lebens gesprochen hatte, stellte er Ihn noch als den Propheten vor, den Mose angekündigt hatte. Aber Christus wurde auch als Prophet verworfen (Johannes 7,40-44.52). Der Knecht Gottes war zudem der Nachkomme Abrahams, in dem alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Welch eine wunderbare Person ist unser Erlöser!
Glaube und Widerstand
Der Widerstand der religiösen Führerschaft auf eine so eindrückliche Predigt liess nicht lange auf sich warten. Die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die die Auferstehung leugneten (Apostelgeschichte 23,8), verhafteten die beiden Apostel kurzerhand. Doch das verkündigte Wort war bei vielen auf fruchtbaren Herzensboden gefallen und aufgegangen: «Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, glaubten.» Das konnte der Feind nicht verhindern.
Am folgenden Tag wurden die beiden Apostel von der hohen Geistlichkeit der Juden verhört. In Matthäus 10,19 sagte der Herr Jesus seinen Jüngern solche Situationen, wie Petrus und Johannes sie jetzt erlebten, voraus. Aber sie sollten nicht besorgt sein, wie oder was sie reden sollten. Es würde ihnen geholfen werden. Das erlebten sie jetzt. Petrus wurde für die Antwort auf die Frage der Führerschaft mit dem Heiligen Geist erfüllt und konnte ein eindrückliches Zeugnis von der Macht des Namens Jesu Christi ablegen. Noch einmal mussten sie hören: «Den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt aus den Toten.»
Der von den jüdischen Führern verachtete Stein ist zum Eckstein geworden, d.h. zum tragenden Element, nach dem sich bei einem Bau alles ausrichtet.
Wie inhaltsschwer ist der letzte Satz in der kurzen Rede des Petrus vor dem Synedrium. Es gibt für uns Menschen nur einen Erretter und eine Errettung, um dem gerechten Gericht Gottes zu entgehen: Jesus Christus, der Nazaräer. Aber der Mensch muss dieses Heil durch den Glauben an Ihn ergreifen.
Die Ohnmacht der führenden Juden
Als die Männer des Synedriums merkten, dass sie ungebildete Fischer aus Galiläa vor sich hatten, verwunderten sie sich, wie freimütig und klar diese Leute redeten. Sie erkannten auch ihre enge Beziehung zu Jesus, als Er noch hier gelebt hatte. Zudem stand der geheilte Gelähmte bei ihnen, sozusagen als Beweis für das Vorgefallene. Was konnten sie dagegen einwenden? Nichts! Hätte dies sie nicht dahinführen sollen, ernsthaft über alles nachzudenken? War hier nicht Gott selbst am Werk?
Möchten wir den Aposteln gleichen und Menschen sein, denen man es anmerkt, dass sie dem Herrn Jesus nachfolgen und mit Ihm leben wollen! Wie schön, wenn andere von uns bemerken könnten: «Sie sind mit Jesus gewesen.»!
Die Feinde des Herrn Jesus kamen zum Schluss, die beiden Zeugen mundtot zu machen, indem sie ihnen verboten, den Namen Jesu überhaupt zu nennen. Glücklicherweise hatten Petrus und Johannes ihren Auftrag nicht von irgendeinem Menschen bekommen, sondern vom Herrn selbst. Darum entgegneten sie: «Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden.» Was die Führer der Juden versuchten, war ein Eingriff in Gottes Angelegenheit. Eine ernste Sache!
Für den Augenblick beliessen es die Feinde bei einer verbalen Drohung. Sie wussten nicht, wie sie anders gegen die Apostel vorgehen konnten. Sie hätten das Volk gegen sich aufgebracht, «denn alle verherrlichten Gott».
Das Gebet der Versammlung
Nach ihrer Freilassung suchten Petrus und Johannes den Ort auf, wo sie die Gläubigen vermuteten. «Sie kamen zu den Ihren». Sie wollten bei denen sein, mit denen sie durch den Heiligen Geist verbunden waren.
Nachdem die Gläubigen von den ernsten Drohungen und Redeverboten der religiösen Führer gehört hatten, nahmen sie ihre Zuflucht im Gebet zu Gott. Auch wir dürfen mit all unseren Nöten und Sorgen, aber auch mit unseren Ängsten einzeln und gemeinsam im Gebet zu Gott gehen. Dort, am Herzen unseres Gottes und liebenden Vaters, dürfen wir zur Ruhe kommen, auch wenn die Lage sich vielleicht nicht verändert (Philipper 4,6.7).
Gott hat uns den Wortlaut dieses gemeinsamen Gebets der ersten Christen hinterlassen. Es ist interessant zu sehen, wie sie gebetet und was für Bitten sie vorgebracht haben. Weil das Wirken des Heiligen Geistes durch nichts gehindert wurde, konnte Er in den Betenden Einmütigkeit in den Empfindungen und Bitten hervorrufen. Dann erhoben sie Gott als allmächtigen Gebieter und bestätigten, wie sich alles nach den Voraussagen der Schrift und nach seinem göttlichen Plan erfüllt hatte. Im Vertrauen, dass Er alles in der Hand hat, stellten sie Ihm die gegenwärtige gefährliche Lage vor. Aber sie baten nicht um Bewahrung vor den Feinden oder um Erleichterung der Situation. Sie baten vielmehr um Kraft, Mut und Freimütigkeit, weiterhin Zeugen für den Herrn Jesus zu sein. Gott antwortete sofort auf ihr Gebet. Sie bekamen besondere Kraft des Geistes, um kühn das Wort zu reden.
Praktische Gemeinschaft
Obwohl sie von aussen bedroht wurden, herrschte unter den ersten Christen eine überaus schöne Einheit. Sie waren ein Herz und eine Seele. In den Tausenden von Christen, die erst vor kurzem gläubig geworden waren, gab es nichts, was die Wirksamkeit des Heiligen Geistes gehindert hätte. Weil Er in allen der Handelnde war, ergab sich diese Einheit, in der kein Egoismus Platz hatte.
Der gute Herzenszustand der Glaubenden gab auch der Verkündigung durch die Apostel grosse Kraft. Niemals hätten sie von der Auferstehung ihres Herrn und Heilands schweigen können. «Und grosse Gnade war auf ihnen allen.» Die Gnade Gottes hat uns nicht nur errettet, sie steht uns Glaubenden an jedem Tag unseres Lebens in unerschöpflichem Mass zur Verfügung. Wie nötig haben wir sie! Sie will uns helfen, in allen Umständen und trotz den Problemen den Gott gemässen Weg zu gehen. Sie unterweist uns darin (Titus 2,12). Aber sie hilft uns auch, die Umstände zu ertragen und darin nicht zu versagen.
Viele der ersten Christen haben in Liebe und Selbstlosigkeit an die anderen gedacht und ihren Besitz mit denen geteilt, die arm waren. Einer von ihnen war Barnabas. Wir werden ihm später noch mehrmals begegnen. Er hiess eigentlich Joseph. Doch die Apostel gaben ihm einen neuen Namen: Barnabas (= Sohn des Trostes). Er besass diesen neuen Namen zu Recht, wie wir dies z.B. in Apostelgeschichte 11,22-24 bestätigt finden. Welch ein Trost und welch eine Hilfe war er für die Gläubigen in Antiochien!
Ananias und Sapphira
Die gläubigen Christen und ihre Verkündigung sind dem Teufel ein Dorn im Auge. Er versucht mit allen Mitteln, die Zeugen zum Schweigen zu bringen und das Zeugnis der Einheit aller Gläubigen zu zerstören. Als seine Angriffe von aussen (Apostelgeschichte 4) keinen Erfolg hatten, griff er die Gemeinschaft der Gläubigen von innen her an – und hatte Erfolg!
Ananias und Sapphira, ein gläubiges Ehepaar, wollte auch für die Bedürftigen Geld spenden. Doch sie waren nicht aufrichtig. Sie wollten vor der Versammlung als selbstlose Geber dastehen wie Barnabas und gleichzeitig etwas für sich behalten. Diesen Betrug deckte Gott auf. Als Ananias das Geld zu den Aposteln brachte, erweckte er den Eindruck, er bringe den ganzen Erlös des Verkauften. Das war geheuchelt. Petrus sagte deutlich: Du hast Gott belogen. Die Strafe folgte auf dem Fuss: Ananias fiel tot zusammen. Er hatte keine Möglichkeit mehr, die Sünde zu bekennen, nachdem er überführt worden war. – Bei seiner Frau Sapphira war es anders. Ihre Verantwortung war geringer als die ihres Mannes. Sie hätte ihre Schuld bekennen können. Doch sie log ebenfalls. Deshalb traf sie das gleiche Los: Sie fiel tot zusammen.
Durch Petrus hatte Gott sich gegen das Böse gewandt, das in die Versammlung eindringen wollte. Hier wurde Zucht in der Versammlung ausgeübt, indem Petrus in apostolischer Autorität die Sünde der beiden an sie band (Matthäus 18,18). – Dieses Ehepaar ging nicht ewig verloren, aber sie hatten eine Sünde zum Tod begangen (1. Johannes 5,16; 1. Korinther 11,30).
Zeichen und Wunder
Das Eingreifen Gottes im Gericht zeigte Wirkung. Allen wurde bewusst, dass man den Geist des Herrn, der in der Versammlung wohnt, nicht ungestraft versuchen kann. Gottes Gegenwart zu ignorieren oder in Frage zu stellen, kann schreckliche Folgen haben.
Aber Satan konnte das, was Gott gewirkt hatte, nicht zerstören. Wenn wir an Gottes Seite denken, dann ist die Versammlung auf den Felsen Jesus Christus gegründet. Sie kann nicht überwältigt werden. Wenn wir an die Verantwortung von uns Menschen denken, dann müssen wir mit Beschämung sagen: Wir haben völlig versagt. Anstatt ein Herz und eine Seele sehen wir eine furchtbare Zersplitterung der Christen. Und wie viel Böses ist seit der Anfangszeit in die Christenheit eingedrungen! Wir sind mitschuldig!
Hier aber sehen wir den leuchtenden Anfang. Nachdem das Böse gerichtet war, wirkte Gott weiter durch Zeichen und Wunder. Viele kamen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus und wurden hinzugetan. Aber keiner, der nicht bereit war, sich zu bekehren, wagte es, sich den Christen anzuschliessen. Die göttliche Warnung durch den Tod von Ananias und Sapphira wurde zu einer Art Schutzwall gegen das Eindringen von Menschen, die nicht wirklich glaubten.
Die Verse 12 und 15 erinnern an die Worte des Herrn Jesus in Johannes 14,12: «Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird grössere als diese tun, weil ich zum Vater gehe.» Doch das eine grosse Werk – das der Erlösung – konnte niemand als nur Er selbst vollbringen.
Die Apostel werden verhaftet
Zu jener Zeit stand die religiöse Führungsschicht der Juden unter dem Einfluss der Sadduzäer (Apostelgeschichte 4,1; 5,17). Aus Vers 17 kann man schliessen, dass auch der Hohepriester dieser Sekte angehörte. Diese Leute lehnten alles ab, was nicht rational erklärbar war. So leugneten sie auch die Auferstehung (Matthäus 22,23). Das öffentlich verkündigte Zeugnis der Auferstehung des Herrn und dass dieser der Christus, also ihr Messias war, muss die Sadduzäer masslos geärgert haben. Daher liessen sie die Apostel kurzerhand verhaften, um sie später zu verhören. – Aber diese ungläubigen Rationalisten rechneten nicht mit Gott, der sich zu den Seinen bekennt. Ein Engel des Herrn befreite die Apostel aus dem Gefängnis. Zudem gab er ihnen den Auftrag, das Evangelium («alle Worte dieses Lebens») weiter zu predigen, was sie auch taten.
Vor dem Synedrium hofften der Hohepriester und die Sadduzäer, den zwölf Aposteln den Prozess zu machen und sie verurteilen zu können. Doch Gott brachte diese «Richter» zunächst einmal in grosse Verlegenheit. Das sorgfältig verschlossene Gefängnis war leer! Die Männer, die sie mundtot machen wollten, verkündigten im Tempel freimütig das Wort Gottes! Wie ohnmächtig ist doch der ungläubige Mensch, wenn Gott seine Allmacht zugunsten der Seinen demonstriert. Das hätte die religiöse Führerschaft Israels einsehen müssen und sich darunter beugen sollen. Aber ihre Feindschaft gegen Christus war so gross, dass auch ein solcher Fingerzeig Gottes an ihren harten Herzen und Gewissen nichts änderte.
Die Apostel werden verhört
Die Apostel wurden nun ein zweites Mal vorgeladen. Doch diesmal ohne jede Gewalt. Die Ordnungshüter befürchteten eine gewaltsame Gegendemonstration des Volks, das für die Jünger war.
Nun standen nicht mehr nur Petrus und Johannes, sondern alle zwölf Apostel vor Gericht. Die Führerschaft der Juden wollte endlich Ruhe haben und die weitere Verbreitung dieses verhassten Namens unterbinden. Die wiederholte Aussage, sie hätten den Tod von Jesus Christus auf dem Gewissen, ärgerte sie besonders. – Es ist überaus schön, die Kühnheit von Petrus und den Aposteln zu sehen. Eine solche Unerschrockenheit konnte nur der Heilige Geist, der in jedem von ihnen wohnte, bewirken.
Grundsätzlich müssen wir Menschen der Regierung gehorchen. So will es Gott (Römer 13,1; Titus 3,1; 1. Petrus 2,13.14). Aber seine Autorität steht über jeder menschlichen Autorität. Wenn die Regierung etwas von uns verlangt, das dem ausdrücklichen Willen Gottes entgegensteht, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als Menschen.
Das war jedoch nicht alles, was Petrus dem Synedrium zu sagen hatte. Er nahm die Gelegenheit wahr, um den versammelten Führern nochmals zu sagen, was Gott getan hatte und was sie verübt hatten. Aber dann sprach er von den gesegneten Folgen des Todes von Jesus Christus und seines Erlösungswerks: «Um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben.» Dieses Angebot der Gnade Gottes galt auch für sie, wenn sie es im Glauben annehmen wollten.
Die Apostel werden geschlagen
Leider bewirkten die klaren Worte von Petrus und den Aposteln keine positive Reaktion in den Mitgliedern des Synedriums. Sie wurden vielmehr «durchbohrt und beratschlagten, sie umzubringen».
Nun trat ein angesehener weiser Mann auf: Gamaliel. Er war zwar ungläubig und kein Befürworter der Christen. Doch Gott gebrauchte ihn, um die Verfolgung der Apostel hinauszuzögern.
Dieser Gesetzeslehrer verwies auf zwei Rebellionen, die den Anwesenden bekannt waren. Beide waren kläglich gescheitert, deren Anführer waren umgekommen und ihre Anhänger zerstreut worden. Vielleicht hoffte er, die Sache mit Jesus würde ebenso verlaufen. Doch in Vers 39 sprach er wohl sein eigenes Urteil und das Urteil über die anderen religiösen Führer des Volkes aus. Sie kämpften gegen Gott, denn es lagen bereits genügend Beweise vor, dass dieses «Werk» göttlichen Ursprungs war.
Das Synedrium war mit dem gemachten Vorschlag einverstanden. Doch sie konnten es nicht lassen, die Apostel zu schlagen und sie nochmals ernstlich zu bedrohen. Mit welchem Resultat? Diese freuten sich, dass sie gewürdigt wurden, für den Namen ihres Herrn und Heilands Schmach zu leiden. Später schrieb Petrus: «Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr!» (1. Petrus 4,14). Ohne sich einschüchtern zu lassen, hörten die Apostel nicht auf, «Jesus als den Christus zu verkündigen». Welch ein Triumph für die Sache des Herrn!
Die Versorgung der Witwen
Durch die Gnade Gottes war der Angriff Satans von aussen auf die Versammlung abgewehrt worden. Nun entstand eine Schwierigkeit innerhalb der Versammlung. Die einen Witwen meinten, sie würden gegenüber anderen benachteiligt. Unzufriedenheit und Murren war das Resultat. Das wird immer so sein, wenn unser Gottvertrauen schwindet und wir uns gegen die Situation auflehnen, in der wir uns befinden.
Bis dahin hatten die Apostel sowohl die Güter verteilt als auch das Wort verkündigt. Als sich die Schar der Jünger vermehrte, wurde diese Doppelbelastung zu gross. Es bestand die Gefahr, dass das Wort Gottes vernachlässigt wurde. Die Lösung des Problems bestand darin, dass die Versammlung Brüder erwählte, die sich um die materiellen Bedürfnisse der Gläubigen kümmerten.
Die Verwaltung materieller Gaben und die Verkündigung des Wortes werden klar unterschieden. Diese zwei Dienste werden auch in Römer 12,7 und 1. Petrus 4,11 voneinander abgegrenzt. Wenn es sich um den Dienst am Wort, um die Ausübung einer Gnadengabe handelt, haben die Menschen nichts zu bestimmen. Es ist der Herr, der gibt, beruft, befähigt. Bei den äusseren Belangen der Versammlung ist es Sache der Geschwister, Personen zu bestimmen, die dafür geeignet sind und das Vertrauen haben (2. Korinther 8,18-23). – Die Apostel legten den sieben von der Versammlung erwählten Männern die Hände auf. Damit «bestellten» sie sie über diese Aufgabe und machten sich eins mit ihnen. Diese apostolische Autorität haben wir heute nicht mehr.
Stephanus vor dem Synedrium
Wie wuchs das Wort Gottes? Indem es immer mehr Menschen erfasste, sogar viele Priester, die früher den Herrn Jesus abgelehnt hatten, und sie zum lebendigen Glauben an den Erlöser führte: «Die Zahl der Jünger … mehrte sich sehr.»
Stephanus, einer von den Sieben, wurde vom Herrn mit besonderer Gnade und Kraft ausgerüstet. Einerseits konnte er Wunder und Zeichen wirken wie die Apostel, anderseits war er ein begabter Verkündiger. Ungehindert konnte der Heilige Geist durch ihn wirken. Das rief den besonderen Hass seiner Gegner hervor, die ihm nicht zu widerstehen vermochten. Sie fielen über ihn her und schleppten ihn sofort vor das Synedrium.
Ähnlich wie beim Herrn wurden vor Gericht falsche Zeugen aufgestellt. Damals behaupteten sie, Jesus habe gesagt: «Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in drei Tagen aufbauen» (Matthäus 26,61). Sie missdeuteten seine Worte (Johannes 2,19-21). Ähnlich muss es bei Stephanus gewesen sein. Sie haben das, was er sagte, verdreht. In seiner Rede in Kapitel 7 antwortet er auf diese Anschuldigungen. Wir werden sehen, dass er weder von Gott noch von Mose, auch nicht vom Gesetz oder vom Tempel ungeziemend gesprochen hatte.
Der letzte Vers des Kapitels beschreibt uns einen unerschrockenen Zeugen, der so sehr vom Heiligen Geist erfüllt war, dass ein überirdischer Glanz auf seinem Gesicht lag. Jeder im Synedrium konnte es sehen. Ein solcher Mensch konnte unmöglich gegen Mose und Gott gelästert haben!
Die Geschichte Abrahams
Der Hohepriester begann sein Verhör mit der Frage an den Angeklagten: «Ist dies so?» Damit gab er Stephanus die Möglichkeit, zu den falschen Anschuldigungen Stellung zu nehmen. Anstatt direkt auf die Aussagen einzugehen und sich zu verteidigen, stellte er ihnen aufgrund vieler Schriftstellen aus dem Alten Testament die Wahrheit Gottes vor.
Er begann mit der göttlichen Berufung des Stammvaters des Volkes Israel. Er sprach vom «Gott der Herrlichkeit», der Abraham bereits in Mesopotamien erschienen war – und nicht, wie es nach 1. Mose 12 den Anschein macht, erst in Haran. Die Berufung Abrahams offenbart die souveräne Gnade Gottes. – Als Abraham nach dem Zwischenhalt in Haran ins verheissene Land kam, gab Gott ihm darin noch kein Erbe. Aber Er verhiess es ihm und seinen Nachkommen zum Besitztum «als er kein Kind hatte». Abraham glaubte diesem Wort von Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet (1. Mose 15,5.6).
Als Glaubender blieb Abraham ein Fremder in Kanaan. Von seinen Nachkommen sagte Gott, dass sie 400 Jahre lang in einem fremden Land geknechtet und misshandelt würden. Aber durch Gottes Gnade sollten sie schliesslich in ihr Land kommen.
Die Juden bildeten sich sehr viel auf ihre Beschneidung ein und verbanden sie mit dem Halten des Gesetzes. Doch den Bund der Beschneidung gab Gott Abraham lange vor dem Gesetz. Es war ein Bund der Gnade, bei dem Gott sich verpflichtete, alle seine Verheissungen zu erfüllen.
Die Geschichte Josephs
Aus der Geschichte der Patriarchen griff Stephanus die von Joseph heraus, denn er ist eins der schönsten Vorausbilder auf Christus. Der Heilige Geist wollte durch Stephanus die Führer des Volkes anhand dieser Geschichte an das erinnern, was sie mit dem Herrn Jesus getan hatten. Auch von Ihm heisst es, dass Pilatus wusste, dass die Juden Ihn aus Neid überliefert hatten. Anderseits war es offenkundig, dass Gott mit seinem Sohn war (Apostelgeschichte 7,9; 10,38).
Doch der gleiche Mann, den seine Brüder aus Hass nach Ägypten verkauft hatten, wurde dort von Gott erhöht, so dass der Pharao ihn zum Verwalter über Ägypten und sein ganzes Haus einsetzte. Die Parallele ist offensichtlich: Nach vollbrachtem Erlösungswerk hat Gott Christus aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten erhöht (Epheser 1,20).
In Vers 13 heisst es: «Beim zweiten Mal wurde Joseph von seinen Brüdern wiedererkannt.» Auch beim Herrn Jesus gibt es für das Volk Israel «ein zweites Mal». Bei seinem ersten Kommen wurde Er abgelehnt. Wenn Er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, wird sein irdisches Volk Ihn als Den erkennen, den sie durchstochen haben (Offenbarung 1,7). Dann werden sie über ihre Sünde Buße tun und Ihn als ihren Messias annehmen.
Es war nach Gottes Plan, den Er bereits Abraham mitgeteilt hatte (Vers 6), dass Jakob mit seiner Familie nach Ägypten zog. Später würde Gott Israel als Volk aus jenem Land herausführen und nach Kanaan bringen.
Mose: 40 Jahre in Ägypten
Nach dem Tod Josephs, als ein anderer König über Ägypten aufstand, verschlechterte sich die Lage für die Nachkommen Jakobs drastisch. Das Volk Israel wurde sehr unterdrückt. Doch gleichzeitig kam «die Zeit der Verheissung näher, die Gott dem Abraham zugesagt hatte». – In jener Zeit wurde Mose geboren – ein Mann, der ähnlich wie Joseph in mancher Hinsicht auf den Herrn Jesus hinweist. Auch über diesen sprach Stephanus, denn er war angeklagt, gegen Mose (den Gesetzgeber) und das Gesetz geredet zu haben.
Die Juden hielten Mose als Gesetzgeber und Befreier aus Ägypten in höchsten Ehren. Doch Stephanus zeigte ihnen, dass dieser Mann von ihren Vorvätern überhaupt nicht akzeptiert worden war. Sie lehnten ihn mit den Worten ab: «Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt?» Daraufhin musste er nach Midian fliehen. Wir denken an das Gleichnis von den Pfunden, wo der Herr Jesus von sich als einem hochgeborenen Mann spricht. Doch die Bürger seines Landes hassten ihn und liessen ihm sagen: «Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche» (Lukas 19,12.14).
Mose ist in diesen Versen auch ein Vorbild für uns Gläubige, die in einer gottlosen Welt (Ägypten) leben. Obwohl die Tochter des Pharaos ihn als ihren Sohn aufzog, wusste er immer, dass er zu den versklavten Israeliten gehörte. Das brauchte Glauben (Hebräer 11,24-26), den auch wir benötigen, um in dieser Welt nicht irdisch gesinnt zu werden, sondern bewusst als Himmelsbürger zu leben.
40 Jahre in Midian
Nachdem Mose in das Land Midian geflohen war, vergingen weitere 40 Jahre, in denen das Volk Israel unter der Sklaverei der Ägypter schmachtete. Dann offenbarte Gott sich Mose und gab ihm einen Auftrag. Stephanus erzählte dieses Ereignis sehr ausführlich. Warum wohl? Der brennende Dornbusch ist ein Bild des Volkes Israel, das sich im Feuerofen Ägyptens befand, aber durch Gottes Gnade nicht vernichtet wurde. In diesem Dornbusch war Gott selbst, der nun zu Mose redete. Bevor Er ihm den Auftrag gab, erinnerte Er ihn daran, wer Er war, der zu ihm sprach: der Gott der Vorväter Israels in seiner ganzen Heiligkeit. Das gab dem Sendungsauftrag von Mose das nötige Gewicht.
Aber dann redete Gott vom Elend seines Volkes, das Ihm keineswegs entgangen war. Doch jetzt war Gottes Zeitpunkt gekommen, um einzugreifen und sein Volk aus der Knechtschaft zu befreien. Der Beweggrund lag einzig und allein in der unendlichen Barmherzigkeit seines Herzens und in der Liebe zu seinem Volk (5. Mose 7,7.8). Auch uns hat Gott seine Liebe zugewandt, als wir noch Sünder waren. Da ist Christus für uns gestorben (Römer 5,8).
In Vers 35 redete Stephanus zum Herzen und Gewissen der Männer des Synedriums. Mose, den ihre Väter zuerst verleugnet hatten, wurde zum Obersten und Retter Israels. Ähnliches war mit dem Herrn Jesus geschehen. Die Führer der Juden hatten Ihn verworfen, aber Gott hatte diesen Jesus zum Herrn und Retter gemacht (Apostelgeschichte 4,12; 5,31). Es wäre auch zu ihrem Heil gewesen, wenn sie an Ihn geglaubt hätten.
Mose mit dem Volk in der Wüste
Vers 36 beginnt mit «dieser». Damit meint Stephanus den Führer Mose, den die Israeliten zuerst abgelehnt, den Gott aber als Retter gesandt hatte. Dann folgt eine Beschreibung des Verhaltens des Volkes Israel in der Wüste.
Aus den Worten von Stephanus können wir zweierlei entnehmen. Erstens war Mose ein besonderer Prophet. Er nahm die Stellung eines Mittlers ein, indem er einerseits mit Gott verkehrte und anderseits die Aussprüche, die er von Gott empfing, dem Volk weitergab. Mit seinen eigenen Worten wies er auf einen späteren Propheten hin, den Gott gleich ihm erwecken würde. Das ist niemand anders als Jesus Christus, der eine Mittler zwischen Gott und Menschen, auf den bereits Petrus in Apostelgeschichte 3,20-23 hingewiesen hatte.
Zweitens zeigte Stephanus auf, dass die Israeliten Mose zum zweiten Mal verwarfen. Indem sie den von Gott bestimmten Führer von sich stiessen, verwarfen sie auch Gott und öffneten sich dem Götzendienst.
Es waren ernste Worte, die der treue Knecht des Herrn seinen Anklägern vorstellen musste. «Gott aber wandte sich ab und gab sie hin.» Das ist das Schlimmste, was Menschen passieren kann: wenn Gott solche, die Ihm einfach nicht gehorchen wollen, die Ihm und seinen Wegen der Gnade dauernd widerstehen, laufen lässt. Damals hatte Er sein Volk schliesslich in die babylonische Gefangenschaft gehen lassen. Jetzt stand den Juden ein noch schlimmeres Schicksal bevor, wenn sie im Unglauben und in der Ablehnung gegenüber Jesus Christus verharren wollten.
Stiftshütte und Tempel
Eine der falschen Anklagen gegen Stephanus lautete: Er habe «gegen diese heilige Stätte» geredet. Damit meinten sie den Tempel. Die nun vorliegenden Verse belegen das Gegenteil: Er hatte nichts gegen den Tempel Gottes gesagt, aber den wahren Sachverhalt aufgedeckt.
Stephanus begann seine Ausführungen mit den Hinweisen auf die Stiftshütte. Diese war der erste Wohnort Gottes in der Mitte seines irdischen Volkes. Er selbst hatte ihren Bau mit den Worten angeordnet: «Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne» (2. Mose 25,8). Später wünschte König David, dem Herrn ein Haus zu bauen. Salomo, sein Sohn, durfte dies verwirklichen.
Zur Zeit von Stephanus stand an der Stelle des salomonischen Tempels der von Herodes erbaute Tempel. Der Herr Jesus selbst anerkannte dieses Bauwerk als das Haus seines Vaters (Johannes 2,16), obwohl dort vieles nicht mehr der Heiligkeit Gottes entsprach. Seither war der Sohn Gottes umgebracht worden. Konnte Gott da noch in ihrer Mitte wohnen?
Vor dem Hintergrund dieser Tatsache erinnerte Stephanus die Männer des Synedriums, dass Gott eigentlich zu gross ist, um in einem von Menschen erbauten Tempel zu wohnen. Die Juden verhielten sich so, als ob der Höchste ihren Tempel nötig hätte. Sie legten diesem Haus Gottes einen übermässig grossen Wert bei, verwarfen aber gleichzeitig den Sohn des Herrn dieses Hauses! Daran wollte Stephanus sie erinnern.
Stephanus wird gesteinigt
Nachdem Stephanus anhand der Geschichte des Volkes Israel den immer wieder auftretenden Unglauben und den Widerstand gegen Gott aufgezeigt hatte, folgte jetzt die Anwendung auf seine Ankläger. Sie gaben sich als Führer des Volkes aus, doch sie offenbarten die gleiche Herzenshaltung wie ihre Vorfahren. Jene hatten die Propheten Gottes verfolgt, die den Messias angekündigt hatten. Stephanus nennt Ihn nicht mit Namen, sondern spricht wie Petrus von Ihm als dem Gerechten (Apostelgeschichte 3,14). Diesen hatten sie, nachdem Er zu seinem Volk gekommen war, umgebracht.
Die Worte in Vers 54 zeigen, wie grenzenlos die Wut, der Hass und die Feindschaft gegen Stephanus waren. Er aber durfte in den geöffneten Himmel blicken. Dort sah er Jesus zur Rechten Gottes stehen. Er war bereit wiederzukommen, wenn das Volk Buße getan hätte. Doch sie verwarfen auch das letzte Zeugnis des Heiligen Geistes. Stephanus sah den Sohn des Menschen, den sie vor einiger Zeit zum Tod verurteilt und gekreuzigt hatten. Welch eine Schuld lag auf ihnen! Doch davon wollten sie nichts hören: Diese Stimme musste zum Schweigen gebracht werden! Stephanus wurde gesteinigt. Wie sein Meister starb er und betete dabei für seine Feinde (Vers 60; Lukas 23,34). Er war der erste christliche Märtyrer.
In Vers 58 nennt der inspirierte Schreiber den Namen eines jungen Mannes, der später für das Christentum von besonderer Bedeutung wurde: Saulus, der spätere Apostel Paulus.
Erste Christenverfolgung
Nach der Steinigung von Stephanus brach eine Verfolgung über die Versammlung herein. Wenn die Christen nicht Gefahr laufen wollten, ins Gefängnis zu kommen, mussten sie aus Jerusalem fliehen. So wurden sie überallhin zerstreut.
Die treibende Kraft hinter der Verfolgung war Saulus, der in die Tötung von Stephanus eingewilligt hatte und nun versuchte, die Versammlung zugrunde zu richten. Dieses böse Vorhaben aber konnte nicht gelingen, denn der Herr Jesus hatte in Matthäus 16,18 selbst gesagt: «Ich werde meine Versammlung bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.»
Das Gegenteil von dem, was Satan und die Feinde der gläubigen Christen anstrebten, geschah. Anstatt dass die Versammlung zugrunde gerichtet wurde, wuchs sie weiter. Denn die durch die Verfolgung Weggetriebenen verkündigten dort, wo sie hinkamen, das Evangelium.
Philippus, einer von den in Apostelgeschichte 6 bestimmten sieben Dienern, zog in eine Stadt Samarias und predigte jenen Menschen «den Christus». Der Inhalt seiner Botschaft war der Herr Jesus, der am Kreuz für sündige Menschen gestorben ist. Aber Er ist auferstanden und lebt jetzt im Himmel. Wie reagierten die Bewohner von Samaria? Sie hörten aufmerksam zu, sahen die Zeichen, mit denen das verkündigte Wort unterstrichen und bestätigt wurde (Markus 16,20), und glaubten (Vers 12). Das Resultat war in jener Stadt eine grosse Freude – die Freude des Heils.
Philippus in Samaria
Die Stadt, in der Philippus das Evangelium predigte, stand vorher unter dem starken Einfluss von Satan. Ein Mann mit Namen Simon zog die Bewohner dieses Ortes mit Zaubereien in seinen Bann. «Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien ausser sich gebracht hatte.» Simon nützte die Begeisterung der Menschen aus, um sich als ein Grosser bewundern zu lassen.
Doch die Verkündigung des Evangeliums änderte die Situation grundlegend. Viele Männer und Frauen glaubten an den Herrn Jesus und bezeugten durch die Taufe, dass sie Ihm nachfolgen wollten. Sie hatten dem satanischen Einfluss durch die Zaubereien Simons den Rücken gekehrt und sich der frohen Botschaft von Jesus Christus, die Philippus verkündigte, geöffnet.
Ganz unerwartet heisst es dann: «Aber auch Simon selbst glaubte.» Das erstaunt uns vielleicht. War dieses Werkzeug Satans zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen?
Nein! Die weiteren Verse des Kapitels zeigen, dass er einfach von den Zeichen und grossen Wunderwerken beeindruckt wurde. Er erkannte, dass da eine höhere Macht am Werk war als die Kraft, die ihm zur Verfügung stand. Sein Glaube basierte auf den Zeichen und Wundern. Es war ein Glaube ohne echte Grundlage und konnte daher nicht erretten. Der Glaube, der errettet, muss das Wort Gottes zur Grundlage haben (Römer 10,17).
Petrus und Johannes in Samaria
Der Zauberer Simon hatte sich taufen lassen, obwohl sein Glaube nicht echt war. Er hatte Philippus täuschen können und hielt sich nun zu ihm. Aber Gott sorgte dafür, dass die Unaufrichtigkeit Simons ans Licht kam. Dazu benutzte Er den Apostel Petrus.
Die Nachricht vom mächtigen Wirken Gottes in Samaria war auch nach Jerusalem gedrungen. Nun sandten die Apostel Petrus und Johannes dorthin, um eine Verbindung mit den Gläubigen in Jerusalem herzustellen und die Einheit der Versammlung auszudrücken. Aus den Evangelien wissen wir, dass zwischen Jerusalem und Samaria eine religiöse Rivalität bestand (Johannes 4,20). Diese durfte auf keinen Fall auch in die Beziehung unter den Christen kommen. Durch das Auflegen der Hände bezeugten die Apostel ihr Einssein mit den gläubig gewordenen Samaritern. Nun empfingen auch sie den Heiligen Geist und wurden Glieder an dem einen Leib des Christus.
Simon verfolgte alles, was die Apostel taten, mit Interesse. Nun wollte er die Vollmacht, anderen den Heiligen Geist zu verleihen, mit Geld erwerben. Damit offenbarte er die Unaufrichtigkeit seines Herzens – er selbst begehrte den Heiligen Geist nicht – und die Bosheit seiner Gesinnung. Er betrachtete die Gottseligkeit als ein Mittel zum Gewinn (1. Timotheus 6,5). Die Antwort des Petrus erfolgte augenblicklich. Wenn Simon über seine Bosheit nicht Buße tat und den Herrn um Vergebung bat, würde er ewig verloren gehen – trotz seines «Glaubens» und des Getauftseins! Wir lesen nicht, dass er sich vor Gott gebeugt hätte.
Philippus trifft den Kämmer
Vermutlich wirkte Philippus noch in Samaria, als er vom Engel des Herrn einen besonderen Auftrag erhielt. Es war Gottes Absicht, dass einem Afrikaner das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wurde. Wie gut, dass Philippus sofort gehorchte! Er hätte sonst den vorbeifahrenden Kämmerer verpasst.
Dieser Mann hatte eine sehr weite Reise unternommen, um in Jerusalem anbeten zu können. Wie er vom wahren Gott, dem Gott Israels, gehört hatte, sagt die Bibel nicht. Aber hatte er in Jerusalem gefunden, was er suchte? Wir wissen nur, dass er sich in Jerusalem einen Teil des inspirierten Wortes Gottes erworben hatte und nun den Propheten Jesaja las. Er war gerade mit Jesaja 53 beschäftigt, als der Geist Gottes Philippus aufforderte hinzuzutreten. Jetzt sollte der Evangelist aktiv werden.
Es brauchte nicht viel, bis Philippus auf dem Wagen neben diesem hohen afrikanischen Staatsbeamten sass und ihm das Evangelium von Jesus Christus verkündigte. Die Bibelstelle in Jesaja 53 war bestens dazu geeignet, denn sie redet prophetisch vom Herrn Jesus als dem Lamm Gottes, das für uns am Kreuz gestorben ist. Der Afrikaner war offen für die Botschaft, aber er brauchte jemand, der ihm das Wort Gottes verständlich machte. Diese schöne Aufgabe durfte Philippus übernehmen. Sicher wird er ihm gezeigt haben, wie das ganze Kapitel prophetisch vom Herrn Jesus redet, der zwar von den Juden verachtet und verworfen worden war, aber für unsere Sünden gestorben ist.
Philippus verkündigt das Evangelium
Nun ging im Herzen des Kämmerers eine grosse Veränderung vor sich. Er glaubte den Worten von Philippus und öffnete dem Herrn Jesus sein Herz. Er empfing neues, ewiges Leben. Nun wünschte er zu bezeugen, dass Jesus Christus, den er als seinen Erlöser angenommen hatte, jetzt auch sein Herr war, dem er gehorchen und nachfolgen wollte.
Als sie daher an ein Wasser kamen, sah er die Möglichkeit, sich taufen zu lassen. Auf seine Frage an Philippus: «Was hindert mich, getauft zu werden», gab es keine Einwände. Deshalb lesen wir, dass sie beide in das Wasser hinabstiegen und Philippus den Kämmerer taufte.
Sofort nach der Taufe verschwand der Diener des Herrn aus dem Blickfeld des Afrikaners. Der Geist entrückte Philippus und brachte ihn zu einem neuen Arbeitsfeld. Er evangelisierte entlang der Mittelmeerküste, begann in Asdod und gelangte schliesslich nach Cäsarea.
Und der Kämmerer? Er zog weiter in Richtung seines Heimatlandes, und zwar mit Freuden. Er hatte den Heiland gefunden, der nun sein Herr war. Dieser hatte versprochen: «Siehe, ich bin bei euch alle Tage.» Das galt nun auch dem Afrikaner. Er zog den Weg nicht allein weiter, sein Herr begleitete ihn. Zudem besass er ein Stück des geschriebenen Wortes Gottes: ein unermesslicher Schatz! So konnte er immer wieder darin lesen, darüber nachdenken und sich an den Stellen freuen, die von Jesus Christus reden.
Saulus vor Damaskus
In Apostelgeschichte 8,3 hiess es, dass Saulus die Versammlung zugrunde richten wollte. Wie viele Männer und Frauen damals ins Gefängnis kamen, wissen wir nicht. Doch der erste Vers unseres Kapitels zeigt, dass dieser Christenverfolger nicht genug bekam. Jetzt wollte er die gläubigen Christen sogar bis in die ausländischen Städte verfolgen. Mit entsprechenden Empfehlungen und Vollmachten ausgerüstet, zog er nach Damaskus.
Doch bevor er jene Stadt erreichte, trat ihm der Herr selbst entgegen und warf ihn zu Boden. Ein Licht aus dem Himmel umstrahlte ihn und eine Stimme fragte ihn: «Saul, Saul, was verfolgst du mich?» Sicher wusste Saulus schlagartig, dass dieses Licht von Gott kam. Aber wer war die Autorität, die ihn ansprach? Er wusste es nicht. Daher die Frage: «Wer bist du, Herr?»
Die Antwort lautete: «Ich bin Jesus, den du verfolgst.» In einem Augenblick wurde ihm die ganze Verkehrtheit und Sündhaftigkeit seines Handelns bewusst. Der Herr Jesus, dessen Nachfolger er bis zum Äussersten verfolgte, lebte tatsächlich im Himmel und er lag vor Ihm auf der Erde. Doch die Stimme war nicht die eines Richters. Voller Gnade ermunterte sie den innerlich zerschlagenen Mann, aufzustehen und in die Stadt zu gehen. Alles Weitere würde sich ergeben. Ohne weitere Fragen gehorchte er der Stimme des Herrn Jesus – ein Zeichen für die Veränderung, die in ihm stattgefunden hatte. Doch er blieb noch drei Tage blind und ass und trank nicht. Es waren Tage tiefer Seelenübungen.
Saulus und Ananias
In Damaskus hatte der Herr einen Diener – den Jünger Ananias –, den Er zu Paulus senden wollte. Als Er ihn rief, reagierte dieser sofort. Sein Herz und sein Ohr waren stets bereit, auf eine Anweisung des Herrn zu hören. Als Ananias aber die Einzelheiten seines Auftrags erfuhr, hatte er doch Bedenken.
Ananias lebte in einem Vertrauensverhältnis zu seinem Herrn. Zwischen ihnen gab es nichts Störendes, so dass der Jünger seine Bedenken über diesen (ehemaligen) Christenverfolger seinem Meister sagen konnte. Und der Herr? Er hatte nicht nur Geduld mit seinem Jünger, sondern offenbarte ihm, was für ein wichtiges Werkzeug dieser Mann für Ihn werden sollte. Das war wirklich ein Gespräch unter Freunden.
Für Ananias muss die Aussage des Herrn: «Siehe, er betet», eine Bestätigung dafür gewesen sein, dass Saulus bereits neues Leben hatte. Er wusste zudem, dass dieser Mann über sein Kommen unterrichtet war.
Damit waren bei Ananias alle Zweifel ausgeräumt. Er ging zu Paulus, legte ihm die Hände auf und redete ihn mit «Bruder Saul» an. Für ihn gehörte dieser Mann wie jeder andere Gläubige zur Familie Gottes.
Als Saulus wieder sehend war, wurde er auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nun hatte er in seinem Innern einen gefestigten Frieden mit Gott. Der Heilige Geist gab seinem neuen Leben die Kraft, so dass er jetzt die ersten sicheren Schritte auf dem Glaubensweg gehen konnte. Als Erstes wurde er getauft.
Saulus bezeugt Jesus als Sohn Gottes
Saulus, der Christenverfolger, war eine bekannte Persönlichkeit. Auch von seinem Vorhaben in Damaskus wussten die Leute (Apostelgeschichte 9,14.21). Deshalb waren die Menschen ganz verwundert, als sie hörten, dass dieser Mann in den Synagogen predigte und Jesus als Sohn Gottes verkündigte. Im Weiteren bewies er den Juden – wohl anhand der Schriften des Alten Testaments –, dass dieser Jesus der Christus, d.h. der verheissene Messias, ist. Durch diese klare Verkündigung zog er den Hass und die Feindschaft der Juden auf sich. Nun wurde er zum Verfolgten. Doch er konnte fliehen.
Zurück in Jerusalem, dem Ausgangspunkt seiner Reise nach Damaskus, versuchte er sich denen anzuschliessen, die er früher verfolgt hatte. Doch sie trauten der Sache nicht. Sie sahen noch nicht, dass er ein völlig veränderter Mann war. Als Verfolger der Versammlung Gottes hatte er Jerusalem verlassen, als ein Apostel des Herrn Jesus Christus war er zurückgekehrt.
Da nahm Barnabas, der Sohn des Trostes, sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Als ein vertrauenswürdiger Mann konnte er den anderen von den besonderen Umständen der Bekehrung von Saulus berichten und bezeugen, wie freimütig er in Damaskus im Namen Jesu gesprochen hatte. Damit war das Eis gebrochen. Von jetzt an lebte Saulus in ungetrübter Gemeinschaft mit den Gläubigen in Jerusalem. Doch seine klare Verkündigung rief auch in jener Stadt die Feindschaft der Juden hervor, so dass er erneut fliehen musste.
Petrus kommt nach Lydda
Nachdem Saulus, der Anführer der Christenverfolger, sich bekehrt hatte und an Jesus Christus gläubig geworden war, erlebten die Christen im Land Israel eine Zeit der Ruhe. Aufgrund dieser günstigen Voraussetzungen gab es in den örtlichen Versammlungen der Provinzen Judäa, Galiläa und Samaria sowohl inneres als auch äusseres Wachstum. Die Erbauung beschreibt das geistliche, innere Wachstum der Gläubigen. Die Vermehrung weist auf das zahlenmässige Wachstum der Versammlung hin. Obwohl es in diesen Versen um örtliche Versammlungen einer Region geht, spricht der Heilige Geist von der Versammlung. Damit wird betont, dass es auf der Erde nur eine Versammlung gibt, zu der alle Erlösten gehören. Aber sie wird da, wo Gläubige zum Namen des Herrn hin zusammenkommen, örtlich dargestellt.
Ab Vers 32 wird uns etwas über den Dienst des Apostels Petrus mitgeteilt. In Johannes 21 hatte der Herr ihm die Lämmer und Schafe seiner eigenen Herde anvertraut. In diesen Versen sehen wir, wie er diesen vom Herrn empfangenen Hirtendienst ausübte. Er ging den Gläubigen nach, bis er nach Lydda kam. Dort durfte er in der Macht des Namens von Jesus Christus einen Gelähmten gesund machen (vergleiche Vers 34 mit Apostelgeschichte 3,6). Dieses Wunder führte dazu, dass viele Menschen in den Ortschaften Lydda und Saron sich zum Herrn bekehrten. Ähnliches geschah nach der Heilung des Gelähmten an der Tempelpforte (Apostelgeschichte 4,4).
Petrus auferweckt Tabitha
Die nächste Geschichte handelt von einer gläubigen Frau, die krank wurde und starb. Diese treue Jüngerin hinterliess eine grosse Lücke, obwohl sie, wie es scheint, keine eigene Familie hatte. Ihr Wirkungskreis waren die armen Witwen. Sie hatte sich um diese wie um ihre Kinder gekümmert. Nun war die Trauer gross.
Da die Jünger in Joppe wussten, dass der Apostel Petrus in der Nähe war, sandten sie zwei Männer zu ihm nach Lydda mit der einfachen Bitte: «Zögere nicht, zu uns herüberzukommen.» Sicher hofften sie im Stillen auf ein Wunder, aber sie wollten die Sache ganz dem guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes überlassen. Im Glauben hofften sie auf Ihn, der allein wusste, was für sie gut war.
Petrus kam sofort. In Joppe angekommen, führten sie ihn einfach ins Zimmer, wo die Verstorbene lag, während alle Witwen die Kleider zeigten, die die Hände der Dorkas gemacht hatten: ein sichtbares Zeichen der Liebe ihres Herzens! Dann wollte Petrus allein sein, um mit seinem Herrn reden zu können. Er «kniete nieder und betete». Er legte die Sache dem Herrn über Leben und Tod vor, der auch Tote aufzuerwecken vermag. Und Gott wollte, dass die Verstorbene ins Leben zurückkam. So konnte Petrus der Toten zurufen: «Tabitha, steh auf!», und sie wurde zum Leben erweckt.
Wie gross muss die Freude bei den Gläubigen gewesen sein! Auch dieses Wunder führte dazu, dass viele Menschen in Joppe an den Herrn glaubten. Welch ein Triumph der Gnade Gottes!
Kornelius aus Cäsarea
Als an Pfingsten die Versammlung entstand, setzte sie sich ausschliesslich aus Juden, die an den Herrn Jesus glaubten, zusammen. Aber das Evangelium von der Gnade Gottes ist eine Botschaft, die sich an alle Menschen richtet (Lukas 24,45-47). Die Geschichte des römischen Zenturio Kornelius, die jetzt beginnt, zeigt, wie Menschen aus den Nationen durch den Glauben an Jesus Christus errettet und zur Versammlung hinzugefügt werden. Sie müssen nicht zuerst Juden werden.
Der fromme und gottesfürchtige Kornelius hatte bereits eine Beziehung zum Volk der Juden und vor allem zum wahren Gott. Er betete zu Ihm. Dieser Mann besass also schon Leben aus Gott. Aber er wusste nichts vom vollbrachten Erlösungswerk. Ihm fehlte der Friede mit Gott, die Sicherheit der Vergebung seiner Sünden und vor allem hatte er den Heiligen Geist noch nicht.
Aber nun wollte Gott ihm die ganze Botschaft des Heils in Jesus Christus mitteilen. Doch das war nicht die Aufgabe des Engels, der Kornelius erschien. Der Zenturio sollte Leute nach Joppe senden und von dort einen gewissen Simon, der auch Petrus genannt wird, holen lassen. Gott lässt das Evangelium durch solche weiterverkündigen, die es selbst im Glauben angenommen haben. Zudem hatte der Apostel Petrus einen besonderen Auftrag vom Herrn. In Matthäus 16,19 verhiess der Meister ihm die Schlüssel des Reiches der Himmel. Nun sollte er diese Schlüssel benutzen, um auch den Nationen den Zugang zum Reich der Himmel zu öffnen.
Petrus auf dem Dach
Gottes Wille ist, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Darum hat Jesus Christus – der eine Mittler zwischen Gott und Menschen – sich selbst am Kreuz als Lösegeld für alle gegeben. Damit diese herrliche Botschaft auch zu Kornelius – einem Mann aus den Nationen – kam, musste Gott den Diener, den Er dazu gebrauchen wollte, erst vorbereiten.
Obwohl der Apostel Petrus an den Herrn Jesus glaubte, war er als Person immer noch ein gesetzestreuer Jude. Das von Gott durch Mose gegebene Gesetz machte eine klare Trennung zwischen Juden und Nationen. Nun musste Petrus lernen, dass mit dem Tod des Herrn am Kreuz die Zeit des Gesetzes zu Ende gegangen war. Eine neue Zeit – die der Gnade – hatte begonnen, in der Gott «die Zwischenwand der Umzäunung» (das Gesetz) abgebrochen hat. Menschen aus allen Völkern, die glauben, werden zu einer neuen Einheit miteinander verbunden. Sie bilden zusammen die Versammlung Gottes (Epheser 2,11-22). Unter dem Gesetz nahmen die Juden eine besondere Stellung vor Gott ein. Im Christentum gibt es diese Unterscheidung nicht mehr.
Mit der dreimal wiederholten Vision versuchte Gott dem Apostel Petrus dies klarzumachen. «Was Gott gereinigt hat, halte du nicht für gemein!» Nach dieser göttlichen Unterweisung war Petrus als Jude bereit, in das Haus eines Römers zu gehen. So wirkte Gott sowohl an Kornelius wie auch an Petrus, um diese beiden so unterschiedlichen Männer – ein jüdischer Fischer und ein römischer Offizier – zusammenzuführen.
Petrus reist nach Cäsarea
Als der Apostel Petrus in das Haus von Kornelius hineinging – es war für ihn wohl das erste Mal, dass er das Haus eines «Heiden» betrat –, erlebte er einen besonderen Empfang: Der Römer fiel ihm zu Füssen und huldigte ihm. Das war ehrlich gemeint, aber verkehrt. Sofort richtete Petrus ihn mit der Bemerkung auf: «Steh auf! Auch ich selbst bin ein Mensch.» Eine solche Ehrerbietung gehört nur Gott.
Dann traten diese beiden so verschiedenen Männer wie zwei Freunde gemeinsam in das Innere des Hauses, wo viele versammelt waren.
Nachdem Petrus den Anwesenden erklärt hatte, warum er als Jude zu ihnen gekommen war, fragte er nach dem Grund der Einladung. Der Geist Gottes wiederholt in den Versen 30-32, was wir bereits aus den Versen 3-6 wissen, aber mit dem Zusatz: «Der wird, wenn er hierher gekommen ist, zu dir reden.»
Kornelius schloss seine Antwort mit dem wichtigen Satz: «Jetzt sind wir nun alle vor Gott gegenwärtig, um alles zu hören, was dir von Gott befohlen ist.» Kornelius und die bei ihm Versammelten waren sich bewusst, in der Gegenwart Gottes zu sein. Nun wollten sie auf all das hören, was Er ihnen durch einen menschlichen Diener sagen wollte. – Eine solche Haltung gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort und gegenüber seinem Diener sollten auch wir an den Tag legen, wenn wir zur Verkündigung des Wortes Gottes zusammenkommen. Die Worte von Kornelius reden aber auch zum Herzen und Gewissen der Verkündiger. Reden wir wirklich nur das, was uns von Gott befohlen ist?
Das Evangelium für Kornelius
Was verkündigte Petrus solchen, die zum Teil bereits Leben aus Gott hatten und offen für die Botschaft der Gnade waren? Zunächst anerkannte er, dass Gott in jedem Volk die Menschen sieht, die von neuem geboren sind und daher Leben aus Gott besitzen. Er beschreibt sie als solche, die Ihn fürchten und Gerechtigkeit wirken. Nur gläubige Menschen können so leben.
Dann sprach er von dem, was den Zuhörern bekannt war. Sie hatten von Jesus Christus und seinem Dienst im Land Israel gehört. Doch sie wussten auch, dass Er nur zum Volk Israel gekommen war (Matthäus 15,24), nicht zu ihnen als Menschen aus den Nationen. Neu war für sie die Aussage: Jesus Christus ist Herr von allen. Das betraf auch sie.
Doch bevor Petrus in seiner Rede noch einen entscheidenden Schritt weiterging, stellte er ihnen den Herrn Jesus in seinem Leben und Dienst, seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung vor. Dass Er auferstanden war, wurde von vielen Zeugen bestätigt. Die Auferstehung von Jesus Christus ist eine Tatsache!
Aber nun kam eine Botschaft, die über das Volk Israel hinausgeht und alle Menschen betrifft. Der verworfene und gekreuzigte Jesus Christus ist der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und Toten. An Jesus Christus kommt kein Mensch vorbei. Es gibt aber einen Ausweg, um Ihm nicht als dem Richter begegnen zu müssen. Es ist der Glaube an Ihn als den Heiland. Dieser Ausweg steht wirklich allen Menschen offen, denn «jeder, der an ihn glaubt, empfängt Vergebung der Sünden durch seinen Namen».
Mit dem Heiligen Geist versiegelt
Die im Haus von Kornelius versammelten Menschen müssen den Worten von Petrus mit grösster Aufmerksamkeit gefolgt sein. Als sie vernahmen, dass jeder, der an den Herrn Jesus als seinen Erretter glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt, nahmen sie die Botschaft auf der Stelle an. Sofort antwortete Gott auf ihren Glauben, indem der Heilige Geist auf alle fiel, die das Wort hörten und es mit Glauben aufnahmen. Gott selbst unterbrach an dieser Stelle die Predigt von Petrus, denn es heisst: «Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten.»
Die Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren – es waren ausschliesslich Menschen aus dem Volk Israel –, wurden von dem, was sie erlebten, überwältigt. Das war ja mit dem vergleichbar, was an Pfingsten geschehen war! Ja, Gott hatte auch auf die Glaubenden aus den Nationen seinen Geist ausgegossen. Die Taufe mit Heiligem Geist wurde in dem Sinn erweitert, dass sie auch die Nationen einschloss (Apostelgeschichte 11,15.16).
Jetzt waren diese Glaubenden im Haus von Kornelius ebenfalls Glieder am Leib des Christus. Sie gehörten zu der einen Versammlung. Es blieb noch ein Schritt: die christliche Taufe, durch die sich diese Gläubigen öffentlich auf die Seite des Verworfenen stellten. Petrus machte klar, dass diesem Schritt nichts mehr im Weg stand. Er befahl sogar, dass diese im Namen des Herrn getauft würden. Nach der Taufe standen diese Glaubenden auch äusserlich auf christlichem Boden.
Petrus berichtet, was geschehen ist
Auch in Judäa hörten die Gläubigen von dem, was im Haus von Kornelius geschehen war. Freuten sie sich über das mächtige Wirken Gottes? Noch nicht. Als Petrus nach Jerusalem kam, wurde er von solchen, die noch sehr am Einhalten der gesetzlichen Vorschriften festhielten, angegriffen. Der inspirierte Bericht bezeichnet diese als «die aus der Beschneidung».
Als Antwort auf diese Angriffe erzählte Petrus, was er in Joppe im Haus Simons, des Gerbers, erlebt hatte. Gott sorgte dafür, dass der ganze Bericht von Petrus in seinem Wortlaut aufgeschrieben wurde. Zusammen mit der Berichterstattung aus Kapitel 10 haben wir ein doppeltes Zeugnis darüber, wie Gott den Christen, die aus dem Volk Israel stammten, klarmachen wollte, dass jetzt eine neue Zeitperiode begonnen hatte. Die Glaubenden aus den Juden und die aus den Nationen bilden nun zusammen die Versammlung Gottes. Die Verkündigung dieser wichtigen Wahrheit wurde später besonders dem Apostel Paulus anvertraut (Epheser 3,2-12). Er wird als Apostel der Nationen bezeichnet.
Für den Moment beruhigte der ausführliche Bericht von Petrus die Gemüter. Es heisst sogar, dass sie Gott darüber verherrlichten, dass Er auch den Nationen die Buße zum Leben gegeben hatte, ohne zuerst das Judentum anzunehmen. Aber später tauchte das Problem erneut auf. Die Christen mit jüdischem Hintergrund trennten sich nur sehr schwer vom Gesetz und von allem, was ihre frühere Religion ausmachte.
Entstehung der Versammlung in Antiochien
Die Verfolgung, die nach der Steinigung von Stephanus über die Christen hereingebrochen war, hatte nicht nur die in Kapitel 8 beschriebenen Folgen. Manche der Zerstreuten gingen über die Grenzen Israels hinaus. Überall hörten die Menschen – vorläufig nur die Juden – das Evangelium vom Herrn Jesus. In Antiochien gab es Männer, die diese Botschaft auch solchen verkündigten, die keine enge Beziehung zum gesetzlichen Judentum hatten. Mit «Griechen» sind hier gebürtige Juden gemeint, die sich ihrer griechischen Umgebung angepasst hatten. Viele von ihnen wurden gläubig. Sie bekehrten sich zum Herrn.
Diesmal schickte die Versammlung in Jerusalem keine Apostel wie in Apostelgeschichte 8,14, sondern Barnabas, ein Levit, der in Zypern geboren war (Apostelgeschichte 4,36), an den Ort des Wirkens Gottes. Dieser gute und gottesfürchtige Mann hatte Augen für das, was Gottes Gnade gewirkt hatte, und freute sich darüber. Als weiser Mann erkannte er aber auch die Gefahr, in der die Jungbekehrten standen. Deshalb ermahnte er sie, auf dem eingeschlagenen Glaubensweg zu verharren und mit Herzensentschluss beim Herrn zu bleiben. Er wusste, dass es nicht immer glatt gehen würde. Weiter sah er, dass diese Glaubenden Belehrung brauchten. So holte er Saulus aus Tarsus nach Antiochien. Die dortige Versammlung erlebte eine segensreiche Zeit.
Diese Gläubigen dachten nicht nur an sich. Sie waren auch bereit, die verarmten Brüder in Judäa materiell zu unterstützen. Ihre praktische Hilfe sandten sie durch Barnabas und Saulus nach Jerusalem.
Herodes tötet Jakobus und verhaftet Petrus
Obwohl der grösste Christenverfolger, Saulus von Tarsus, sich zum Herrn Jesus bekehrt hatte, hörte die Verfolgung nicht auf. König Herodes liess den Apostel Jakobus töten. Das war ganz nach dem Sinn der Führerschaft der Juden. Daher fuhr er fort und liess auch den Apostel Petrus verhaften und in ein gut gesichertes Gefängnis bringen. Man hatte in Jerusalem vermutlich noch nicht vergessen, wie die zwölf Apostel früher auf unerklärliche Weise aus dem Gefängnis befreit worden waren (Apostelgeschichte 5,18.19). König Herodes wollte sicher gehen und ordnete vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung des gefangenen Petrus an. Nach dem Passahfest plante er, mit diesem prominenten Gefangenen einen Schauprozess durchzuführen. Dass er sich dabei an einem Menschen vergriff, der ein erlöstes Eigentum des allmächtigen Gottes und ein wertvolles Werkzeug in der Hand des Herrn Jesus war, kam Herodes nicht in den Sinn.
Aber die Versammlung wandte sich in ihrer Not mit einem anhaltenden Gebet für Petrus an Gott. Wie wichtig war doch das gemeinsame Gebet der Gläubigen in jener Zeit (Apostelgeschichte 1,14; 4,24; 6,6)! Es ist heute noch genauso nötig und wichtig.
Eine erste Erhörung zeigt uns bereits Vers 6. Obwohl Petrus damit rechnen musste, hingerichtet zu werden, schlief er in jener Nacht tief und fest. Die Versammlung betete für ihn und er ruhte völlig in seinem Herrn und Heiland. Sein Leben lag ganz in der Hand seines Gottes und himmlischen Vaters.
Ein Engel befreit Petrus
In Hebräer 1,14 heisst es, dass die Engel dienstbare Geister sind, die zum Dienst an den Erlösten ausgesandt sind. Hier sehen wir einen von ihnen, der den Auftrag hatte, Petrus aus dem Gefängnis zu befreien.
Normalerweise hätte das Licht in der Gefängniszelle auch die Soldaten wecken müssen. Doch sie schliefen fest. Auch der Lärm der Ketten, die von den Händen des Petrus abfielen, weckte sie nicht. Er selbst muss tief geschlafen haben, denn der Engel musste ihm alles sagen, was er zu tun hatte. Wie im Traum folgte er seinem Führer, bis er schliesslich allein auf der Strasse stand. Da wusste er, dass der Herr ihn auf wunderbare Weise aus der Hand von König Herodes gerettet hatte.
Nun suchte er das Haus von Maria, der Mutter von Johannes Markus auf, das als Versammlungsort der Gläubigen diente. Dort waren viele versammelt, um anhaltend für ihn zu Gott zu beten. Doch als die Erhörung vor der Tür stand, glaubte es ausser der Magd Rhode zuerst niemand. Auch unsere Herzen zeigen manchmal einen solchen Mangel an Gottvertrauen. Wir beten zwar, aber glauben wir auch, dass Gott erhören kann?
Wie gross muss die Freude gewesen sein, als sie Petrus endlich hereinliessen und er leibhaftig vor ihnen stand! Er erzählte, wie der Herr ihn befreit hatte. Sie sollten es den Nichtanwesenden weitersagen. Aber dann verschwand er aus der Stadt. Er ging kein unnötiges Risiko ein.
Das Ende von König Herodes
Die Bestürzung unter den wachhabenden Soldaten muss gross gewesen sein. Sie konnten es sich nicht erklären, wie Petrus verschwunden war. Herodes aber, grausam und unbarmherzig, untersuchte die Sache nicht weiter. Anstelle von Petrus wurden die 16 Soldaten getötet.
Doch der Mann, der sich zuerst an den Aposteln des Herrn vergriff und sich dann unbeeindruckt über die göttliche Befreiung von Petrus hinwegsetzte, konnte dem Allmächtigen nicht entfliehen. Der Moment kam, da Gott eingriff. Der Anlass war ein ganz einfacher. Herodes liess sich von Menschen, die sich ihm mit Schmeichelei unterwarfen, als Gott verehren. «Eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen!», rief das Volk ihm nach seiner Rede zu. Doch Gott gibt seine Ehre keinem anderen (Jesaja 42,8). Er allein ist Gott (5. Mose 6,4; Markus 12,29.32). Manchmal, wie hier bei Herodes, zeigt Er auf der Stelle, wer der wahre Gott ist. Der Mann, der diese Gottesverehrung für sich in Anspruch nahm, musste eines schrecklichen Todes sterben.
Die Verkündigung des Wortes Gottes erreichte immer mehr Leute, die die Botschaft glaubten. Die Feindschaft der Menschen konnte das Werk Gottes nicht aufhalten. Barnabas und Saulus kehrten nach Erfüllung ihres Dienstes von Jerusalem nach Antiochien zurück. Sie nahmen Johannes Markus mit, dessen Mutter ihr Haus den Geschwistern geöffnet hatte, damit sie gemeinsam für Petrus beten konnten. Der Herr hatte für alle drei Männer neue Aufgaben bereit, wie das nächste Kapitel zeigt.
Buchtipp: Gelebter Glaube
Einleitung
Thema
13 Jahre nach der Rückkehr von Esra nach Jerusalem schickt Gott einen weiteren Diener dorthin, um sein Werk zu beleben. Nehemia, der Mundschenk des persischen Königs, bekommt die Aufgabe, die Mauer und die Tore der Stadt Jerusalem wieder aufzubauen.
Feinde von aussen und Widerstand von innen stellen sich Nehemia entgegen. Aber er lässt sich von seinem Auftrag nicht abbringen, bis Jerusalem durch die Mauer und die intakten Tore gegen feindliche Angriffe und fremde Einflüsse geschützt ist.
Einteilung
Kapitel 1 – 2: Die Reise Nehemias nach Jerusalem
Kapitel 3 – 7: Der Bau der Mauer von Jerusalem
Kapitel 8 – 10: Die Neuordnung des geistlichen Lebens
Kapitel 11 – 13: Die Neuordnung des sozialen Lebens
Buchtipp: Lasst uns die Mauer Jerusalems aufbauen!
Nehemia in der Burg Susan
Nehemia war ein in der Gefangenschaft geborener Jude, aber kein Priester wie Esra und auch kein Mann aus der königlichen Linie Davids wie Serubbabel. Hingegen nahm er im Palast des persischen Königs eine hohe und ehrenhafte Stellung ein: Er war sein Mundschenk. Nehemia muss auch sehr wohlhabend gewesen sein, denn später sehen wir, wie er seinen Unterhalt und den Unterhalt derer, die bei ihm waren, selbst bestritt (Nehemia 5,14-18).
Obwohl Nehemia Jerusalem noch nie gesehen hatte, schlug sein Herz für die Stadt Gottes, die Er einst erwählt hatte, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Als sein Bruder Hanani mit einigen Männern aus Juda zu ihm kamen und ihm vom traurigen Zustand Jerusalems erzählten, berührte ihn dies tief. In grosser Trauer und mit Fasten wandte er sich in ernstem Gebet zu Gott.
Der Inhalt dieses Gebets offenbart uns den geistlichen Zustand dieses gottesfürchtigen Mannes. Im Vertrauen wandte er sich in seiner Not an den grossen Gott und rief sein Erbarmen an. Doch er wusste auch um die Ursache der Not: die Sünden des Volkes. Und er, der persönlich keine Schuld hatte, machte sich völlig eins mit den Sünden Israels. Aber dann stützte er sich auf die Verheissungen Gottes, die Er einst dem Volk gegeben hatte (z.B. 5. Mose 30,1-5). Schliesslich bat er um Barmherzigkeit «vor diesem Mann», womit der mächtige persische Könige gemeint war. Ob Gott durch diesen Monarchen seinem Volk zu Hilfe kommen wollte?
Nehemia reist nach Jerusalem
Der Vergleich zwischen Nehemia 1,1 und Nehemia 2,1 zeigt, dass seit der Rückkehr Hananis mehr als drei Monate vergangen waren. Wie viele ernste Gebete werden in dieser Zeit von Nehemia zu Gott aufgestiegen sein! Er wartete mit Geduld auf Gottes Antwort. Doch die schwere Last auf seinem Herzen widerspiegelte sich auf seinem Gesicht. Die Traurigkeit seines Mundschenken blieb dem König nicht verborgen, und er merkte auch, dass es eine Traurigkeit des Herzens war.
Als der König ihn so direkt ansprach, erschrak Nehemia sehr. Würde er beim König in Ungnade fallen? Aber dann gab er eine klare, ehrliche Antwort. Und der König antwortete sehr gnädig. Was mag im Herzen Nehemias vorgegangen sein, als der König ihn direkt fragte: «Um was bittest du denn?»! Doch bevor er antwortete und seinen Herzenswunsch äusserte, betete er nochmals zum Gott des Himmels. Welch ein nachahmenswertes Beispiel echter Abhängigkeit von Gott. Er wollte nichts tun, was Gott nicht gutheissen konnte. Werden wir da nicht an unseren Herrn erinnert, der prophetisch gesagt hat: «Ich aber bin stets im Gebet», und der nur den Willen seines Gottes und Vaters tun wollte (Psalm 109,4; Johannes 4,34)?
Dann legte Nehemia dem König sein Begehr vor: Er möge ihn mit dem Auftrag, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, nach Juda senden. Gott wirkte am Herzen dieses Herrschers, dass Nehemia nicht nur gesandt wurde, sondern auch die nötigen Briefe samt Aufträgen erhielt. Der demütige Mann Gottes sah in allem die gute Hand seines Herrn über sich.
Nehemia besichtigt die Stadt
Als Gesandter des persischen Königs kam Nehemia mit entsprechender militärischer Begleitung nach Juda. Doch nachdem er die gute Hand seines Gottes erfahren hatte, erschien auch der Feind in Gestalt von Sanballat und Tobija auf dem Plan. Wo der Herr ein Werk hat, ist auch der Feind Gottes nicht untätig, um zu stören und wenn möglich zu zerstören. Das ist bis heute so geblieben (1. Korinther 16,9).
Nach drei Tagen machte sich Nehemia mit einigen Getreuen in der Nacht auf den Weg, um sich ein Bild von der Arbeit zu verschaffen, die er in Angriff nehmen wollte. Es muss ein überaus trauriger Gang gewesen sein. Überall sahen sie nur Zerstörung und unüberwindliche Trümmer. Sank ihm nun der Mut, den Wiederaufbau, den Gott ihm ins Herz gegeben hatte, zu beginnen? Nein, in keiner Weise. – Am nächsten Tag besprach er sich mit den Verantwortlichen des Volkes. Er machte ihnen keine Vorwürfe für ihre Untreue und ihr Versäumnis. Er trat auch nicht als überlegener Führer auf. Er stellte sich auf eine Stufe mit ihnen: «Ihr seht das Unglück, in dem wir sind.» Dann verband er seinen Aufruf zum Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems mit dem, was Gott gewirkt hatte. Und die Antwort? «Wir wollen uns aufmachen und bauen!»
Die erste Reaktion der Feinde war Spott und Verachtung. Nehemias Antwort ist bemerkenswert. Er verteidigte sich nicht, sondern berief sich auf seinen Gott. Als seine Knechte wollten sie sich einsetzen, aber in klarer Trennung von den Spöttern: «Ihr habt weder Teil noch Recht noch Gedächtnis in Jerusalem.»
Der Bau der Mauer und ihrer Tore
Hier finden wir die Einzelheiten über den Bau der Stadtmauer. Was hat sie für eine geistliche Bedeutung? In Jerusalem standen Altar und Haus Gottes, was von Anbetung, Gottesdienst, aber auch vom Wohnen Gottes unter den Seinen spricht. Ohne Mauer war der Tempel den Feinden schutzlos ausgeliefert. – Ohne heilige Absonderung von aller Art des Bösen besteht die Gefahr, dass die Anbetung durch menschliche Einflüsse verwässert wird und Personen ins Haus Gottes kommen, die sich Christen nennen, aber kein Leben aus Gott haben. Wie leicht können sich ohne Mauer der Absonderung falsche Lehren einschleichen! Aber so wie die Mauer Jerusalems Tore hatte, so soll in geistlicher Hinsicht der Zugang zum Tisch des Herrn und zum Haus Gottes jedem wahren Gläubigen offen stehen.
Am Anfang steht das Schaftor. Es erinnert an die Worte unseres Herrn: «Ich bin die Tür der Schafe … Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden» (Johannes 10,7.9).
Gott sah alle, die sich am Bau der Mauer beteiligten. Ihm fielen auch die Vornehmen auf, die zu stolz für diese Schwerarbeit waren. Die Goldschmiede und Salbenmischer werden besonders erwähnt, denn ihre Hände waren sicher nicht gewohnt, Maurerarbeit zu leisten. Trotzdem halfen sie mit. In den Versen 9 und 12 werden zwei «Oberste» genannt. Auch diese hohen Beamten und besser gestellten Leute griffen mit an, sogar die Töchter des einen von ihnen halfen mit (Vers 12). Welch ein Einsatz für die Sache des Herrn!
Verschiedene Motive beim Bauen
In den Versen 13-15 werden drei Tore genannt, die ausgebessert wurden. Ihre Namen und ihre Reihenfolge erinnern an wichtige geistliche Tatsachen in unserem Glaubensleben. Das Taltor spricht von Selbsterkenntnis und Demut. Oft erkennt man die Verdorbenheit seines eigenen Herzens erst Jahre nach der Bekehrung. Das führt dann zum Misttor, durch das man den Abfall der Stadt hinausführte. Das Erkennen des eigenen, verderbten Ichs führt zu einem täglichen Selbstgericht, bei dem man die Auswüchse der alten Natur verurteilt (Kolosser 3,5). Wenn wir in unserem Glaubensleben auf diese Weise nach praktischer Reinheit streben, wird sich der Heilige Geist auch ungehindert entfalten können. Davon redet das Quelltor (Epheser 4,30).
Baruk in Vers 20 war besonders eifrig am Werk. Wie schön, dass Gott diesen Einsatz nicht unerwähnt lässt! – Der in Vers 20 und 21 erwähnte Eljaschib war der Hohepriester, der mit seinen Brüdern das Schaftor baute (Vers 1). Warum baute er nicht am Mauerstück vor seiner Haustür? Dieser Mann, obwohl er Hoherpriester war, ist das Bild eines Gläubigen, der in seiner eigenen Familie (Haus) die Absonderung vernachlässigt. So kann die Welt mit all ihren Ideen ins Haus eindringen – und Schaden anrichten, besonders bei den Kindern.
Betrachtet man die Arbeit Eljaschibs am Schaftor genauer, kommt ein zweiter negativer Punkt ans Licht: Er baute ein Tor ohne Riegel, d.h. es war nicht verschliessbar! Den Grund dafür finden wir in Nehemia 13,4.5: Tobija, ein Feind der Juden, konnte so ungehindert in die Stadt und in den Tempel kommen.
Die Verantwortung beim Bauen
Im Gegensatz zu Eljaschib gab es manche, die «ihrem Haus gegenüber» ausbesserten (Nehemia 3,23.28.29). Sie nahmen die persönliche Verantwortung ernst, die jeder Mann und Vater für seine Familie hat, um sie vor den bösen Einflüssen, die von der Welt in unser Leben als Glaubende eindringen wollen, zu schützen. Sind wir uns dieser Verantwortung bewusst? Wissen wir z.B., was unsere Kinder lesen, sehen und hören?
Vom Wassertor – einem Bild vom Wort Gottes – wird nicht gesagt, dass es ausgebessert wurde (Vers 26). Gott hat uns mit seinem Wort etwas Vollkommenes, absolut Gültiges und Verlässliches und unveränderlich ewig Bestehendes in die Hand gegeben (Matthäus 24,35).
Die letzten beiden erwähnten Tore sind das Osttor (Vers 29) und das Tor Miphkad, was Musterung oder Zählung bedeutet. Schemaja war der Hüter des Osttores. Dieses erinnert an unsere Hoffnung: die Erwartung des Kommens unseres Herrn, des glänzenden Morgensterns. Wie leicht kann dies in Vergessenheit geraten, sodass wir unseren Heiland nicht mehr täglich erwarten.
Das Tor Miphkad weist uns auf den Richterstuhl des Christus hin. Nach der Entrückung, wenn wir beim Herrn sein werden, muss jeder von uns vor diesem Richterstuhl offenbar werden (2. Korinther 5,10). Dort wird jede Unstimmigkeit, jede ungelöste Frage zwischen uns und unserem Herrn bereinigt werden, damit wir ewig in vollkommener Harmonie mit Ihm leben können. Bei jener Gelegenheit gibt es auch Lohn für die Treue in unserem Leben. Dann werden auch alle, die am Bau der Mauer mitgeholfen haben, ihren Lohn empfangen.
Erster Widerstand der Feinde
Das Bauen der Mauer konnte den Feinden der Juden nicht verborgen bleiben. Aus ihrem anfänglichen Spott und ihrer Verachtung (Nehemia 2,19) wurden nach und nach Zorn und Ärger. Ihre Fragen, die immer noch viel Spott enthielten, zeigen ihre zunehmende Wut. Tobija sprach von einem Fuchs, der die steinerne Mauer auseinander reissen könnte. Warum ärgerten sie sich dann so sehr, wenn das Ganze nur eine Bagatelle war? Es war eben keine unbedeutende Kleinigkeit, sondern ein Werk Gottes. Das spürten die Feinde.
Als Antwort auf diese verbalen Angriffe betete Nehemia zu Gott. Dieser gottesfürchtige Mann suchte angesichts der Verunglimpfung der Juden seine Zuflucht im Gebet. Ähnlich reagierte auch König Hiskia, als er und die Bewohner Jerusalems von den Assyrern verspottet und Gott, der Herr, verhöhnt wurden (Jesaja 36; 37,1).
Die Verse 36 und 37 enthalten eins der vielen kurzen Gebete Nehemias, die uns in diesem Buch mitgeteilt werden (Nehemia 2,4; 3,36.37; 5,19; 6,14; 13,14.22.29). Mit seinen Worten legte er die ganze Sache in die Hand Gottes. Der Wortlaut dieses Gebets erinnert an manche Psalmen, und wir müssen bedenken, dass dies nicht zur Zeit der Gnade geäussert wurde, in der wir leben. Wir bitten nicht um Rache an unseren Feinden, sondern um Gnade und Barmherzigkeit. Aber damals entsprach dies den Gedanken Gottes.
Die Feinde konnten mit ihren Reden die Bauenden nicht von ihrem Werk abhalten. «Das Volk hatte Mut zur Arbeit.»
Bedrohung von aussen
Das Werk machte Fortschritte. Die Mauer war bereits bis zur halben Höhe fertig und die Lücken begannen sich zu schliessen. Als die Feinde sahen, dass sie mit ihrem Hohn und Spott keinen Erfolg hatten, verbündeten sie sich mit anderen, um mit Gewalt gegen Jerusalem zu kämpfen.
Wieder nehmen Nehemia und die Bauenden im Gebet Zuflucht zu Gott. Abhängigkeit ist das Erste. Aber dann treffen sie Vorsichtsmassnahmen gegen die Feinde und stellen Tag und Nacht Wachen auf. Genügte das Gebet nicht? Es wäre Vermessenheit gewesen, die Hände in den Schoss zu legen und der eigenen Verantwortung nicht nachzukommen mit dem Hinweis, man vertraue auf Gott! Ihr Verhalten stand nicht im Widerspruch zum Vertrauen auf Gott.
Es gab aber auch Entmutigung unter den Arbeitenden. Ähnliches erfuhr auch der Apostel Paulus (2. Korinther 7,5). Darauf scheint Nehemia nicht reagiert zu haben. Das Beste war, weiter zu beten und zu wachen.
Die Feinde versuchten einen Überraschungsangriff. Doch sie rechneten nicht mit Gott, der sein Volk beschützte. – Die Juden, die neben den Feinden wohnten und von ihnen beeinflusst wurden, versuchten, die Bauenden wiederholt zum Aufgeben ihrer Absonderung für Gott zu bewegen. Diese aber blieben standhaft, wachsam und abwehrbereit. Nehemia selbst handelte mit Glaubensenergie. Er sprach dem Volk Mut zu und richtete ihre Blicke auf Gott, der ihre Kraftquelle war.
Schutzmassnahmen
Der listige Angriff der Feinde wurde vereitelt. Sie mussten einsehen, dass Gott für sein Volk handelte, und nicht zuliess, dass sie ihre bösen Pläne verwirklichen konnten.
Auch wir Christen werden aufgefordert, dem Teufel standhaft im Glauben zu widerstehen. Dann wird er den Rückzug antreten (1. Petrus 5,8.9; Jakobus 4,7).
Auch wenn der Feind sich diesmal zurückzog, blieben die Bauenden wachsam. Ein Teil der Diener Nehemias übernahm die militärische Verteidigung, während die anderen am Werk arbeiteten. Die Juden ihrerseits bauten mit gegürtetem Schwert. Sie waren sozusagen mit Werkzeug und Waffe ausgerüstet, um je nach Situation das eine oder das andere zu gebrauchen.
Ein weiteres Problem war die Weitläufigkeit der Baustelle. Überall auf der Mauer waren einige an der Arbeit. Bei einem Angriff an irgendeiner Stelle sollten alle ihre Arbeitsplätze verlassen und mit ihren Waffen zur Angriffsstelle eilen. Der Mann mit der Posaune neben Nehemia würde das Signal dazu geben. Doch sie stützten sich nicht auf ihre Kraft, sondern sagten: «Unser Gott wird für uns kämpfen!»
Dadurch, dass die Mauer so gut bewacht werden musste, erschwerte sich die Bauarbeit. Sie getrauten sich nicht einmal mehr, zum Schlafen die Kleider auszuziehen. Wie lange würden sie eine solche Doppelbelastung aushalten? So lange, wie sie sich ganz auf Gott stützten (Epheser 6,10-13).
Hindernisse von innen
Dieses Kapitel zeigt uns den inneren Zustand des Volkes. Da stand es nicht zum Besten. Die Arbeit an der Mauer war ein Dienst der Liebe. Er wurde freiwillig getan. Es gab keine Bezahlung dafür. Bei vielen kam durch ihre Mitarbeit am Bau der Mauer die Arbeit auf ihren Feldern zu kurz. Zudem muss es eine Hungersnot gegeben haben, und die königlichen Steuern drückten manche. Diese Umstände nützten die wohlhabenden Juden aus, um sich an den ärmeren unter ihren Brüdern zu bereichern. Jetzt kam die Not vor Nehemia.
Wenn der Feind durch Angriffe von aussen nicht zum Ziel kommt, versucht er es innerhalb der Gläubigen. Diese Taktik wandte er auch unter den ersten Christen an (Apostelgeschichte 6,1).
Die Unterdrückung der Armen ist in Gottes Augen sehr verwerflich. Das bestätigen uns sowohl das Alte als auch das Neue Testament (Amos 2,6; 5,12; 8,4; Sprüche 14,31; 22,16; 28,3; Jakobus 5,1-6). Wir können daher den Zorn Nehemias verstehen. Doch bevor er sich äusserte, überlegte er die Sache vor dem Herrn.
Dann redete er den Edlen und Vorstehern ernst ins Gewissen. Sie hatten gegen das Gesetz verstossen (2. Mose 22,25; 3. Mose 25,36.37; 5. Mose 23,20; Psalm 15,5). Nehemia zeigte ihnen, dass ein solches Verhalten gegenüber ihren armen Brüdern im Gegensatz zur Erlösung aus der Gefangenschaft stand. Diese Sache würde auch nicht zur Ehre Gottes ausschlagen (Vers 9). Dem Vorschlag, alles Abgenommene zurückzugeben und die Zinsen zu erlassen, wurde allgemein zugestimmt. Resultat: «Sie lobten den Herrn!»
Die Grosszügigkeit Nehemias
Die Schlussverse des Kapitels zeigen etwas von der Freigebigkeit und Selbstverleugnung dieses Mannes Gottes. Sicher war Nehemia ein wohlhabender Mann, sodass er aus eigenen Mitteln täglich 150 Mann bewirten konnte. Doch die Edlen und Vorsteher gehörten auch zu den Reichen. Aber anstatt Freigebigkeit zu zeigen, nutzten sie die Notlage der Armen aus, um sich noch mehr zu bereichern.
Wir denken an den Apostel Paulus im Neuen Testament, der eine ähnliche Selbstlosigkeit offenbarte (Apostelgeschichte 20,33-35; 1. Korinther 4,12; 2. Korinther 12,14-17; 1. Thessalonicher 2,9.10).
Wir sind weder Statthalter wie Nehemia noch Apostel wie Paulus. Trotzdem dürfen auch wir ein offenes Herz und eine offene Hand haben. Es wird nicht nur zum Wohl unserer Nächsten ausschlagen, sondern auch dem Herrn wohlgefällig sein. Er hat ja mehr gegeben, als wir je geben können: In seiner Liebe hat Er am Kreuz sich selbst für uns hingegeben (Galater 2,20; Epheser 5,2).
In allem, was Nehemia für sein Volk tat, wusste er, dass Gott alles kennt und einmal alles belohnen wird, was für Ihn getan wurde, auch wenn es Menschen zugut kam. Wir wollen nicht wegen der Belohnung Gottes freigebig sein. Und doch ist es ermunternd, daran zu denken, dass Gott nichts entgeht und Er einmal jede Treue der Seinen belohnen wird.
Die List der Feinde
Das Werk gedieh. Die Lücken waren geschlossen. Es mussten nur noch die Flügel in die Tore eingesetzt werden. Nun versuchten die Feinde mit einer neuen List, das Werk zum Stillstand zu bringen. Sie schlugen ein freundschaftliches Zusammentreffen ausserhalb Jerusalems vor. Sie täuschten damit den Versuch einer Art von Zusammenarbeit vor. Der aufrichtige Nehemia durchschaute ihre Taktik und antwortete, er könne das Werk nicht im Stich lassen. – Praktizierte Absonderung von der Welt, auch von der religiösen, bedeutet auch für uns Schutz und Bewahrung.
Nach vier erfolglosen Versuchen schrieben die Feinde einen offenen Brief. Sie sprachen von einem bösen Gerücht, über das sie gemeinsam beraten wollten. Nehemia hatte ein absolut gutes Gewissen. Deshalb konnte er ihnen antworten: «Es ist nicht geschehen nach diesen Worten … aus deinem eigenen Herzen erdichtest du sie.»
Wieder erkannte er ihre Absicht: Die Furcht vor der Reaktion des Königs sollte die Energie der Juden lähmen. – Wenn wir aufrichtig auf einem Weg des Gehorsams gegenüber Gottes Wort vorangehen, wird der Herr uns einen klaren Sinn und ein gesundes geistliches Unterscheidungsvermögen erhalten, um die Angriffe des Feindes zu durchschauen.
Trotz allem blieb Nehemia demütig. Er stützte sich nicht auf seinen Verstand und seine Fähigkeiten, sondern bat Gott in aller Demut: «Und nun, stärke meine Hände!»
Trotz Widerstand wird der Bau vollendet
Nachdem Nehemia die Angriffe der Feinde von aussen abgewehrt hatte, begegnete ihm ein falscher Prophet, der im Auftrag Tobijas und Sanballats handelte. Schemaja sprach von einer Morddrohung gegen Nehemia und schlug ihm vor, sich im Tempel zu verstecken.
Die Antwort des Mannes Gottes bestand aus zwei Teilen. Zunächst zeigte sich die Furchtlosigkeit dessen, der auf Gott vertraut. Zweimal finden wir in Gottes Wort die Aufforderung: «Fürchtet nicht ihre Furcht» (Jesaja 8,12; 1. Petrus 3,14). Nach diesem Motto lebte Nehemia. – Im zweiten Teil seiner Antwort erinnert er daran, dass er weder Priester noch Levit war und kein Recht hatte, in den Tempel hineinzugehen. Gott hätte ihn für diese Sünde bestrafen müssen, und genau das hofften die Feinde zu erreichen. – Diese bösen Absichten haben Nehemia zu schaffen gemacht. Er musste darüber mit Gott reden (Vers 14).
In erstaunlich kurzer Zeit wurde dieses grosse Werk mit der Hilfe des Herrn fertig gestellt. Es blieb nicht ohne nachhaltigen Eindruck auf die Feinde. Sie mussten sich vor Gott geschlagen geben.
Trotzdem gaben sie nicht auf. Sie versuchten weiterhin, Nehemia einzuschüchtern. So lange wir hier leben, bleibt Satan der Widersacher Gottes und Feind der Erlösten. Die Edlen von Juda standen in regem Kontakt mit Tobija, weil sie verwandtschaftlich mit diesem «ammonitischen Knecht» (Nehemia 2,19) und seinen Nachkommen verbunden waren. Diese Verbindung mit Fremden nahm jenen Juden das klare Unterscheidungsvermögen. Entsprechend beurteilten sie Tobija.
Die Sicherheit der Stadt
Nun war die Mauer gebaut und die Tore funktionierten. Zwei Männern wurde jetzt die Aufsicht über die Stadt Jerusalem übertragen: Hanani, dem Bruder Nehemias, und Hananja, einem sehr treuen und gottesfürchtigen Mann. Die Anordnungen bezüglich der Tore ist sehr wichtig. Es ging nicht nur darum, Torhüter und Wachen aufzustellen. Es war ebenso nötig, die Tore erst bei Tageslicht zu öffnen und sie auch vor dem Dunkelwerden wieder zu schliessen (Nehemia 13,19). Im hellen Licht erkannte man klar, wer ein Recht hatte, in die Stadt hineinzugehen und wer nicht. Und wenn es heute um Menschen geht, die in die Gemeinschaft der Gläubigen am Tisch des Herrn kommen möchten – gewissermassen durch das Tor in die Stadt und zum Heiligtum eingehen wollen –, dann ist das Licht genauso nötig wie damals. Nur im Licht des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes erkennt man, ob so jemand Leben aus Gott hat oder nicht. Nur wahre Christen haben ein Anrecht an dieser Gemeinschaft. Ungläubige dürfen nicht am Mahl des Herrn teilnehmen.
Der geräumige, aber bis dahin spärlich bewohnte Platz innerhalb der Stadtmauer bewog Nehemia, die Führer des Volkes zu versammeln und sie zu verzeichnen. Vielleicht würde Gott eine Lösung zeigen, um Jerusalem zu bevölkern. Dabei kam das Verzeichnis derer zum Vorschein, die zuerst unter Serubbabel heraufgezogen waren. So entsprechen die Verse 6-72 mit geringen Abweichungen den Versen in Esra 2,1-70.
Fehlende Geschlechtsregister
Die Verse 61-65 erinnern daran, dass eine Anzahl Menschen mit den Juden aus Babel gekommen waren, die ihre Zugehörigkeit zum Volk Israel nicht belegen konnten. Konnte man nicht auf ihre Aussagen gehen und sie zum Volk zählen? Nein. Der Tirsatha – das ist der persische Titel des Statthalters – verweigerte ihnen den Zutritt zum Priestertum und gestattete ihnen nicht, vom Hochheiligen zu essen. Zuerst musste durch die Urim und Tummim Gott befragt werden.
Heute sollte man vorsichtig sein, wenn jemand sagt: «Ich glaube an den Herrn Jesus.» Sind die Kennzeichen wahren Lebens aus Gott auch vorhanden? Liebt so jemand Gott und die anderen Gläubigen?
Die Zahlen in den Versen 69-71 stimmen nicht mit denen in Esra 2,68.69 überein. Doch das ist kein Widerspruch. In Esra 2 heisst es: «Einige von den Häuptern der Väter gaben freiwillig für das Haus Gottes.» In unserem Kapitel wird das aufgezählt, was der Tirsatha gab, was ein Teil der Häupter der Väter gab und was das übrige Volk gab.
Durch die Wiederholung der Aufzählung derer, die zuerst zurückgekehrt waren, wird jener Überrest mit dem Werk Nehemias verbunden. Ungefähr 80 Jahre mochten seit der Rückkehr unter Serubbabel vergangen sein. Viele von den Aufgezählten waren vermutlich bereits gestorben. Doch sie werden in Ehren gehalten, denn das, was sie in der ersten Zeit taten, machte es möglich, dass das Werk in den Tagen Nehemias durchgeführt werden konnte.
Das Wort Gottes wird vorgelesen
Wir haben beim Lesen von Kapitel 3 daran gedacht, dass das Wassertor vom Wort Gottes spricht. Und nun wurde auf dem Platz vor diesem Tor das Wort Gottes dem ganzen versammelten Volk vorgelesen. Die Leute hatten sich im siebten Monat wie ein Mann versammelt und verlangten, das Wort Gottes zu hören.
Jeder geistlichen Erweckung – und um eine solche geht es in diesem Kapitel – liegt das Wort Gottes zugrunde. Wenn man dieses Wort glaubensvoll annimmt und Gott bereitwillig gehorcht, kann der Herr eine Wiederbelebung schenken. Also: Zurück zur Bibel!
Welch eine Freude muss es für Esra gewesen sein, als er gebeten wurde, das Gesetz hervorzuholen! Er, der das Wort Gottes immer geschätzt und hoch geachtet hatte, durfte es jetzt weitergeben (Esra 7,6.10). Vers 5 zeigt etwas von der Ehrfurcht des Volkes gegenüber den inspirierten heiligen Schriften: Sie standen auf.
Bevor Esra und die weiteren Männer auf dem Gerüst – vermutlich waren es Leviten – mit dem Vorlesen begannen, beteten sie zu Gott und lobten Ihn. Lasst auch uns die Bibel unter Gebet lesen. Dann wird Gott unsere Lektüre segnen.
Manches in der Bibel ist nicht so leicht zu verstehen. Gott sorgte damals dafür, dass solche da waren, die den Sinn des Gelesenen angeben und es verständlich machen konnten. Heute schenkt der Herr seiner Versammlung Gaben (Hirten, Lehrer, Evangelisten), um die Menschen im Wort zu unterweisen (Epheser 4,11-16).
Das Wort Gottes wird umgesetzt
Als das Volk die Worte des Gesetzes hörte, begannen die Menschen zu weinen. Ihre Gewissen waren erwacht, und sie erkannten ihre und die Sünden des Volkes. Ihr Trauern zeugte von Busse und Selbstgericht. Darauf hatte Gott durch die Führer des Volkes und die Leviten ein Wort der Ermunterung für sie. Sie sollten sich nicht länger betrüben, sondern sich im Herrn und am Herrn freuen. In ihrer neu gewonnenen Freude dachten sie auch an die, für die nichts zubereitet war. Es gab ein grosses Freudenfest.
Am nächsten Tag kamen nicht mehr alle zusammen, sondern nur noch die Verantwortlichen, um mehr aus dem Wort des Gesetzes zu hören. Dabei stiessen sie auf die göttlichen Anweisungen bezüglich des Laubhüttenfestes. Sofort gehorchten sie dem Wort Gottes und holten sich Zweige, um Hütten zu bauen nach der Vorschrift. Auf diese Weise hatte das Volk das Laubhüttenfest seit den Tagen Josuas nicht mehr gefeiert! Sie gingen sozusagen an den Anfang zurück. Wir begreifen, dass Gott ihnen dabei eine grosse Freude schenkte.
Das Laubhüttenfest spricht vom zukünftigen Tausendjährigen Reich, wenn Gott alle Ziele mit seinem irdischen Volk Israel erreicht haben wird. Dann werden sie eine Zeit grosser Freude und überströmenden Segens unter der Herrschaft von Jesus Christus, ihrem Messias, erleben. Jene Zeit war ein schwaches Abbild von dem, was dieses Volk in der Zukunft erwartet.
Demütigung vor Gott
Das Laubhüttenfest dauerte vom 15. bis zum 23. Tag des siebten Monats. An jedem Tag während dieses Festes las man aus dem Gesetz vor. Dabei kam manches ans Licht, was bei den Juden nicht in Ordnung war, vor allem hatten sie sich verwandtschaftlich mit anderen Völkern verbunden. Sie hatten die gottgewollte Absonderung missachtet. Nun sahen sie ihre Sünden ein und bekannten sie dem Herrn, ihrem Gott, und sonderten sich aufs Neue ab. Eine solche Beugung war Ihm wohlgefällig. Darauf konnte Er mit Vergebung antworten (Vers 17).
Nun riefen die Leviten das Volk zum Lob Gottes auf: «Steht auf, preist den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit!» Sobald unsere Herzen mit Gott in Ordnung sind, dürfen und sollen wir Ihn freimütig anbeten. Er ist es würdig, dass seine Erlösten Ihn loben und preisen.
Dann folgt ein langes Gebet – es ist das längste, in seinem Wortlaut aufgeschriebene Gebet in der Bibel. Es gleicht in mancher Hinsicht dem Gebet Daniels (Daniel 9) und dem von Esra (Esra 9). Die Betenden dachten zuerst an Gott. Er ist «der da ist», d.h. der unveränderlich in sich selbst ewig Bestehende. Er ist auch der Schöpfer und Erhalter von allem. Und dieser allmächtige Gott hatte einst Abraham erwählt und ihm bedingungslose Versprechen gegeben. Dieser Abraham wurde der Stammvater Israels. Mit ihm begann sozusagen die Geschichte des irdischen Volkes Gottes.
Ein inständiges Gebet
Abraham war der Ursprung des Volkes Israel. Doch die nationale Geschichte des Volkes begann in Ägypten, als sich die Nachkommenschaft Jakobs, des Enkels von Abraham, zu einem Volk vermehrte.
In unserem Abschnitt denken die Beter vor allem an das gnädige Handeln Gottes mit Israel, zu dem Er sich als sein Bundesgott bekannte (2. Mose 3,13-18). Sie erinnern sich an das Elend ihrer Vorfahren in Ägypten und an die göttliche Befreiung aus der Sklaverei. Und welch eine Fürsorge erfuhren sie auf ihrer Wanderung durch die Wüste! Ja, Gott war sogar auf den Sinai herabgestiegen, um seinem Volk «gerade Rechte und Gesetze der Wahrheit, gute Satzungen und Gebote» zu geben.
Die Aufzählung von dem, was Gott alles für sein Volk getan hat, lässt die Frage aufkommen: «Was hätte Er noch mehr für sein Volk tun können?» Wir müssen antworten: «Es hat ihnen an nichts gefehlt.»
Das Gleiche gilt auch für uns, die der Herr aus dem Elend der Sünde und der Gebundenheit Satans erlöst hat. Er hat den Feind am Kreuz besiegt. Er hat uns nach unserer Bekehrung auf einen Weg in seine Nachfolge gestellt, auf dem uns nichts fehlt. Wir dürfen uns seiner Führung durch sein Wort und seinen Geist erfreuen. In der Bibel hat Er uns seine Gedanken mitgeteilt und seinen Willen offenbart. Sein Wort ist uns geistliche Nahrung und Erquickung für unsere Seele. Und doch, wie oft gleichen wir den undankbaren, murrenden und ungehorsamen Israeliten!
Rückblick auf die Geschichte Israels (1)
Weiter bekannten die Beter, dass die Gunst, in der ihr Volk vor Gott stand, und die Vorrechte, die sie von Ihm genossen, ihre Vorväter weder dankbar noch gehorsam gemacht hatten.
In den Versen 17 und 18 geben sie die Geschichte nicht chronologisch wieder. Zuerst reden sie von der Widerspenstigkeit, in der sie sich einen Anführer setzen wollten, der sie nach Ägypten zurückführen sollte (4. Mose 14), und dann vom gegossenen Kalb, das sie sich am Sinai machten (2. Mose 32). Es scheint, dass sie die Wirkung zuerst erwähnen und dann auf die tiefer liegende Ursache zurückgehen: Sie hatten ihren Gott verlassen und an seine Stelle ein sichtbares Götzenbild gestellt.
Und was sagte Gott zu einem solchen Verhalten? In seinen Regierungswegen konnte Er seinem Volk die Züchtigungen nicht ersparen. Aber in seiner unendlichen Barmherzigkeit und Güte verstiess Er es nicht. Als ein Gott der Vergebung sorgte Er weiter für sie, versorgte sie 40 Jahre lang in der Wüste und brachte sie schliesslich in das verheissene Land. – So handelt unser Gott und Vater heute mit uns. Auch wenn wir leider Fehltritte zu beklagen haben, wissen wir, dass Er uns nicht aufgibt. Auf ein aufrichtiges Bekenntnis dürfen wir die väterliche Vergebung erfahren (1. Johannes 1,9). Und im Blick auf das Kommen des Herrn zur Entrückung lesen wir von der Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, die wir zum ewigen Leben erwarten (Judas 21).
Rückblick auf die Geschichte Israels (2)
Die Güte und Barmherzigkeit Gottes brachte das Volk Israel schliesslich in das Land der Verheissung und liess es darin all das in Vers 25 aufgezählte Gute geniessen. Doch die Wohlfahrt führte das Volk von Gott weg. Sie empörten sich gegen Ihn und warfen sein Gesetz hinter ihren Rücken. Ob in der Wüste oder im Land, das Herz der Menschen änderte sich nicht!
Auch in jener Zeit blieb Gott nicht untätig. Er erweckte Propheten, die die Menschen zu Ihm zurückführen sollten. Doch die meisten dieser Männer Gottes wurden abgelehnt, verfolgt und umgebracht. Weiter versuchte Gott durch Bedrängnis von aussen, die Menschen wieder zu sich zu ziehen. Diese Nöte trieben sie ins Gebet. Sie begannen aufs Neue zu Gott zu rufen. Doch sobald Gott ihnen Erleichterung schenkte, wurde offenbar, wie oberflächlich ihre Umkehr war: «Sie taten wieder Böses.» Schliesslich vertrieb Gott sie aus ihrem Land und gab sie in die Hand der Völker der Länder – ohne ihnen aber den Garaus zu machen. Wie gnädig und barmherzig ist doch Gott!
Auch wir erleben dies heute. Jahrhunderte lang lässt Gott schon das Evangelium der Gnade verkündigen – obwohl die Christenheit sich immer weiter von Ihm und seinen Grundsätzen entfernt. Wie mancher hat in äusserer Not zu Gott gebetet und eine zeitliche Errettung erlebt. Kam es dabei aber auch zu einer echten Umkehr im Herzen? Oder ging das Leben, nachdem Erleichterung eingetreten war, im alten Stil – ohne Gott – weiter?
Beugung vor Gott
Die Beter rechtfertigten sich nicht selbst. Bei aller Aufzählung der Übertretungen und Verfehlungen ihrer Vorväter und ihrer eigenen Sünden versuchten sie in keiner Weise, die Dinge zu beschönigen oder zu entschuldigen. Sie verurteilten sich selbst und anerkannten das gerechte Tun Gottes «nach der Wahrheit». Gleichzeitig wandten sie sich an seine Barmherzigkeit. Sie verbanden ihre gegenwärtige notvolle Lage mit den vergangenen Verfehlungen und sagten: «Lass nicht gering vor dir sein all die Mühsal, die uns betroffen hat.» Sie verschwiegen auch nicht die Ursache ihrer grossen Bedrängnis: das Abweichen und den Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes und die Vernachlässigung des wahren Gottesdienstes.
Wie ernst reden diese Worte zu uns! Die Christenheit ist heute mehr denn je von Ungehorsam gegenüber den Anweisungen und Grundsätzen der Bibel und von eigenwilligem Gottesdienst geprägt. Wie sieht es da in unserem persönlichen Leben aus?
Die Verse 36 und 37 zeigen noch einen weiteren wichtigen Grundsatz, der auch für unser Leben gilt. Gott ist immer bereit, auf ein aufrichtiges Bekenntnis hin, zu vergeben. Aber es gibt Folgen unserer verkehrten Wege oder unseres Abweichens von Ihm. Diese nimmt Er oft nicht weg.
So waren die Juden wohl in ihr Land zurückgekehrt, aber nicht mehr als freies Volk. Sie blieben Knechte des persischen Königs. Doch Gott will Gnade und Barmherzigkeit schenken, damit die Folgen unserer Sünden nicht zu schwer werden und wir sie tragen können.
Ein Bund wird geschlossen
Die damaligen Juden hatten den Wunsch, Gott zu gehorchen. Sie unterstrichen ihren Vorsatz mit einem festen Bund. Alles wurde schriftlich festgehalten und namentlich untersiegelt. Gott sah, dass jene Obersten, Leviten und Priester Ihm wirklich gehorchen wollten (Vers 30). Darum hielt Er in seinem ewigen Wort die Namen derer fest, die den Bund unterzeichneten. Anderseits verschweigt Gott nicht, dass der Mensch unfähig ist, durch eigene Anstrengung dem Wort gemäss zu leben. Schon bald wurde der Bund gebrochen (Nehemia 13).
Auch wir vermögen nicht aus eigener Willenskraft ein gottesfürchtiges Leben zu führen, sondern nur mit der Gnade, die der Herr uns schenkt und in der Kraft des Geistes, der in uns wohnt (Römer 7,22-25; 8,1-4).
In den Versen 30-32 verpflichtete sich das Volk in dreierlei Hinsicht:
- In Bezug auf ihr persönliches Leben wollten sie dem durch Mose gegebenen Gesetz Gottes gehorchen.
- Bezüglich der sie umgebenden Nationen wollten sie eine heilige Absonderung aufrechterhalten.
- Gott gegenüber verpflichteten sie sich, den Sabbat, die heiligen Tage und das Gesetz des siebten Jahres zu beobachten.
Von Vers 33 an bis zum Schluss des Kapitels geht es noch um eine weitere Verpflichtung: die Unterstützung des Dienstes des Hauses Gottes.
Wiederbelebungen, wie damals eine stattfand, gibt es ab und zu auch in der Christenheit. Gott schenkt Erweckungen, damit wir uns neu auf seine Gnade besinnen und auf die Beziehung, in die Er uns gebracht hat (z.B. 1. Johannes 3,1; Johannes 16,27; 14,2.3).
Der Unterhalt des Hauses Gottes
In diesem Kapitel wird der Unterhalt der Stadtmauer und der Tore mit keinem Wort erwähnt. Hingegen nimmt die Beschreibung der Verpflichtungen in Bezug auf das Haus Gottes einen auffallend grossen Platz ein. Warum ist das so? Im Haus Gottes werden die Grundsätze der göttlichen Ordnung sichtbar. Hier zeigt es sich, wie weit wir die Rechte Gottes, seine Heiligkeit, ja, Ihn selbst anerkennen. Das Verhalten gegenüber dem Haus Gottes wird damit zu einem Prüfstein unserer Treue gegenüber Gott und seinen Grundsätzen. Das war damals so und gilt heute noch.
Heute ist das Haus Gottes kein materielles Gebäude mehr. Es besteht aus allen wahren Gläubigen und wird sichtbar in der örtlichen Versammlung, d.h. da, wo Gläubige im Namen des Herrn zusammenkommen.
Diese Verse in Nehemia 10 lehren uns in bildlicher Sprache, was nötig ist, damit der Dienst im Haus Gottes ohne Behinderung durchgeführt werden kann. Sie machen deutlich, dass es auf den Einsatz und den Gehorsam jedes Einzelnen ankommt. Es beginnt bei unserem persönlichen Leben. Der Einfluss unseres praktischen Lebens auf den Zustand und das Gedeihen der örtlichen Versammlung ist viel grösser, als wir annehmen. Und wie nötig ist die Unterstützung der Diener des Herrn (vorgebildet durch die Leviten) durch Gebet und materielle Gaben!
Möge es das Anliegen von uns allen sein, «das Haus unseres Gottes – die örtliche Versammlung – nicht zu verlassen», sondern uns ganz dafür einzusetzen.
Die Besiedelung der Stadt
In Nehemia 7,4 fanden wir, dass Jerusalem innerhalb seiner Stadtmauern nur spärlich bewohnt war. Viele Häuser waren noch nicht wieder aufgebaut. Zudem war die Stadt mit dem Tempel Gottes ständigen Angriffen der Feinde ausgesetzt, d.h. es war nicht ungefährlich, dort zu wohnen. Aus diesen und vielleicht noch weiteren Gründen war Jerusalem äusserlich kein attraktiver Wohnort. Und doch: Wer innerhalb der Stadtmauer Jerusalems wohnte, lebte dort, wo Gott seinen Namen wohnen liess. War das nicht ein grosses Vorrecht?
Damit nebst den Obersten auch ein Teil des Volkes nach Jerusalem zog, um dort zu wohnen, wurden Lose geworfen. Jeder Zehnte sollte dahin umziehen. Wer dies freiwillig tat, wurde vom Volk gesegnet, denn jeder wusste, dass dieser Entschluss mit Verzicht auf äussere Annehmlichkeiten verbunden war.
Nicht nur die Menschen, auch Gott sah die Selbstverleugnung und den Mut derer, die bereit waren, ihren Wohnsitz nach Jerusalem zu verlegen. Ab Vers 3 hält Er ihre Namen und Anzahl in seinem ewigen Wort fest. Es waren eine Anzahl aus Juda und Benjamin, eine beachtliche Anzahl Priester, aber auch Leviten und Torhüter.
Gott übersieht kein Opfer und keine Verzichtsleistung, die im Blick auf seine Interessen gebracht werden. Er vergisst keinen Dienst, den wir zur Förderung seines Werkes tun. Alles wird vor Ihm aufgeschrieben. Es kommt der Augenblick, da der Herr jede Treue für Ihn und seine Sache, die Er in unserem Leben gefunden hat, belohnen wird.
Priester und Leviten
In der Liste derer, die in Jerusalem wohnten, werden nicht nur Namen aufgeführt, sondern auch verschiedene Einzelheiten und nähere Angaben über die Stellung und den Dienst dieser Personen erwähnt. Gottes «Buchhaltung» ist äusserst genau!
Die Männer von Juda zeichneten sich durch Tapferkeit aus (Vers 6). Vielleicht erwiesen sie sich damals, als die Mauer unter den Angriffen der Feinde gebaut und fertiggestellt wurde, als besonders mutig. – Die Priester hatten die Oberaufsicht des Tempels. Sie verrichteten die Arbeit im Haus (Vers 12), während die Leviten über die äussere Arbeit des Tempels gesetzt waren (Vers 16). Eine Priesterfamilie war besonders tüchtig (Vers 13).
Der Levit Mattanja hatte eine sehr schöne Aufgabe: Er stimmte beim Gebet den Lobgesang an (Vers 17). Diesen Levitendienst gab es während der Wüstenwanderung noch nicht. Er wurde erst unter König David eingeführt (1. Chronika 16,4-7; vergleiche auch Nehemia 12,24). Wir, die Gläubigen der Gnadenzeit, dürfen den Vater in Geist und Wahrheit anbeten (Johannes 4,24), ja, wir werden aufgefordert, zueinander zu reden «in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen, danksagend allezeit für alles» (Epheser 5,19.20).
Wie wichtig waren schliesslich die Torhüter! Tore ohne Wachen nützen nichts.
So füllte ein jeder, der nach Jerusalem kam, trotz des traurigen Zustands der Stadt, seinen Platz aus. Welch eine Ermunterung für uns, die in den Tagen des Verfalls des christlichen Zeugnisses leben!
Das übrige Volk
Das übrige Israel wohnte in den Stämmen Judas, «jeder in seinem Erbteil». Gott hat alle ihre Wohnorte genau verzeichnet. Diese Leute gehörten genauso zum Volk Gottes wie die, die innerhalb der Stadtmauer von Jerusalem wohnten. Die Mauer war ja nicht aufgerichtet worden, um einen Teil des Volkes Gottes abzugrenzen oder auszuschliessen. Die Mauern und Tore waren nötig, um die Heiligkeit des Hauses Gottes aufrechtzuerhalten – eine Wahrheit, die heute noch aktuell und wichtig ist.
Wie in den Tagen Nehemias so sind es auch heute nur noch wenige, die bereit sind, die Grundsätze des Hauses Gottes, das die Versammlung ist, praktisch zu verwirklichen. Aus diesem Buch des Alten Testaments sehen wir, dass es ohne Absonderung unmöglich ist, die Heiligkeit, die dem Haus Gottes geziemt, auch aufrechtzuerhalten. Doch wir sollten die ernste Gefahr erkennen, die darin besteht, die unbestrittene Wahrheit der Absonderung zu missbrauchen, um eine auserlesene Gruppe zu bilden, die viele Angehörige des Volkes Gottes ausschliesst, die Rechte des Herrn verleugnet und schliesslich die eigentliche Wahrheit vom Haus Gottes verliert, die durch eine wahre Absonderung vom Bösen bewahrt würde. Bei richtiger Anwendung halten die Mauern die Heiligkeit des Hauses Gottes aufrecht und sichern so seinem ganzen Volk die Vorrechte dieses Hauses. Bei Missbrauch werden sie einfach zum Abzeichen einer Partei und zur Sicherung einer Sekte.
Das Verzeichnis der Priester und Leviten
Unter König David wurden die Priester in 24 Abteilungen aufgeteilt, die nacheinander den Dienst im Haus Gottes versahen. Nach der babylonischen Gefangenschaft werden in Esra 2,36-39 nur vier Familien erwähnt und in Nehemia 12 ist von 22 Häuptern der Priester die Rede. Es war alles nicht mehr so wie zur Blütezeit Israels. Doch dank Gottes Gnade gab es noch einige Priester und damit auch noch einen Priesterdienst im wiedererbauten Tempel. Das ermuntert uns heute, den gottgemässen, neutestamentlichen Gottesdienst in aller Schwachheit aufrechtzuerhalten (Johannes 4,23.24; 1. Petrus 2,5; Hebräer 13,15).
Nachdem Israel aufgehört hatte, ein selbstständiges Volk zu sein, gab es auch keinen König mehr. Die chronologische Geschichte des Volkes konnte nun nicht mehr anhand der nacheinander regierenden Könige festgehalten werden wie in den Büchern Könige und Chronika. Jetzt diente als Grundlage das Geschlechtsregister der Priester.
In Vers 26 wird eine Zeitangabe für dieses Register gemacht. Die aufgenommenen Personen lebten in den Tagen des Hohenpriesters Jojakim, des Priesters Esra und des Statthalters Nehemia. In den Versen 10 und 11 werden jedoch Hohepriester erwähnt, die unter Nehemia noch gar nicht lebten. Ob die Namen Jojada, Jonathan und Jaddua nach der Abfassung des Briefes eingesetzt wurden, oder ob Gott diese Namen vor ihrer Geburt bereits bekanntgegeben hat, wissen wir nicht. Wir sehen daraus einfach, dass das Priestertum bis in die Zeit des Neuen Testaments weiterging (Lukas 1,5).
Die Einweihung der Mauer (1)
Das Ende von Kapitel 6 berichtete von der Fertigstellung der Mauer, und zu Beginn von Kapitel 7 wurden die Torflügel eingesetzt. Nun konnten Mauern und Tore ihre Funktion übernehmen. Warum wird erst jetzt von der Einweihung der Mauer gesprochen?
Beim Lesen von allem, was sich in den Kapiteln 8 – 11 ereignete, bekommt man den Eindruck, dass eine Zubereitung des Volkes nötig war. Es musste im Leben der Menschen einiges geordnet werden, bis eine ungetrübte Freude vor Gott möglich wurde. Aber nachdem sich Selbstgericht, das Bekennen der Sünden und ein neuer Eifer für Gott und seine Sache eingestellt hatten, war der Weg für die Einweihung der Mauer unter Lob und Dank offen.
Wie wichtig ist Vers 30 auch für uns: Keine Weihe, keine Hingabe an Gott ohne Reinigung, d.h. ohne Trennung von allem Bösen, von allem, was Gott entgegensteht, was nicht in seine Gegenwart passt.
Wieder werden manche Namen erwähnt. Es handelt sich dabei nicht um ein Geschlechtsregister, sondern um den Platz, den jeder bei diesem Dankfest, bei dem Gottes Güte und Barmherzigkeit gerühmt wurden, einnahm. Zwei Dankchöre zogen in entgegengesetzter Richtung über die fertig gestellte Mauer, der eine Zug stand wohl unter der Führung Esras, des Schriftgelehrten, der andere unter der Leitung des Statthalters Nehemia.
Die Einweihung der Mauer (2)
Schliesslich trafen sich die beiden Dankchöre im Haus Gottes, um dort miteinander das Lob erschallen zu lassen. War die Mauer nicht zum Schutz des Heiligtums und des Altars gebaut worden? So war es angezeigt, dass dort das grosse Freudenfest gefeiert wurde. Die dargebrachten Opfer zeugten vom besonderen Dank gegenüber Gott, der zu diesem grossen Werk Gelingen geschenkt hatte und jetzt die Herzen aller mit Freude füllte.
An jenem Freudentag wurde noch etwas bewirkt: die materielle Unterstützung der Priester und all derer, die im Dienst des Tempels beschäftigt waren (Leviten, Sänger, Torhüter). Sie geschah durch die Hebopfer, die Gaben der Erstlinge und den Zehnten der Erträge der Felder.
So finden wir bei der Einweihung der Mauer eigentlich drei Stufen:
Zuerst steigen Lob und Dank zu Gott auf.
Zweitens herrscht eine grosse Freude unter dem Volk, und drittens werden die Diener des Herrn unterstützt.
Und wenn heute unter uns – sei es nun gemeinsam oder persönlich – wahre Hingabe an den Herrn (Weihe) gefunden wird, dann wird es ganz ähnlich sein: Gott wird seinen Teil an Preis, Lob und Dank empfangen. Wir werden Freude im Herzen haben, und es wird an nichts fehlen, um das Werk des Herrn und seine Diener zu unterstützen.
Unheilige Verbindungen
«An jenem Tag» bedeutet nicht: am Tag der Einweihung der Stadtmauer. Es ist vielmehr der Tag gemeint, da man beim Vorlesen des Gesetzes an die Stelle in 5. Mose 23 kam, wo die Anordnungen bezüglich Ammon und Moab stehen. Es muss einige Zeit nach der Einweihung der Mauer gewesen sein, denn Nehemia war in der Zwischenzeit nach Babel zurückgekehrt.
Das vorgelesene Gesetz verfehlte seine Wirkung in den Herzen und Gewissen der Juden nicht. Sie befolgten es und sonderten alles Mischvolk von Israel ab. Unter Mischvolk muss man solche verstehen, die es mit dem Volk und mit den Feinden hielten. Die Juden verstanden, dass eine klare Trennung nötig war.
Auch heute gibt es in der Christenheit solche – oft wahre Gläubige –, die einerseits mit den entschiedenen Kindern Gottes gehen wollen und anderseits Beziehungen zur Welt, vor allem zur christlichen Welt unterhalten. Wenn wir dem Herrn treu sein wollen, müssen wir uns von solchen trennen, die verkehrte Verbindungen festhalten.
Durch die Verbindung, die der Hohepriester Eljaschib mit Tobija, dem ammonitischen Knecht, unterhielt, wurde sogar das Haus Gottes verunreinigt. Als Nehemia zurückkehrte, entdeckte er das Böse, das Eljaschib getan hatte. Er, der weder Priester noch Levit war, musste diesem einflussreichen Mann entgegentreten.
Wie ernst, wenn ein Führer unter den Gläubigen sündigt! Derartiges Böses muss ohne Ansehen der Person verurteilt werden.
Die Zehnte und der Sabbat
Bei seiner Rückkehr von Babel musste Nehemia noch andere Mängel feststellen. Obwohl sich das Volk in Kapitel 10 durch einen Bund verpflichtet hatte, den Unterhalt des Hauses Gottes und seiner Diener nicht zu vernachlässigen, wurden nach einiger Zeit die Leviten nicht mehr unterstützt. Um nicht zu verhungern, mussten sie ihre Felder bewirtschaften, anstatt den Dienst im Tempel zu verrichten. So unzuverlässig sind wir Menschen! Wir versprechen etwas und können es doch nicht einhalten. – Glücklicherweise konnte diese Sache auf gottgemässe Weise geregelt werden. Treue Diener verwalteten den vom Volk aufs Neue gebrachten Zehnten.
Ein weiteres Problem war die Entheiligung des Sabbats. Gott hat seinem irdischen Volk das Sabbatgebot gegeben, um seinen Gehorsam zu prüfen. Doch bei vielen Juden kam das Geschäft und das Geldverdienen vor der Heiligung des Sabbats. Nehemia musste sie daran erinnern, dass die Entheiligung des Sabbats einer der Gründe war, warum Gott Unglück und Not über Juda und Jerusalem hatte bringen müssen.
Die Entschiedenheit, mit der Nehemia für die Rechte Gottes einstand, ist bemerkenswert. Kompromisslos hielt er am Sabbat fest, bis die Händler und Verkäufer, die von auswärts nach Jerusalem kamen, es auch begriffen.
Die Gebete Nehemias, die Gott in seinem Wort festgehalten hat, zeigen, dass seine entschiedene Haltung manche Herzensübung mit sich brachte.
Vermischung mit den Nationen
Das dritte grosse Problem, mit dem Nehemia bei seiner Rückkehr aus Babel konfrontiert wurde, war die Verbindung der Juden mit heidnischen Frauen. Manche von ihnen hatten asdoditische, ammonitische und moabitische Frauen geheiratet. Dieser Punkt war besonders betrüblich, denn in Esra 10 hatten sie sich doch wegen der gleichen Sünde gedemütigt und gereinigt. Wie schnell waren sie wieder in die gleiche Sünde hineingekommen! Ja, unser natürliches Herz ist unverbesserlich (Jeremia 17,9.10).
Leider ging die priesterliche Familie in dieser Sache den anderen voran. Am Anfang des Kapitels lasen wir vom Hohenpriester Eljaschib, der ein Verwandter des Tobija war, und Vers 28 berichtet von einem seiner Enkel, der ein Schwiegersohn Sanballats, eines anderen Feindes der Juden, war.
Durch die Treue Nehemias wurde manches vor Gott wieder in Ordnung gebracht. Aber für wie lange? Das letzte Buch des Alten Testaments – der Prophet Maleachi – zeigt, wie nach dem Abscheiden Nehemias das Böse wieder die Oberhand gewann. Den Gottesfürchtigen blieb nur noch die Hoffnung auf das Kommen des Messias. Und unsere Hoffnung ist die Erwartung unseres Erlösers zur Entrückung. «Und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein» (1. Thessalonicher 4,17).
Das Buch Nehemia schliesst mit einem Gebet dieses treuen, gottesfürchtigen Mannes. Am Tag der Herrlichkeit von Jesus Christus wird Gott auch an Nehemia denken und ihn für seinen Eifer und seinen treuen Dienst belohnen.
Einleitung
Esra 1 – 6: Der Tempelbau.
Der persische König Kores erlässt eine Verordnung, die den Juden die Rückkehr in ihre Heimat möglich macht. Da reisen mehr als 40 000 Menschen von Babel nach Jerusalem. Dort bauen sie den zerstörten Tempel wieder auf. Als sich Widerstand erhebt, hören sie mit der Arbeit auf. Doch der Herr fordert sie durch die Propheten Haggai und Sacharja auf, den Bau fortzusetzen. Schliesslich wird der Tempel fertiggestellt und der Gottesdienst wieder eingesetzt. Mit grosser Freude feiern die Juden das Passah und das Fest der ungesäuerten Brote.
Esra 7 – 10: Das Wort Gottes.
50 bis 60 Jahre nach der ersten Rückkehr hat es der Priester und Schriftgelehrte Esra am Herzen, nach Jerusalem zu reisen. Es begleiten ihn etwa 1500 Juden. Als Esra am Ziel ankommt, erfährt er vom traurigen Versagen des Volkes. In tiefer Demütigung und anhand des Wortes Gottes wird die Sache in Ordnung gebracht.
Der Erlass von König Kores.
Infolge der Untreue des Volkes der Juden gegenüber seinem Gott musste es für Jahrzehnte in die babylonische Gefangenschaft. Nachdem Nebukadnezar, der König von Babel, einen Grossteil der Bewohner Jerusalems nach Babel weggeführt hatte, schrieb der Prophet Jeremia den im Exil Lebenden einen Brief. Darin ermunterte er sie, sich in Babel niederzulassen und den Frieden der Städte zu suchen, wohin sie gebracht worden waren. Doch er schrieb ihnen auch, dass sie nicht für immer in Babel bleiben müssten. Nach 70 Jahren würde Gott sich ihrer wieder annehmen (Jeremia 29,4-7.10-14). Unter dem persischen König Kores ging diese Prophezeiung in Erfüllung. Gott selbst erweckte den Geist dieses Mannes und veranlasste ihn, dieses Edikt zu erlassen. Interessanterweise begegnet uns der Name Kores bereits im Propheten Jesaja (Jesaja 44,8; 45,1). 150 Jahre vor seiner Geburt kündigte Gott, der Allmächtige und Allwissende, bereits an, dass Er diesen König als sein Werkzeug benutzen wollte.
Nun wurden alle aus dem irdischen Volk Gottes aufgerufen, nach Jerusalem zurückzukehren und dort den Tempel wieder aufzubauen. In seinem Erlass dachte Kores auch an die nötige materielle Unterstützung.
Seitdem Israel aufgehört hatte, ein selbstständiges Volk zu sein, hatten die Zeiten der Nationen begonnen (Lukas 21,24). In dieser Zeit überlässt Gott die Regierung der Völker den Händen der Menschen und greift nicht mehr direkt in das ein, was auf der Erde geschieht. Daher finden wir in den Büchern Esra, Nehemia und Daniel den Ausdruck «Gott des Himmels».
Die Rückkehr unter Serubbabel
Die Führer unter den Juden im Exil reagierten sofort auf den Erlass. Sie machten sich mit den Priestern und Leviten auf den Weg nach Jerusalem. Mit ihnen zog «jeder, dessen Geist Gott erweckte». Serubbabel oder Sesbazar, wie sein chaldäischer Name hiess, übernahm die Führung. Er stammte aus der königlichen Familie Davids (1. Chronika 3,19; Matthäus 1,12).
Wie gross muss die Freude derer gewesen sein, die sich nach Zion gesehnt hatten, als sie den Ruf des Königs vernahmen! Sie gehörten zu denen, die an den Flüssen Babels trauerten und Jerusalem nicht vergessen konnten (Psalm 137,1-5). Nun war Gott für sie ins Mittel getreten und hatte ihren Weg nach Jerusalem geöffnet. Welch eine Gnade! Doch längst nicht alle waren bereit, zurückzukehren. Es scheint, dass die Mehrheit der Juden es vorzog, in Babel zu bleiben. Für viele gab es in Jerusalem nichts Anziehendes. Die Stadt und der Tempel lagen ja in Trümmern. Doch für die, die zurückkehren wollten, blieb Jerusalem der Ort, den Gott erwählt hatte, um seinen Namen dahin zu setzen und die Opfer seines Volkes entgegenzunehmen.
König Kores gab den Zurückkehrenden alle vorhandenen Tempelgeräte mit, die Nebukadnezar einst aus Jerusalem nach Babel gebracht hatte. Auch diese Geste des Königs zeigt, dass Gott sein Volk nicht vergessen hatte. – Die Zeit wird kommen, da Er auch das heute noch in alle Welt zerstreute Volk Israel sammeln und in sein Land zurückführen wird. Dann wird ein Grösserer als Serubbabel erscheinen: Jesus Christus, der Sohn Davids, ihr Erlöser und Befreier.
Die Namen der Rückkehrer (1)
In Vers 2 werden elf Männer namentlich aufgeführt (in Nehemia 6,7 sind es zwölf), die die Führung der Rückkehrer übernahmen. Serubbabel war von königlicher Abstammung und Jeschua war der Hohepriester. Die beiden werden im Propheten Sacharja erwähnt und beide sind prophetische Hinweise auf Christus, den kommenden Priester-König (Sacharja 4 und 6).
Es wurde eine genaue Liste all derer aufgenommen, die dem Ruf des persischen Königs Folge leisteten und nach Jerusalem zogen, um den Tempel wieder aufzubauen. Wir denken an Maleachi 3,16, wo es heisst, dass ein Gedenkbuch vor Gott geschrieben wurde «für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten». Gott hat jeden Einzelnen gesehen, der bereit war, eine beschwerliche Reise und viel Mühe auf sich zu nehmen, um das Haus Gottes in Jerusalem wieder zu bauen. «Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient» (Hebräer 6,10).
Es fällt auf, dass nur 74 Leviten mit Serubbabel zogen. Wie konnte da der Tempeldienst funktionieren? Die Sänger (auch Leviten) waren zahlreicher als die eigentlichen Tempeldiener. Hingegen war die Zahl der Priester beachtlich – über 4000! – Auch bei der später stattfindenen Rückkehr unter Esra waren die Leviten rar (Esra 8,15). Die Leviten sind ein Bild der Arbeiter im Werk des Herrn, und wir denken an die Worte des Herrn Jesus: «Die Ernte zwar ist gross, die Arbeiter aber sind wenige» (Matthäus 9,37). Wie steht es heute?
Die Namen der Rückkehrer (2)
Die Nethinim werden nur in den Büchern Esra und Nehemia und in 1. Chronika 9,2 erwähnt. Die Bedeutung des Wortes ist «Geschenkte» oder «Geweihte». Es scheint, dass sie durch David den Leviten als Tempeldiener gegeben worden waren (Esra 8,20). Die Söhne der Knechte Salomos scheinen ähnliche Aufgaben wie die Nethinim gehabt zu haben, denn sie werden mit ihnen zusammen angegeben: total 392.
Nun gab es unter den aus dem Exil Zurückkehrenden einige Hundert Menschen – auch solche aus der priesterlichen Familie –, die nicht nachweisen konnten, dass sie zum Volk Israel gehörten. Sie suchten ihr Geschlechtsregister-Verzeichnis, doch es wurde nicht gefunden.
Der Tirsatha (der Statthalter Serubbabel) entschied, dass sie als unrein ausgeschlossen blieben, bis ein Priester für die Urim und Tummim aufstehen würde. Die Urim und Tummim waren nicht näher bezeichnete Gegenstände im Brustschild des Hohenpriesters (2. Mose 28,30). Durch sie konnte man Gottes Willen erfahren (4. Mose 27,21; 1. Samuel 28,6; 30,7.8).
Dieses Problem findet in der heutigen Zeit seine Parallele. Gibt es in der Christenheit nicht manche, die wohl ein Bekenntnis haben; aber haben sie Frieden mit Gott? Besitzen sie den Heiligen Geist, der ihnen bezeugt, dass sie Kinder Gottes sind und wirklich zur Familie Gottes gehören? Das sind Fragen, die oft nicht leicht zu klären sind, besonders wenn unbekannte Personen den Wunsch haben, am Tisch des Herrn teilzunehmen und Gemeinschaft mit den Gläubigen auszudrücken. Bei Unklarheiten muss man auf den Herrn warten.
Die Ankunft in Jerusalem
Der ganze Zug derer, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückkehrten, bestand aus knapp 50 000 Personen. Die meisten mussten wohl den langen Weg zu Fuss zurücklegen. Sie hatten nur eine verhältnismässig geringe Anzahl Pferde, Maultiere und Kamele. Die Esel wurden wohl als Lasttiere benutzt, die ihre Habe transportierten.
Die Rückkehr der Juden aus Babel und der Wiederaufbau des Tempels ist das Bild einer geistlichen Erweckung. Gott hat in seiner Gnade in den vergangenen 300 Jahren da und dort in der Christenheit Erweckungen geschenkt. Denken wir an den Pietismus oder die Erweckungen im 19. Jahrhundert. Das waren keine weltbewegenden Ereignisse. Vieles spielte sich in der Stille, in aller Einfachheit, aber voller Herzensüberzeugung und im Gehorsam zum Wort Gottes ab.
Interessant ist die Bemerkung bei ihrer Ankunft in Jerusalem. Es heisst nicht: «Als sie zur Tempelruine oder zum Platz kamen, wo der Tempel einst gestanden hatte.» Gottes Wort sagt: «Als sie zum Haus des Herrn in Jerusalem kamen.» Das war der Hauptgrund ihrer Rückkehr. In ihrem Herzen bestand dieses Haus, das sie wieder aufbauen wollten, bereits. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich durch die Herzen auch die Hände öffneten. Von diesen sicher nicht wohlhabenden Leuten kam doch einiges an Gold, Silber und Priesterkleidern zusammen. Finden wir hier nicht etwas vom Geist der Freigebigkeit der Mazedonier, die in übermässiger Freude nach Vermögen und über Vermögen freigebig waren (2. Korinther 8,1.2)?
Die Aufrichtung des Altars
Der siebte Monat war ein wichtiger Monat für die Israeliten. Drei Feste hatte Gott in jenem Monat verordnet: Das Gedächtnis des Posaunenhalls, der Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Das erste dieser drei Feste spricht von der Sammlung des Volkes in der Zukunft (vor der Aufrichtung des Tausendjährigen Reiches). Was damals geschah, war ein Schatten davon.
Geschlossen kam das Volk nach Jerusalem, wo sie zunächst den Altar Gottes wieder aufbauten. Der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes war für sie das Wichtigste. So handelten sie, wie es das Gesetz vorschrieb. Doch es gab noch einen zweiten Grund: die Furcht vor den Völkern des Landes. Durch das Opfern der Brandopfer auf dem wiedererbauten Altar brachten sie Gott ihre Anbetung dar. Für sie kamen Gottes Ansprüche an erster Stelle. Das beständige Brandopfer war die Grundlage für ihre Beziehung mit Gott. Aber gleichzeitig stützten sie sich im Vertrauen auf Ihn, den sie anbeteten, und vertrauten, dass Er sie vor den Feinden bewahren würde. – Das Brandopfer spricht vom Opfer des Herrn Jesus für Gott, aufgrund dessen Er uns annehmen und den Zugang zu seinem Herzen und zum Thron der Gnade öffnen konnte. Nun dürfen wir Ihn als Vater anbeten, aber auch mit unseren Bitten zu Ihm kommen.
Zur Zeit des Laubhüttenfestes war der Grund des Tempels noch nicht gelegt, aber die Vorbereitungen waren bereits getroffen. Die «Bestellungen» für Zedernholz von den Tyrern und Sidoniern waren schon aufgegeben. Dabei konnten sie sich auf die Vollmacht des persischen Königs stützen.
Der Beginn des Tempelbaus
Im zweiten Jahr ihres Kommens nach Jerusalem begannen sie mit dem Werk am Haus des Herrn. Wieder heisst es, dass sie wie ein Mann die Arbeit überwachten und leiteten. Die Führer des Volkes – der Statthalter Serubbabel und der Hohepriester Jeschua – gingen bei der Arbeit mit dem guten Beispiel voran. Dann bestellten sie die Leviten von 20 Jahren und darüber, um alles zu leiten. Sie waren echte Mitarbeiter – ein Ausdruck, dem wir im Neuen Testament öfter begegnen. Das dürfen auch wir sein. In 1. Korinther 3,9 sagt Paulus sogar: «Wir sind Gottes Mitarbeiter.»
Als der Grund zum Tempel gelegt wurde, stimmten alle in einen Lobgesang ein. Gemeinsam priesen sie die Güte des Herrn, der ihnen die Rückkehr nach Jerusalem ermöglicht und ihnen jetzt Gelingen zum Beginn des Tempelbaus geschenkt hatte. – Die Freude war in jener Zeit am Platz und berechtigt. Und die Tränen derer, die sich an das frühere Haus Gottes erinnerten? Diese Tränen bekannten die Wahrheit. Die Weinenden waren sich bewusst, was Gott einst seinem Volk gewesen war und welchen Verlust sie wegen ihrer Untreue erlitten hatten. Auch diese Tränen waren Gott wohlgefällig. Man konnte den Schall des freudigen Jubels nicht von der Stimme des Weinens im Volk unterscheiden. Beides entsprach den Tatsachen: freudig und traurig, jedoch geziemend vor dem Angesicht Gottes. Er freute sich in der Freude seines Volkes, denn Er hatte sie geschenkt, und Er verstand ihre Tränen und übersah die Beugung der Herzen nicht. Auch die heidnische Umgebung bekam etwas mit von der Freude des Volkes Gottes.
Die Feinde wollen mitbauen
Gott kannte von Anfang an die wahre Gesinnung der damaligen Bewohner des Landes Israel. Jene Leute waren einst durch den König von Assyrien ins Land gebracht worden, nachdem die Bewohner des Zehnstämme-Reichs Israel nach Assyrien verschleppt worden waren. 2. Könige 17,24-41 berichtet darüber. Jene Menschen betrieben einen Gottesdienst mit gemischten Grundsätzen: «Sie fürchteten den Herrn, und sie dienten ihren Göttern» (2. Könige 17,33.41). Der Geist Gottes nennt diese Leute «Feinde Judas und Benjamins», bevor die zurückgekehrten Juden dies wirklich realisierten.
Es war eine List Satans, die sich hinter den Worten jener Bewohner verbarg. Hätten Serubbabel und Jeschua einer solchen Zusammenarbeit zugestimmt, wäre es zum Verderben des Werkes gewesen. Die entschiedene Haltung gegenüber solchen, die nicht beweisen konnten, dass sie zum Volk Gottes gehörten (Esra 2,62.63), zeigte sich auch hier. Die Führer lehnten die Mithilfe von Menschen ab, die noch den Götzen dienten. Für uns gelten in dieser Hinsicht die Worte des Apostels Paulus in 2. Korinther 6,14-18.
Die klare Antwort führte dazu, dass diese Menschen ihre Maske fallen liessen. Nun kam ihr wahrer Charakter ans Licht. Sie waren Feinde der Juden und versuchten mit allen Mitteln, das Werk Gottes zu behindern. Sie wollten auf keinen Fall zulassen, dass der Tempel Gottes wieder aufgebaut wurde. Gott liess es zu, dass eine Anklageschrift gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem geschrieben und an den damals herrschenden König Artasasta gesandt wurde.
Die Feinde verleumden die Bauenden
Obwohl die Bewohner der Städte Samarias unterschiedlicher Herkunft waren (Vers 9), vereinten sie sich, um gegen die Juden aufzutreten. Der Brief enthält Lügen und Wahres. Wichtiges wurde einfach nicht erwähnt. Auf diese Weise entstand ein trügerisches Bild, das den König negativ beeinflussen musste.
Vers 12 war eine Lüge. Von einem Wiederaufbau der Stadt und ihrer Mauern war damals unter den Juden keine Rede. Das Volk war mit dem Auftrag Kores’, den Tempel Gottes wieder aufzubauen, nach Jerusalem gekommen. Doch dies wurde im Brief mit keinem Wort erwähnt.
Dass Jerusalem einst eine aufrührerische Stadt gewesen war, entsprach der Wahrheit. Die Feinde benutzten die Sünden der Vergangenheit, um dem Volk der Juden erneut zu schaden. Doch Gott, der sein untreues Volk in die Gefangenschaft führen musste, war ihm jetzt in Gnade begegnet und hatte die Gefangenschaft beendet.
Die Art und Weise wie die Feinde der Juden vorgingen, zeigt, wer hinter ihnen stand und sie anleitete: Satan. Er wird in Johannes 8,44 ein Lügner genannt und als Vater der Lüge bezeichnet. In Offenbarung 12,10 wird er als «Verkläger unserer Brüder» bezeichnet. Er arbeitet immer nach den gleichen Grundsätzen. Er versucht den Gläubigen zu schaden, wo er eine Gelegenheit dazu findet. Dabei vermischt er Lüge mit Wahrheit und nimmt alte, vergebene Sünden der Gläubigen wieder hervor, um gegen sie zu wirken.
Der Bau wird unterbrochen
Der König Artasasta erhielt den Brief von den Bewohnern der Städte Samarias. Die Nachforschungen über die frühere Geschichte Jerusalems bestätigten die Worte des Briefes. Das genügte dem persischen König, um den klaren Befehl zu geben, den Wiederaufbau Jerusalems sofort und bis auf Weiteres einzustellen. Die Briefschreiber wurden mit Nachdruck aufgefordert, diesen Befehl auszuführen. Dass die Juden gar nicht die Stadt, sondern den Tempel wieder aufbauten – diese Lüge wurde nicht entdeckt. Der Feind hatte fürs Erste Erfolg. Doch ein treuer Gott wachte über allem.
Die Feinde der Juden benutzten den Brief des Königs, um den Bauenden mit Gewalt und Macht zu wehren, den Tempelbau fortzusetzen. Dann heisst es in Vers 24: «Damals hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf.» Die Juden beugten sich dem Druck der Feinde, obwohl sie sich ebenso wie ihre Feinde auf ein Schriftstück des persischen Königs hätten berufen können – auf das Edikt von Kores (Esra 1,1).
Der Prophet Haggai lässt uns hinter die Kulissen blicken. Wir finden dort, dass beim Volk der Eifer für die Sache Gottes nachgelassen hatte. Sie setzten ihre Energie mehr für ihre eigenen Interessen ein. Es scheint, dass ihnen dieser massive Widerstand von aussen gerade recht kam, um mit dem Bau am Haus Gottes aufzuhören. Ihr Herz schlug doch nicht mehr für das Werk des Herrn.
Glücklicherweise unterblieb die Arbeit am Haus Gottes nicht für immer, sondern nur bis zur Regierung von Darius (vergleiche Haggai 1).
Der Tempelbau wird fortgesetzt
In den Tagen des Niedergangs im Volk Gottes sandte Gott jeweils seine Propheten zu den Menschen. So war es auch zur Zeit Serubbabels. Gott gebrauchte die Stimme der Propheten Haggai und Sacharja, um die Herzen und Gewissen der Juden in Juda und Jerusalem aufzurütteln.
Vers 2 deckt sich mit dem, was wir in Haggai 1,12 finden: Die Führer und das ganze Volk hörten auf die Worte des Propheten, «und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn». Diese Regung des Herzens beantwortete Gott mit der Ermunterung: «Ich bin mit euch» (Haggai 1,13). Daraufhin fingen alle wieder an, «das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen». Die neu entfachte Gottesfurcht vertrieb auch die Furcht vor den Menschen. Zudem durften die Bauenden die Unterstützung der Propheten Gottes erfahren.
Solange die Juden an ihren Häusern bauten und diese zu verschönern suchten, sagte niemand etwas. Sobald aber der Bau des Hauses Gottes fortgesetzt wurde, erschienen die Feinde aufs Neue auf dem Plan.
Jetzt liessen sich die Bauenden nicht mehr einschüchtern. Und Gott bekannte sich zu ihnen, wie Er ihnen verheissen hatte. In seiner Vorsehung wirkte Er in den Herzen der Feinde der Juden, dass die Bauwilligen weiter arbeiten konnten, bis eine Antwort vom persischen König kam. Niemand sah das Auge Gottes über den Ältesten der Juden. Doch die Auswirkungen zeigten sich. Er gab ihnen Kraft, Mut und Festigkeit.
Die Feinde schreiben an König Darius
Gott fand es für gut, auch den Wortlaut des Briefes an König Darius in seinem ewigen Wort festzuhalten. Sicher stand Er hinter der Abfassung dieses Textes. Er sorgte dafür, dass die Wahrheit gesagt wurde. Vers 8 beschreibt den damaligen Tatbestand.
Der Brief lässt aber auch die veränderte Einstellung der Juden erkennen. Im Gehorsam zum Wort Gottes durch die Propheten und mit Glaubensenergie hatten sie sich wieder an die Arbeit gemacht. Dabei waren sie innerlich völlig ruhig. Bereitwillig nannten sie die Namen ihrer Anführer. Doch dann legten sie auch ein kühnes Bekenntnis ab. Dabei verschwiegen sie das Versagen ihrer Vorfahren nicht. Sie beriefen sich zuerst auf Gott: «Wir sind die Knechte des Gottes des Himmels und der Erde», und erst dann auf König Kores und seinen Befehl. Und bei allem waren sie nicht beunruhigt über diesen Brief. Der Herr selbst hatte sie ja mit den Worten ermutigt: «Seid stark, alles Volk des Landes … und arbeitet!» (Haggai 2,4).
Für uns können wir aus diesem Brief und den Begleitumständen lernen, dass ein kühnes Bekenntnis eine wirksame Waffe gegen Satan ist. Wir erinnern uns an ein Wort des Propheten Oded an König Asa: «Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen» (2. Chronika 15,2).
Die Antwort von König Darius
Aufgrund des Briefes von Tatnai liess König Darius nachforschen. Gottes Vorsehung hatte dafür gesorgt, dass die Urkunde mit dem Erlass von König Kores aufbewahrt blieb. Und nun sorgte Er dafür, dass sie auch gefunden wurde. In dieser Urkunde standen Einzelheiten über die Grösse und Bauart des Hauses Gottes, die in Esra 1 nicht erwähnt werden.
König Darius anerkannte diesen Erlass und befahl mit Nachdruck, jede Behinderung der Bauenden zu unterlassen. Er ging sogar noch weiter und ordnete an, dass den Juden die Baukosten aus den Steuergeldern bezahlt wurden und dass ihnen alles, was zu den Opfern nötig war (Tiere, Weizen, Salz, Wein, Öl), gegeben wurde.
Der Angriff des Feindes auf die Juden und den Wiederaufbau des Tempels kehrte sich ins Gegenteil um. Satan wollte behindern und zerstören. Gott lenkte es so, dass die Arbeit an seinem Haus gefördert und unterstützt wurde. Ähnliches ist seither immer wieder geschehen. Wenn Gott eingreift, gibt es nichts und niemand, der seinem Tun wehren könnte. Welch eine Ermunterung für alle, die sich für seine Interessen einsetzen!
Darius scheint eine gewisse Kenntnis vom Gott des Himmels gehabt zu haben, der sich Nebukadnezar, Belsazar und Darius, dem Meder, gegenüber offenbart hatte (Daniel 2 – 6). Das war noch nicht in Vergessenheit geraten. Darius wünschte sogar, dass während dem Opfern auch für ihn und seine Söhne gebetet wurde.
Den Gegnern der Juden blieb nichts anderes übrig, als die königlichen Befehle auszuführen.
Die Tempeleinweihung und das Passah
Die Ältesten hatten in der Zwischenzeit die Hände nicht in den Schoss gelegt, sondern weitergearbeitet. Mit Gottes Hilfe und der moralischen Unterstützung durch die Weissagung der Propheten gelang den Bauenden die Fertigstellung des Hauses Gottes. Zu seiner Einweihung gab es ein Freudenfest. Aber welch ein Unterschied zur Einweihung des salomonischen Tempels! Damals opferten sie 22 000 Rinder im Gegensatz zu den 100 Stieren jetzt (2. Chronika 7,5). Doch den eindrücklichsten Unterschied finden wir wohl in 2. Chronika 7,2: Damals erfüllte die Herrlichkeit des Herrn den Tempel. In Esra 6 lesen wir nichts Derartiges. Die Herrlichkeit Gottes, die von Israel gewichen war, wird erst wieder in den Tempel des Tausendjährigen Reiches zurückkehren (Hesekiel 43,1-6).
Kurz nach der Einweihung des Hauses Gottes feierten die «Kinder der Wegführung» das Passah. Wie schön ist die Verbindung! Nach der Vollendung des Hauses Gottes feierte das Volk das Gedächtnis seiner Erlösung aus Ägypten. Lobend und den Herrn preisend gedachten sie an die Grundlage, auf der sie standen und an die Tatsache, dass das Blut des geschlachteten Lammes die Basis all ihrer Segnungen und aller Taten der Gnade Gottes für sie war. Sie stützten sich auf das, was Gott aufgrund des Blutes des Passahlammes für sie war, und fanden darin einen unveränderlichen und unbeweglichen Felsen. Sie waren sich aber auch bewusst, was sich ihrem Gott gegenüber geziemte: Sie hatten sich wie ein Mann gereinigt. Und als Antwort Gottes erfüllte Er ihre Herzen mit Freude.
Esra, der Priester und Schriftgelehrte
Nach der Zeit unter Serubbabel und dem Wiederaufbau des Tempels vergingen Jahre, über die uns die Bibel nichts mitteilt. In unserem Kapitel ist nun von der Rückkehr einer weiteren Gruppe von Juden unter der Führung Esras die Rede. Dieser gottesfürchtige Mann stammte aus der priesterlichen Familie Aarons und war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz Moses.
Mit Esra zogen «einige» von den Kindern Israel nach Jerusalem hinauf. Die in Esra 8 angegebenen Zahlen zeigen, dass es etwa 1500 Personen waren, also ein wesentlich kleinerer Zug als unter Serubbabel. Aus Vers 9 erfährt man zudem, dass diese Reise von Babel nach Jerusalem vier Monate gedauert hat – eine lange und gefährliche Wanderung (Esra 8,31).
Zweimal ist in diesen Versen die Rede von der Hand des Herrn, die über Esra war. Gott gab Gelingen zu diesem Unternehmen, indem Er Esra zuerst Gunst gab vor dem heidnischen König von Persien und dann eine gute, sichere Reise schenkte.
Die Reihenfolge in Vers 10 gilt grundsätzlich für alle, die die Bibel studieren. Um die Gedanken Gottes aus seinem Wort kennenzulernen, ist ein Erforschen der Schriften notwendig, denn vieles liegt nicht an der Oberfläche. Als Zweites soll das, was man aus der Bibel gelernt hat, einen Einfluss auf das praktische Leben haben. Wir sollen Täter des Wortes Gottes werden. Erst wenn wir das Gelernte und Gefundene selbst ausleben, sind wir in der Lage, andere zu belehren.
Der Brief von König Artasasta (1)
Ab Vers 11 folgt erneut ein Brief eines persischen Königs in seinem Wortlaut. Der Inhalt dieser Schrift zeigt, dass jener grosse König – er bezeichnet sich als König der Könige – von Gott benutzt wurde, um sein Werk zu unterstützen. Kein heidnischer Mensch hätte von sich aus solche Worte äussern können.
Dieser Brief ist sozusagen ein zweiter Erlass, der noch einmal jedem Juden, der in Babel wohnte, die Möglichkeit gab, in sein Land und nach Jerusalem zurückzukehren. In diesem Dokument wird der Name Gottes, das Gesetz Gottes und das Haus Gottes wiederholt erwähnt.
Das Silber und das Gold, das der König und seine Räte dem Gott Israels freiwillig gaben, sind ein schwaches Bild von dem, was im Tausendjährigen Reich geschehen wird. Dann wird der Reichtum der Nationen nach Jerusalem, dem Zentrum der Herrschaft des Herrn Jesus, gebracht werden (Jesaja 60).
Zur königlichen Gabe kam noch weiteres Silber und Gold dazu, auch von Juden, die in Babel blieben. Der König hatte volles Vertrauen in Esra, diesen gottesfürchtigen Schriftgelehrten. Er sollte mit dem Geld Opfertiere, Speisopfer und Trankopfer kaufen und sie Gott opfern. Die Verwendung des Rests des Geldes überliess der Monarch diesem treuen Mann. Er sagte einfach: «Was dir und deinen Brüdern gut erscheint, … das mögt ihr nach dem Willen eures Gottes tun.» In Vers 20 erhielt Esra sogar noch einen Blankoscheck. Wie gross war die Gnade Gottes über diesem Mann!
Der Brief von König Artasasta (2)
Der zweite Teil des Briefes richtete sich an die verantwortlichen Beamten in Palästina. Alles, was Esra für das Haus Gottes forderte, sollte ihm gegeben werden. Zudem wurden alle Personen, die einen Dienst am Haus Gottes taten, von jeder Steuer befreit. «Denn warum sollte ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne kommen?» So mächtig dieser persische Herrscher auch war, er beugte sich unter den Gott des Himmels. Das war bestimmt zu seinem Segen und zum Segen seiner Untertanen.
Aus den Versen 25 und 26 kann man wohl schliessen, dass es unter den zurückgekehrten Juden und übrigen Bewohnern des Landes keine richtige Führung mehr gab. Vor allem wurde das Gesetz Gottes nicht mehr beachtet. Daher beauftragte der König den Priester Esra mit der Einsetzung von Richtern und Rechtspflegern. Das Gesetz Gottes, aber auch das Gesetz des Königs sollten wieder hochgehalten werden.
Esra war ganz überwältigt von der Gnade Gottes, die solches im Herzen dieses grossen Herrschers gewirkt hatte. Die Schlussverse sind ein herrlicher Lobpreis für Gott, mit dem Esra seinem Herzen Luft machen musste. Er nahm die erfahrene Güte vonseiten des Königs dankbar an, aber er wusste, dass die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war und dies alles bewirkte und ihn für diese grosse Aufgabe stärkte.
Einige Juden begleiten Esra
Die ersten 14 Verse geben uns eine Liste derer, die mit Esra aus Babel nach Jerusalem zogen. Angesichts des grosszügigen Erlasses des Königs von Persien und seiner Freigebigkeit für dieses Unternehmen nimmt sich die Zahl der Rückkehrer bescheiden aus. Die Mehrheit der Juden wollte in Babel bleiben.
Aber Gott nahm Kenntnis von den Gottesfürchtigen und Treuen seines Volkes. Er sah jeden Einzelnen von denen, die wünschten, nach Jerusalem an den Ort zurückzukehren, wo der Altar und das Haus Gottes standen. Diese Treuen bedeuteten Ihm so viel, dass Er sie in seinem ewigen Wort festgehalten hat.
Obwohl Esra und die mit ihm zogen, die Unterstützung des Königs genossen, war es doch ein Glaubensschritt, den diese Juden taten. Sie gaben ihren äusserlich sicheren Platz in Babel auf und zogen nach Juda und Jerusalem zurück, ohne eine handfeste Perspektive für ihr Leben zu haben. Doch sie machten die Interessen Gottes zu ihren Interessen. Und Gott hat noch keinen enttäuscht, der sich im Vertrauen auf Ihn gestützt hat.
Nachdem sich alle Rückkehrer zusammengefunden hatten, stellte Esra fest, dass sich keine Leviten unter ihnen befanden. Es fehlte an Dienern – eine Situation, wie man sie auch heute antreffen kann. Es gibt im Werk des Herrn so viel zu tun, aber oft sind nur wenige bereit, Energie, Zeit und Geld für die Sache des Herrn einzusetzen. Man ist nicht bereit, auf äussere Vorteile, Bequemlichkeiten usw. zu verzichten.
Am Fluss Ahawa
Esra wusste um die Wichtigkeit des Dienstes der Leviten. Deshalb unternahm er vor der Abreise einen Versuch, doch noch einige Leviten und Nethinim zur Rückkehr nach Jerusalem zu bewegen. Aus Vers 18 kann man wohl schliessen, dass er das Problem auch im ernsten Gebet vor Gott brachte. Wie schön ist das Eingreifen der guten Hand Gottes! Er bewirkte, dass sich schliesslich 38 Leviten und 220 Nethinim dem Zug Esras anschlossen. – So dürfen wir auch heute den Herrn bitten, dass Er noch Arbeiter in sein Werk beruft (Matthäus 9,37.38). Doch wir wollen Ihn auch fragen: «Was soll ich tun, Herr?» (Apostelgeschichte 22,10).
Bevor der Zug aufbrach, rief Esra am Fluss Ahawa ein Fasten aus. Dort demütigten sie sich vor Gott und erbaten von Ihm Bewahrung auf der gefährlichen Reise. Angesichts der Schwierigkeiten, die vor ihnen lagen, und der Feinde, denen sie unterwegs begegnen konnten, fühlten sie ihre Schwachheit. Sie brauchten Gottes Schutz und Hilfe.
Menschlich gesehen hätte Esra vom König, in dessen Gunst er stand, militärischen Begleitschutz anfordern können. Aber Esra hatte vor jenem Herrscher bekannt, was für einen guten und treuen Gott sie hatten. Eine Bitte um menschliche Hilfe hätte dieses gute Bekenntnis zu leeren Worten gemacht. – Jetzt wurde ihr Bekenntnis auf die Probe gestellt. Jetzt sollte sich ihr Gottvertrauen bewähren. Im Gebet übergaben sie sich und ihre Habe dem Schutz Gottes. Mit der Kraft, die sie in Ihm fanden, machten sie sich dann auf den Weg (Vers 31). Wie nachahmenswert!
Der Transport der Schätze
Es gab noch etwas zu regeln, bevor sie sich auf den Weg nach Jerusalem machen konnten. Zwölf Obersten der Priester wurde die Verantwortung über das Silber, das Gold und die heiligen Geräte übertragen. Sie mussten dafür sorgen, dass diese freiwilligen Gaben für das Haus Gottes unbeschadet an ihren Bestimmungsort kamen – eine überaus verantwortungsvolle Aufgabe! Alles, was diesen treuen Männern anvertraut wurde, wurde genau abgewogen. Hatte Esra kein Vertrauen zu ihnen? Doch, aber er wollte jedem Misstrauen, das von irgendeiner Seite hätte auftauchen können, von allem Anfang an entgegentreten.
Diese Grundsätze müssen auch heute beachtet werden, wenn es um die Verwaltung materieller Güter unter den Gläubigen geht. Das Neue Testament bestätigt, dass es immer mehrere und vertrauenswürdige Brüder waren, denen die Verwaltung der materiellen Gaben anvertraut wurde (1. Korinther 16,2.3; 2. Korinther 8,18.22; 1. Timotheus 3,10). Als es darum ging, eine materielle Gabe der Versammlungen von Mazedonien und Achaja den bedürftigen Gläubigen in Jerusalem und Judäa zu bringen, bemühte sich der Apostel Paulus ähnlich wie Esra darum, jedes Misstrauen zu vermeiden. In 2. Korinther 8,20.21 heisst es: «Wobei wir dies zu vermeiden suchen, dass uns jemand übel nachredet dieser reichen Gabe wegen, die von uns bedient wird; denn wir sind auf das bedacht, was ehrbar ist, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen.»
Die Reise und die Ankunft in Jerusalem
Die eigentliche Reise begann am 12. des ersten Monats (vergleiche Esra 7,9). Die ganze, mehrere Monate dauernde Reise wird mit den Worten zusammengefasst: «Die Hand unseres Gottes war über uns, und er rettete uns von der Hand des Feindes und des am Weg Lauernden.» Gott hat noch keinen im Stich gelassen, der sein Vertrauen ganz auf Ihn gesetzt hat. Die Erfahrungen Esras ermuntern jeden Glaubenden, den Schutz und die Hilfe des Herrn in Anspruch zu nehmen und sich im Vertrauen ganz auf Ihn zu stützen.
Am vierten Tag nach ihrer Ankunft in Jerusalem wurden das Silber, das Gold und die heiligen Geräte den Priestern und Leviten abgeliefert. Wieder waren es mehrere, die das Wägen vollzogen. Vers 34 will sicher aussagen, dass gar nichts fehlte. Nichts ging verloren und nichts wurde veruntreut. Gott wird einmal die Treue jener Priester belohnen, denen Esra am Fluss Ahawa diese grosse Verantwortung übertragen hatte (Offenbarung 22,12).
In den Opfern, die die Zurückgekehrten Gott darbrachten, dachten sie an das ganze Volk Israel. In ihrem Herzen schlossen sie alle mit ein. Der Augenblick wird kommen, da Römer 11,26 wahr werden wird: «Und so wird ganz Israel errettet werden.»
Geht es uns nicht ähnlich? Wir sehen die Zerrissenheit unter den Gläubigen. Aber in unserem Herzen dürfen wir die Einheit aller Erlösten festhalten. Bald kommt der Augenblick, da der Herr sich seine Versammlung, zu der alle gläubigen Christen gehören, verherrlicht darstellen wird – eine wunderbare Einheit.
Mangel an Absonderung
Nach der ersten Freude der Rückkehrer unter Esra wurde er mit einer sehr traurigen Sache konfrontiert. Das Volk und sogar die Priester und Leviten hatten sich durch Heirat mit den heidnischen Bewohnern des Landes vermischt. Gott hatte dies im Gesetz klar verboten, weil Er den bösen Einfluss kannte, den diese Menschen aus den Nationen auf sein Volk ausüben würden (2. Mose 34,12-16; 5. Mose 7,1-6). Nun hatten die aus dem Exil Zurückgekehrten diese göttlichen Anordnungen missachtet und übertreten.
Esra, der nicht nur Priester, sondern auch ein kundiger Schriftgelehrter war, erkannte sofort den Ernst der Situation. Völlig zerknirscht beugte er sich vor Gott in tiefer Trauer über die Sünden seines Volkes. Seine demütige Haltung zog alle die an, die ebenfalls wegen der Treulosigkeit des Volkes vor dem Wort Gottes zitterten.
Gott möchte auch von uns Christen, dass wir uns klar von den Ungläubigen trennen und keine Verbindung mit der Welt eingehen. Wie ernst sind die Warnungen in 2. Korinther 6,14-18: «Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen …» Der Apostel Johannes ruft uns zu: «Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist.» Und Jakobus fragt: «Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgend ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes» (Jakobus 4,4). Möchten wir in unserem Leben jede Weltförmigkeit meiden, aber auch wie Esra uns angesichts der Weltförmigkeit unter den Christen vor Gott demütigen.
Demütigung vor Gott
Das Abend-Speisopfer gehörte zum beständigen Abend-Brandopfer (Esra 3,3; 2. Mose 29,38-41; 4. Mose 28,3-8). Die beständigen Opfer reden von der Grundlage, auf der wir als Glaubende Gott nahen können. Es ist der Sühnungstod unseres Erlösers, in dem was Er am Kreuz für Gott war (Brandopfer; 3. Mose 1,4). Auf dieses Opfer stützte sich Esra, als er sich in seinem Gebet an Gott wandte.
In seinem Flehen machte er sich eins mit den Sünden seines Volkes, obwohl er selbst in Gottesfurcht lebte (vergleiche das Gebet Daniels in Daniel 9,4-19). Er dachte an die früheren Ungerechtigkeiten Israels, die dazu geführt hatten, dass das Volk in die Gefangenschaft gekommen war. Die Rückkehr eines Teils des Volkes war eine grosse Gnade vonseiten Gottes, auch wenn die Juden ihre Selbstständigkeit nicht mehr erlangten, sondern Knechte des persischen Königs blieben. Doch jetzt hatten sich viele wieder versündigt, indem sie sich mit den heidnischen Nationen im Land vermischt hatten. Esra war darüber tief traurig. Er war sich bewusst, dass Gott Grund gehabt hätte, sie jetzt ohne Überrest zu vertilgen.
Worauf konnte er sich noch stützen? Er anerkannte Gottes Gerechtigkeit und beugte sich schonungslos vor Ihm: «Siehe, wir sind vor dir in unserer Schuld.» Würde Er in seiner grossen Barmherzigkeit noch einmal vergeben? Ja, wenn sie sich nach Sprüche 28,13 verhielten: «Wer seine Übertretungen bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen.»
Aufstehen und handeln
Die Beugung Esras und derer, die vor dem Wort Gottes zitterten, wirkte sich auf das Gewissen der Einzelnen im Volk aus. Sie versammelten sich mit vielem Weinen zu Esra und waren bereit, die Konsequenzen aus ihrem verkehrten Verhalten zu ziehen.
Schekanja, der im Namen der Anwesenden zu Esra redete, sprach von «Hoffnung für Israel bezüglich dieser Sache». Die Hoffnung und Barmherzigkeit konnte aber nur Wirklichkeit werden, wenn echtes Selbstgericht vorhanden war und wenn sie ihre fremden Frauen und deren Kinder wegschickten.
Wir sind vielleicht schockiert über ein solches Vorgehen. Doch wir müssen bedenken, dass dies zur Zeit des Gesetzes geschah, das so etwas verlangte. Wie ganz anders ist es in der Zeitperiode der Gnade! In 1. Korinther 7,12-16 wird der Fall geschildert, dass in einer Ehe von zwei ungläubigen Menschen ein Teil – die Frau oder der Mann – gläubig wird. Dann sollen die Ehegatten zusammenbleiben und nicht scheiden. Es besteht die Hoffnung, dass der ungläubige Teil sich ebenfalls bekehrt.
Wohl stand der Priester Esra jetzt auf, um zu handeln. Doch seine Trauer und Beugung waren noch nicht zu Ende. In einer Zelle des Tempels, in der Gegenwart Gottes, fastete und trauerte er über die Treulosigkeit der Weggeführten. Sollten wir uns über die Sünden und Weltlichkeit bei denen, die bekennen, Christen zu sein, nicht auch beugen und trauern?
Das Volk wird versammelt
Nun wurden alle aus dem Exil Zurückgekehrten innert drei Tagen nach Jerusalem gerufen. Wer dem Aufruf keine Folge leistete, musste mit den härtesten Konsequenzen rechnen. Jetzt war die Zeit zum Handeln gekommen. Die Echtheit des Selbstgerichts sollte sich durch entsprechende Taten zeigen. Darauf würde Gott sicher mit Erbarmen reagieren und dem Überrest des Volkes nicht den Garaus machen.
So musste Esra den zitternden, im Regen stehenden Menschen ihre Treulosigkeit vorhalten und sie auffordern, sich von den fremden Frauen zu trennen. Das Volk war bereit, Busse zu tun und der Busse würdige Frucht zu bringen. Doch es war offensichtlich, dass dies nicht an einem Tag zu bewerkstelligen war. Aber die Bereitschaft war da, alles zu tun, um «die Glut des Zorns unseres Gottes» von ihnen abzuwenden. Dem Volk war deutlich geworden, wie sehr sie gegen Gottes Heiligkeit, die Er von seinem Volk erwartete, verstossen hatten.
Nicht alle waren mit diesem Vorgehen einverstanden. Vers 15 zeigt, dass es Widerstand gab. Sogar ein Levit, der doch das Gesetz Gottes hätte kennen müssen, schloss sich dem Widerstand an.
Auch heute stellt man Unverstand und sogar Widerstand unter Christen fest, wenn solche da sind, die sich mit Entschiedenheit von jeder Art des Bösen trennen und keine Gemeinschaft mit Ungläubigen haben wollen. Gott aber möchte keine Kompromisse: 2. Korinther 6,14-18; 7,1.
Trennung vom Bösen
Die Untersuchung und Bereinigung der Sünde gegen den Herrn nahm einige Zeit in Anspruch (Esra 10,16.17). Esra, der Priester, leitete die ganze Angelegenheit.
Zuoberst auf der Liste der Männer, die fremde Frauen heimgeführt hatten, stehen die Söhne der Priester. Es waren Nachkommen Jeschuas, des Hohenpriesters, der zusammen mit Serubbabel den ersten Zug der Zurückkehrenden angeführt hatte. Wie traurig, dass die Söhne eines Mannes, den der Herr als Werkzeug gebrauchen konnte, sich so verderbt hatten und vom Weg der Gedanken Gottes abgekommen waren! Diese fehlbaren Priester waren jedoch bereit, ihre heidnischen Frauen hinauszutun und einen Widder als Schuldopfer zu geben.
Dann folgt eine lange Liste derer, die sich in dieser Angelegenheit schuldig gemacht hatten. Das Buch endet mit der betrüblichen Bemerkung: «Alle diese hatten fremde Frauen genommen, und es gab unter ihnen Frauen, die Kinder geboren hatten.» Das Buch begann mit dem gnädigen Wirken Gottes, der den Gefangenen seines Volkes eine Möglichkeit schenkte, in ihre Heimat zurückzukehren. Sobald der Mensch aber unter Verantwortung steht, zeigen sich Untreue, Versagen, Niedergang. Das ist auch das Bild der Geschichte der verantwortlichen Christenheit.
Mit Kapitel 10 ging die grosse Aufgabe Esras zu Ende. Wir werden diesem Priester aber im Buch Nehemia wieder begegnen. Dort tut er einen Dienst, der an Esra 7,10 erinnert: Er las den versammelten Juden das Wort Gottes vor und machte das Gelesene verständlich.
Einleitung
Epheser 1 – 3: Die christliche Stellung
- Wir stehen persönlich heilig und untadelig vor Gott, denn Er hat uns zu seinen geliebten Kindern gemacht.
- Wir bilden gemeinsam die Versammlung Gottes. Sie ist der Leib des Christus und der heilige Tempel im Herrn.
Epheser 4 – 6,9: Der christliche Wandel
Unser Verhalten soll der christliche Stellung entsprechen:
- im Kreis der Gläubigen,
- im Umgang mit der Welt,
- in Ehe, Familie und Beruf.
Epheser 6,10-24: Der christliche Kampf
Der Teufel will uns die Freude am christlichen Segen wegnehmen. In der Kraft des Herrn und mit der ganzen Waffenrüstung können wir ihm widerstehen.
Der christliche Segen
Der Epheser-Brief vermittelt uns den ewigen Vorsatz oder Plan Gottes für Christus und für die, die in der Zeit der Gnade an Ihn glauben. Paulus ist als Apostel Jesu Christi von Gott autorisiert, darüber zu schreiben. Er spricht die gläubigen Christen in Ephesus als Heilige und Treue an. Durch das Blut Jesu Christi sind sie geheiligt worden. Das ist die Stellung jedes Glaubenden in der jetzigen Zeit. In ihrem Verhalten waren die Epheser Gott und seinem Wort treu. Das darf auch uns kennzeichnen.
Jeder von neuem geborene Christ ist von Gott reich beschenkt worden. Dieser Segen ist geistlich, himmlisch und ewig. Damit steht er im Gegensatz zum irdischen, materiellen Reichtum, der vergeht. Wir dürfen ihn jetzt schon geniessen, obwohl wir sein Ausmass erst in der Zukunft wirklich erfassen können.
Was beinhaltet dieser Reichtum? Die Verse 4-5 beschreiben etwas davon. Bevor Gott Himmel und Erde schuf, hatte Er an dich und mich gedacht. Er wählte uns aus allen, die einmal an Ihn glauben würden, aus, um uns ein besonderes Teil zu geben. Er wollte uns zu seinen Kindern machen, die heilig und untadelig vor Ihm seien und seine Liebe kennen und geniessen. Weiter wollte Er uns als seine Söhne adoptieren, damit wir die Gedanken seines Herzens verstehen. Das ist das grosse Geschenk, das Gott, der Vater, uns nach der Herrlichkeit seiner Gnade geben wollte.
Damit wir diesen Segen empfangen konnten, hat Gott uns durch das Blut Jesu erlöst und uns nach dem Reichtum seiner Gnade alle Sünden vergeben.
Das Erbteil
Gott hat auch einen Vorsatz mit der Schöpfung. Er wird ein Geheimnis genannt, weil er in früherer Zeit noch nicht bekannt war, uns jetzt aber mitgeteilt ist.
Gott hat sich vorgesetzt, die ganze Schöpfung – das, was in den Himmeln, und das, was auf der Erde ist – Christus als Erbteil zu geben, damit Er darüber herrsche. Er soll das Haupt oder der Verwalter des Universums sein. Und wir, die Glaubenden der Gnadenzeit, haben darin auch ein Erbteil bekommen. Wir sind seine Miterben und als solche werden wir die Herrschaft über die Schöpfung mit Ihm teilen. Dieser Vorsatz Gottes wird Wirklichkeit werden, wenn Jesus Christus wiederkommt, um die Verwaltung von Himmel und Erde anzutreten.
Wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir das Wort der Wahrheit, das Evangelium des Heils gehört haben. Der erste Teil dieser Botschaft beinhaltet die Tatsache, dass wir von Natur aus Sünder sind und darum das Gericht Gottes verdient haben. Der zweite Teil zeigt das Angebot Gottes der Errettung: Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, um uns zu erlösen. Durch den Glauben an die ganze Botschaft des Evangeliums und durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist sind wir in eine wunderbare Stellung versetzt worden. Wir sind Kinder, Söhne und Erben Gottes! Der Glaube ist die persönliche Entscheidung zur Annahme des Evangeliums Gottes. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist ein göttliches Werk. Damit sagt Gott: Du gehörst jetzt für immer Mir! Weil der Geist in uns wohnt, haben wir die Garantie, dass wir unser Erbe einmal antreten werden.
Das erste Gebet des Apostels
Der Apostel betet jetzt für die Epheser. Zuerst dankt er Gott für ihre gelebte Glaubensbeziehung zum Herrn Jesus und für ihre Liebe zu allen Erlösten. Beachten wir die Reihenfolge: Nur wer eine Beziehung zu Christus im Himmel pflegt, kann auch im Verhältnis zu den Glaubensgeschwistern die richtigen Empfindungen haben.
Die grosse Bitte von Paulus ist, dass Gott uns Verständnis über das gebe, was Er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Er möchte, dass wir in unseren Herzen erleuchtet werden, d.h. dass wir nicht mit dem Verstand, sondern im Glauben begreifen, wie reich wir im Herrn Jesus sind. Drei christliche Wahrheiten sollen wir erfassen:
- die Hoffnung unserer Berufung. Das bezieht sich auf die Verse 4 und 5: Wir sind in eine herrliche Beziehung zu Gott, dem Vater, gebracht.
- den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Hier geht es um die Tatsache von Vers 11: Wir sind Miterben des Herrn Jesus.
- die überragende Grösse seiner Kraft an uns, den Glaubenden, spricht vom mächtigen Wirken Gottes bei unserer Bekehrung (siehe Epheser 2).
Diese göttliche Macht entfaltete sich zuerst bei der Auferweckung des Herrn Jesus. Gott hat Ihm anschliessend den Platz zu seiner Rechten gegeben. In dieser Position steht Christus als Mensch über jeder anderen Macht, die es im Universum gibt. In den Versen 22-23 wird die Versammlung, die Gesamtheit aller Erlösten der Gnadenzeit, erwähnt. Als sein Leib ist sie untrennbar mit dem verherrlichten Christus verbunden.
Die christliche Stellung
Das zweite Kapitel des Epheser-Briefs beschreibt Gottes Wirken, um einzelne Menschen in die christliche Stellung zu bringen (Epheser 2,1-10) und um die Versammlung Gottes zu bilden (Epheser 2,11-22).
Vor unserer Bekehrung waren wir wegen unseren Sünden tot für Gott. Wir lebten unter dem Einfluss Satans und nach den Prinzipien der Welt. Das ist die Herkunft aller Glaubenden aus den Heidenvölkern. Auch die Erlösten mit jüdischer Abstammung (Vers 3) führten einst ein Leben, das von den Wünschen des Fleisches und vom Eigenwillen geprägt war.
Weil in unserem Leben gar nichts für Gott da war, handelte Gott aus eigenem Antrieb. Er erbarmte sich über uns und hat uns in seiner grossen Liebe mit dem Christus lebendig gemacht. Weil wir tot waren, bekamen wir neues, ewiges Leben. Weiter hat Gott uns mitauferweckt. Durch seine Auferstehung ist der Herr Jesus der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Als solche, die mit Ihm auferweckt sind, gehören wir ebenfalls zur neuen Schöpfung. Schliesslich hat Gott uns mit Christus in den himmlischen Örtern mitsitzen lassen. Das ist die neue, himmlische Stellung, die wir mit dem Herrn Jesus vereint vor Gott besitzen.
Diese ewige Errettung besitzen wir seit unserer Bekehrung. Wenn wir in der Herrlichkeit sind, wird sie zur vollen Entfaltung kommen (Vers 7). Wir haben gar nichts dazu beigetragen, Gott hat alles getan. Selbst der Glaube, durch den wir das Heil ergriffen haben, ist ein Geschenk Gottes. So gibt es nichts zu rühmen als nur seine Gnade.
Die Versammlung – ein Leib
In den Versen 1-3 wird der Zustand der unbekehrten Menschen beschrieben. Die Verse 11-12 beschreiben ihre äussere Stellung auf der Erde. Die meisten Christen in Ephesus waren nicht jüdischer Herkunft. Deshalb hatten sie vor der Bekehrung kein Anrecht an den Vorrechten der Israeliten. Sie waren äusserlich auf Distanz zu Gott. Sie hatten keine Verbindung zum Messias, besassen keine Verheissungen, konnten nicht auf ein zukünftiges Reich hoffen und lebten ohne Gott. Das war auch unsere Situation, bevor wir an den Erlöser glaubten.
Doch durch den Tod des Herrn Jesus sind wir in Gottes Nähe gekommen. Er hat uns nicht ins Judentum geführt, sondern etwas ganz Neues geschaffen: die Versammlung, die aus allen Erlösten der Gnadenzeit besteht, seien sie nun jüdischer oder anderer Herkunft.
Jesus Christus ist jetzt unser Friede, d.h. die Person, die beide Gruppen zusammengebracht hat. Um aus beiden eine Einheit zu machen, musste Er am Kreuz sterben. Einst war das Gesetz wie ein Zaun, der die Juden klar von allen anderen abgrenzte. Diese Trennung und die Feindschaft, die dadurch zwischen Juden und Heiden entstanden ist, sind jetzt unter den Erlösten aufgehoben und weggetan.
Auf der Grundlage des Todes Jesu sind beide Parteien untereinander und mit Gott versöhnt worden. Nicht nur die Feindschaft, sondern auch die Entfremdung ist nicht mehr da. Beide sind in eine harmonische Beziehung zu Gott und zueinander gebracht. Sie bilden zusammen den Leib Christi, die Versammlung.
Die Vesammmlung – ein Haus
Vers 17 beschreibt uns eine Aktivität von Gott zu den Menschen und Vers 18 eine Aktivität von Glaubenden zu Gott. Durch den Geist Gottes wird seit Pfingsten den Fernen (den Nationen) und den Nahen (den Juden) Frieden verkündigt. Es ist die Botschaft des vollen Evangeliums der Gnade Gottes. Sie enthält auch seine Gedanken über die Versammlung. Für alle Glaubenden ist auf der Grundlage des Erlösungswerks des Herrn Jesus der Zugang zu Gott, dem Vater, offen. In der Kraft des Geistes sind wir fähig, Ihm im Gebet zu nahen. Was für ein Vorrecht, das wir jederzeit benutzen dürfen!
Vers 19: Weil alle Erlösten der Gnadenzeit zur Versammlung gehören und den Zugang zum Vater kennen, sind sie bei Gott keine rechtlosen Ausländer mehr, sondern seine Hausgenossen. Ab Vers 19 wird die Versammlung als Haus betrachtet, das Gott selbst baut. Die Apostel und Propheten des Neuen Testaments benutzte Er, um die Grundlage zu legen. In den Schriften des Neuen Testaments haben sie die göttlichen Belehrungen über die Versammlung niedergeschrieben. Jesus Christus ist der Eckstein, nach dem sich alles ausrichtet.
Seit Pfingsten baut Gott an seinem Haus. Es wächst stetig und bei der Entrückung ist es vollendet. Jeder Erlöste der Gnadenzeit ist ein Stein an diesem Gebäude. Das ist der universelle Aspekt der Versammlung, der uns in Vers 21 vorgestellt wird. Gleichzeitig bilden alle Glaubenden, die zu einem Zeitpunkt auf der Erde leben, den Wohnort Gottes. Das ist der zeitliche Aspekt der Versammlung, den wir in Vers 22 finden.
Der ewige Plan Gottes
In Kapitel 3 erklärt uns der Apostel, dass Gott ihm die Verwaltung seines ewigen Ratschlusses anvertraut hat. Weil er diesen Dienst treu ausübte, kam er ins Gefängnis. Seine Aufgabe bestand darin, diese christlichen Wahrheiten zu verkünden und zu erklären. Damit er diesen Auftrag ausführen konnte, hatte Gott dem Apostel zweierlei geschenkt:
- Er hatte ihm das Geheimnis (d.h. seinen ewigen Plan) durch direkte Offenbarung mitgeteilt (Vers 3).
- Er hatte ihm auch ein besonderes Verständnis über seine Gedanken gegeben (Vers 4).
Gottes ewiger Ratschluss wird deshalb ein Geheimnis genannt, weil die Menschen früherer Zeiten davon nichts wussten. Gott hatte es ihnen damals nicht offenbart. Doch in der Zeit der Gnade teilte Er es den Aposteln und Propheten des Neuen Testaments mit.
Vers 6 beschreibt in Kürze die Kernpunkte dieses Geheimnisses. Es wird nochmals betont, dass die Erlösten aus den Nationen jetzt die gleichen Vorrechte wie die Glaubenden jüdischer Herkunft besitzen. Sie sind Miterben, d.h. sie werden mit Christus über das Universum regieren. Sie sind auch Miteinverleibte. Das bedeutet, dass sie zum Leib Christi, zur Versammlung, gehören. Als Mitteilhaber der Verheissung besitzen sie ewiges Leben und sind Kinder und Söhne Gottes. Durch die glaubensvolle Annahme des Evangeliums wird jeder in diese wunderbare Stellung gebracht.
Die göttliche Gnade hatte Paulus mit dieser grossen Aufgabe betraut, und die göttliche Kraft befähigte ihn, sie auszuüben.
Der Reichtum des Christus
Das Zielpublikum des Dienstes von Paulus waren hauptsächlich die Menschen aus den Nationen, d.h. alle Nicht-Juden. Ihnen verkündigte er den unergründlichen Reichtum des Christus. Das beinhaltet alles, was diese Person ist: ewiger Gott, sündloser Mensch, Heiland der Welt, Haupt des Leibes usw. Weiter erklärte er ihnen das jetzige Heilszeitalter und den Charakter der Versammlung, zu der sie nun gehörten.
Als Gott die Himmel und die Erde geschaffen hatte, da jauchzten und jubelten die Engel (Hiob 38,7), weil sie in der Schöpfung etwas von der Grösse ihres Schöpfers erkannten. Durch die Bildung und Existenz der Versammlung erhalten sie noch einen weit besseren Anschauungsunterricht: Sie sehen etwas von der vielfältigen Weisheit Gottes.
Den ewigen Vorsatz fasste Gott in Christus Jesus, der das Zentrum dieses Ratschlusses ist. Die Grundlage dieses Plans ist das Erlösungswerk des Herrn auf Golgatha, und wir, die Glaubenden der Gnadenzeit, sind die Gegenstände davon.
Die Verse 12 und 13 zeigen schliesslich zwei praktische Auswirkungen – eine positive und eine negative – für uns, weil wir in Christus so reich gemacht sind. Dank unserer Stellung in Ihm dürfen wir im Gebet freimütig und vertrauensvoll mit Gott, unserem Vater, reden. Doch wir erfahren bei der praktischen Verwirklichung unserer himmlischen Berufung auch den Widerstand der uns umgebenden Welt, besonders der religiösen Menschen. Das hat der Apostel als Verwalter der christlichen Wahrheit speziell erlebt.
Das zweite Gebet des Apostels
Ab Vers 14 betet der Apostel ein zweites Mal für die Epheser. Er richtet sich an den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Sein Wunsch ist es, dass alle Glaubenden den Reichtum, den sie in und mit Christus besitzen, nicht nur kennen, sondern im täglichen Leben auch geniessen. Dazu benötigen wir Kraft. Gott, der Vater, schenkt sie uns durch den Heiligen Geist nicht nach dem Mass unserer Bedürfnisse, sondern nach dem Mass seiner Herrlichkeit. Dadurch wird das neue Leben in uns gestärkt.
Doch der Geist möchte in unseren Herzen auch Christus gross machen. Wir sollen verstehen, welch hohe Wertschätzung der Vater für den Sohn hat, der Ihn als Mensch hier unendlich verherrlicht hat. Jesus Christus, der das Zentrum der Gedanken Gottes ist, soll auch der Mittelpunkt unseres Lebens werden.
Wir dürfen zudem tiefe Eindrücke von der Herrlichkeit Gottes bekommen, wie sie sich in seinem Ratschluss offenbart. Er ist grenzenlos, wie die vier Dimensionen in Vers 18 dies andeuten. In Vers 19 handelt es sich um die umfassende Liebe des Herrn Jesus. Er liebt den Vater, Er liebt die Versammlung und Er liebt jeden Erlösten. Die Beschäftigung mit seiner unergründlichen Liebe in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird unsere Herzen glücklich machen und uns einen Eindruck von der Grösse Gottes geben.
Der Apostel beendet das Gebet mit einem Lobpreis. Er erhebt Gott, der das geistliche Wachstum bewirkt und uns den Genuss an unseren Segnungen schenkt. Ihm gebührt das ewige Lob in der Versammlung.
Der Berufung entsprechen
Unser Leben soll nun unserer Stellung in Christus entsprechen. Deshalb gibt Paulus in den Kapiteln 4 bis 6 Ermahnungen und Belehrungen, damit wir würdig unserer Berufung leben. In Kapitel 4 liegt der Schwerpunkt auf unserem Verhalten im Miteinander der Familie Gottes. Vers 2 stellt uns einige sittliche Eigenschaften vor. Eine demütige Gesinnung ist für die Beziehungen im Volk Gottes sehr förderlich. Wir wollen auch Geduld miteinander haben.
Was bedeutet die Aufforderung in Vers 3, «die Einheit des Geistes im Band des Friedens zu bewahren»? Es ist die praktische Einheit der Glaubenden, die der Heilige Geist auf der Grundlage des Wortes Gottes bewirken möchte. Die Einheit des Leibes Christi besteht. Es geht jetzt darum, mit Fleiss und einer friedfertigen Haltung diese Einheit sichtbar darzustellen. Das geschieht in der Verwirklichung der biblischen Anweisungen über die örtliche Versammlung und der Beziehungen der Versammlungen untereinander.
Es gibt drei Bereiche, in den die Glaubenden in Beziehung zueinander stehen. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung zeigt die Gott gewirkte Beziehung der Erlösten an. Alle gehören zum Leib Christi, besitzen den Heiligen Geist und werden einmal in den Himmel kommen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe spricht vom Bereich unseres Bekenntnisses. Der Herr möchte, dass wir auf der Erde ein gemeinsames Zeugnis für Ihn sind. Als ein Gott und Vater aller ist Gott unser Schöpfer. Er hat die Beziehung der Ehe und Familie gegeben, in der wir uns als Christen richtig verhalten sollen.
Gaben und Dienste
In unserem Abschnitt geht es um die Auferbauung der Versammlung durch die Gnadengaben. Der Herr schenkt und leitet sie zum Wohl der Glaubenden. Jesus Christus ist Mensch geworden und in den Tod hinabgestiegen, damit verlorene Menschen gerettet und aus der Gewalt Satans befreit werden können. Aber nach drei Tagen ist Er auferstanden und als Mensch in den Himmel hinaufgestiegen. Er hat jetzt dort alle Machtbefugnis. Er benutzt sie, um den Menschen Gaben zu geben, die uns in Vers 11 beschrieben werden. Die Apostel und Propheten sind grundlegende Gaben. Wir besitzen sie heute noch in den Büchern des Neuen Testaments. Evangelisten, Hirten und Lehrer sind bleibende Gaben, die der Herr heute noch gibt. Es sind Brüder, die oft in ihrer Tätigkeit die gesamte Versammlung im Auge haben.
Ab Vers 12 beschreibt Paulus die Wirkungen und das Ziel der Ausübung dieser Gaben. Jeder einzelne Erlöste soll geistlich wachsen. Aber auch die Versammlung, die Gesamtheit aller Kinder Gottes, soll auferbaut werden. Dabei ist es Gottes Ziel, dass wir den Herrn Jesus besser kennen, dass unsere Beziehung zu Ihm sich vertieft und wir einander näher kommen. Er möchte, dass wir Stabilität im Glauben bekommen. Je besser wir die Bibel kennen, desto weniger können wir durch falsche Lehren von Christus abgezogen werden.
Neben den Gaben, die der Herr schenkt, gibt es im Leib Christi auch Gelenke der Darreichung. Es sind die Tätigkeiten aller einzelnen Christen in Liebe zum Wohl der ganzen Versammlung. Nehmen wir sie wahr?
Der alte und der neue Mensch
Die Verse 17-19 beschreiben das Leben vor der Bekehrung. Die Verse 20-24 zeigen uns, welche Veränderung mit uns stattgefunden hat, als wir zum Glauben an Jesus Christus kamen. Schliesslich werden wir in den Versen 25-32 aufgefordert, die Eigenschaften des neuen Lebens im Alltag zu entfalten.
Ungläubige Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, werden von menschlichen Gedanken und Philosophien geprägt. Ihr Verstand ist verfinstert und ihr Herz verstockt. Auch in ihrem Lebenswandel, der eine Folge ihrer Einstellung ist, sieht es nicht besser aus. Weil alle Empfindungen für Gut und Böse abgestumpft sind, leben sie ausschweifend. Das hat auch uns früher mehr oder weniger gekennzeichnet. Doch das sollte jetzt nicht mehr so sein.
Jesus Christus lehrt uns eine andere Lebensweise, die Er uns vorgelebt hat, als Er hier war. Doch damit wir seinem Beispiel folgen können, musste bei uns eine grundlegende Veränderung stattfinden. Der alte Mensch ist unsere Stellung vor der Bekehrung: Wir konnten nur sündigen. Er wurde am Kreuz verurteilt, als der Herr Jesus für uns das Gericht erduldete. Als wir zum Glauben an Ihn kamen, haben wir den alten Menschen abgelegt. Aber nicht nur das, wir haben auch den neuen Menschen angezogen: Wir müssen jetzt nicht mehr sündigen, obwohl wir dazu noch fähig sind.
Um ein Leben zur Freude Gottes führen zu können, gilt es zuerst diesen Wechsel, der bei der Bekehrung stattgefunden hat, im Glauben zu bejahen und dann in der Kraft des Geistes Gottes zu verwirklichen.
Ein Verhalten zur Ehre Gottes
Das Modell des neuen Menschen ist der Herr Jesus, so wie Er hier gelebt hat. Ihn dürfen wir jetzt als unser Beispiel nehmen. Bei den Ermahnungen in diesem Abschnitt wird häufig auf unser Verhalten vor der Bekehrung hingewiesen, um den Unterschied zur neuen Lebensweise hervorzuheben.
Als Christen sollen wir nicht mehr lügen, sondern so wie Jesus immer die Wahrheit sagen. – Früher liessen wir uns im fleischlichen Zorn zu weiteren Sünden hinreissen. Jetzt soll die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen. Ein von Gott gewirkter Zorn über das Böse ist keine Sünde (Markus 3,5). – Im alten Leben gaben wir durch Sünden dem Teufel Raum. So wie Jesus Christus sollen wir nun den Verführungen Satans mit dem Wort Gottes begegnen. – Anstatt zu stehlen, arbeiten wir als Christen nicht nur für die eigene Brieftasche, sondern auch um Bedürftigen etwas geben zu können. Wie ist unser Heiland den Menschen, die in Not waren, behilflich gewesen! – Haben sich unsere Worte und unsere Sprache seit unserer Bekehrung verändert? Was wir sagen, soll nun unsere Glaubensgeschwister aufbauen. Wie konnte doch der Herr Jesus durch seine Worte die Mutlosen wieder aufrichten! – Durch unseren Eigenwillen betrüben wir den Heiligen Geist. Nehmen wir auch da Jesus als unser Beispiel! Er lebte abhängig von Gott, gehorchte Ihm und war voll Heiligen Geistes. – Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung sind die Reaktionen des Fleisches, wenn uns Böses widerfährt. Sollten wir nicht wie Christus Mitleid und eine vergebende Haltung haben?
Wandelt in Liebe
Die Verse 1-21 enthalten Ermahnungen für unser Leben. Der neue Mensch, den wir angezogen haben, ist nach Gott geschaffen (Epheser 4,24), darum soll unser Verhalten Gott entsprechen. Wir sind seine Nachahmer: Er ist Liebe und Licht, und wir leben als geliebte Kinder (Vers 1) und als Kinder des Lichts (Vers 8). Darin ist Jesus Christus unser Vorbild: Als Er hier lebte, offenbarte Er die göttliche Liebe in zwei Richtungen. Er hat uns, die Glaubenden, geliebt und sich selbst für uns in den Tod gegeben. Und aus Liebe zu seinem Gott lebte Er zu seiner Freude und opferte sich am Kreuz Ihm zu einem duftenden Wohlgeruch. Seine vollkommene Liebe spornt uns an, Gottes Liebe in unserem Leben zu zeigen.
Hurerei ist jeglicher Geschlechtsverkehr ausserhalb der Ehe. Habsucht ist die Gier nach mehr Geld oder Besitz. Albernes Geschwätz und Witzelei sind Vergehungen mit der Zunge. Solche Sünden sollen in unserem Leben nicht vorkommen. Wir sind durchaus dazu fähig, wenn wir uns nicht vom Herrn bewahren lassen. Es liegt auch eine Gefahr darin, sich unnötig mit dem Bösen zu beschäftigen. Wenn wir darüber reden oder nachdenken, verunreinigt das uns. Hurer, Unreine und Habsüchtige sind Menschen, die ganz in diesen Sünden leben (Vers 5). Solange sie nicht echt Buße darüber tun, haben sie keine Beziehung zu Gott, sondern gehen dem Gericht entgegen. Ist das nicht eine Warnung für uns, es mit der Sünde nicht leicht zu nehmen? Obwohl heute viele die Sünde bagatellisieren, wollen wir doch in keiner Weise im Bösestun mitmachen.
Wandelt im Licht
Gott ist Licht und wir waren vor unserer Bekehrung Finsternis. Nichts von Gott wurde in unserem Leben sichtbar. Doch welch wunderbare Veränderung hat stattgefunden: Als solche, die göttliches Leben besitzen, sind wir jetzt Licht im Herrn. Wir sind in Christus in Übereinstimmung mit Gott gebracht und werden jetzt aufgefordert, das auch als Kinder des Lichts zu zeigen. Güte gegenüber unseren Mitmenschen, praktische Gerechtigkeit in unseren Taten und Wahrheit in unseren Worten dürfen uns nun kennzeichnen. Wir fragen nun: Was macht meinem Herrn Freude?
Die Werke der Finsternis sind alles, was das Licht scheut. Damit sollen wir nichts zu tun haben. Im Gegenteil, durch ein Leben zur Ehre Gottes verbreiten wir Licht und stellen so das Böse bloss. Das hat Jesus Christus in besonderer Weise verwirklicht. Sein reines, heiliges und Gott geweihtes Leben verurteilte das sündige, scheinheilige Leben der religiösen Juden.
Durch ungerichtete Sünden sind wir auf Distanz zu Gott, halten uns im Dunkeln auf und stehen in Gefahr, geistlich einzuschlafen. Bei schlechten Lichtverhältnissen ist ein Schlafender nicht von einem Toten zu unterscheiden. So kann auch ein Glaubender, der in der Sünde lebt, nicht von einem Ungläubigen unterschieden werden. Doch Gott ruft jedem zu, der sich in einem geistlichen Schlaf befindet: «Wache auf!» Er spricht durch das Wort das Gewissen an, damit das Leben wieder mit Ihm in Ordnung kommt. Nur mit Christus können wir uns im Licht aufhalten.
Wandelt in Weisheit
Als Christen sollen wir nicht gedankenlos in den Tag hineinleben, sondern im Bewusstsein, dass wir uns in einer bösen Welt befinden. Sorgfalt und Weisheit sind gefragt, damit wir nicht in eine Schlinge des Feindes treten und zu Fall kommen. Wir wollen die gelegene Zeit für die Ewigkeit einsetzen, d.h. die von Gott gegebenen Gelegenheiten nicht nutzlos vorbeigehen lassen. Kennen wir den grundsätzlichen Willen des Herrn für unser Leben? Er möchte, dass wir weder für die Welt noch für uns selbst, sondern für Ihn leben.
Vers 18 stellt zwei Einflüsse einander gegenüber, denen wir uns aussetzen können und die dann unser Leben prägen: der Alkohol oder der Heilige Geist. Wenn wir uns mit Wein berauschen, folgen unweigerlich weitere Sünden. Bildlich können wir im Wein sicher auch andere irdische Freuden sehen, die bei einem unbeherrschten Konsum schädlich sind. Wenn wir hingegen vom Geist Gottes erfüllt werden, hat das drei positive Auswirkungen:
- Wir sind zur gegenseitigen Erbauung (Vers 19). Gerade geistliche Lieder sind dazu eine Hilfe. Wir wollen uns anspornen lassen, wieder mehr gemeinsam zu singen!
- Wir sind Gott, unserem Vater, dankbar für alles, was wir in unserem Leben erfahren (Vers 20). Das setzt ein tiefes Vertrauen in seine Liebe voraus und das Bewusstsein, dass alles, was uns betrifft, von Ihm kommt.
- Wir wollen im Volk Gottes nicht gross herauskommen, sondern zurückstehen (Vers 21).
Die Ehe – Christus und die Versammlung
Die Verse 22-33 geben uns göttliche Unterweisungen über das Eheleben. Zuerst werden die Frauen (Epheser 5,22-24), danach die Männer (Epheser 5,25-33) angesprochen. Die Beziehung zwischen Christus und der Versammlung ist das grosse Vorbild für die eheliche Beziehung zwischen Mann und Frau. Darum belehrt uns dieser Abschnitt auch über die Liebe des Herrn Jesus zu seiner Versammlung und ihre Stellung zu Ihm, ihrem Haupt.
Die Ehefrauen werden aufgefordert, sich ihren eigenen Männern zu unterordnen. Das ist der Platz, den der Herr der Frau in der Ehe gegeben hat und an dem Er sie glücklich machen will. Als Hilfe und Ansporn für die tägliche Verwirklichung darf die Frau an das Verhältnis der Versammlung zu Christus denken: Die Versammlung nimmt gegenüber dem Herrn Jesus ebenfalls eine Stellung der Unterordnung ein. – Als Folge daraus ergibt sich für den Mann die Aufgabe, in der Ehe die Verantwortung als Haupt zu übernehmen.
Die Ehemänner werden ermahnt, ihre Frauen zu lieben. Diese Zuneigung drückt sich nicht nur in Worten aus, sondern zeigt sich darin, dass wir für ihr Wohl sorgen. Jeder Tag gibt Gelegenheit dazu. Das Vorbild ist die vollkommene Liebe des Christus zu seiner Versammlung. Dieser hohe Massstab soll uns nicht entmutigen. Wir wollen vielmehr die Gnade Gottes täglich in Anspruch nehmen, damit wir unsere Frauen nähren und pflegen können (Vers 29). Das beinhaltet neben der materiellen Versorgung sicher auch die geistliche Ernährung und Fürsorge.
Nähren, pflegen, anhangen
Der Ausgangspunkt der Liebe des Herrn Jesus zur Versammlung ist sein Sterben am Kreuz. Er hat sich selbst für sie hingegeben, um sie ewig zu besitzen.
Jetzt ist seine Liebe der Beweggrund für die treue Fürsorge. Dazu benutzt Er das Wort Gottes. Er heiligt die Versammlung (Vers 26), indem Er sich selbst vorstellt, wie Er jetzt im Himmel verherrlicht ist. Dadurch möchte Er unsere Zuneigung wecken, damit wir nur noch für Ihn da sind. Er reinigt die Versammlung durch sein Wort (Vers 26). Es ist sein Bestreben, dass wir in unserem Leben alles entfernen, was nicht zu Ihm passt. Er nährt die Versammlung (Vers 29). Wir benötigen täglich geistliche Nahrung. Er gibt sie uns durch sein Wort. Er pflegt die Versammlung (Vers 29). Unsere Schwachheiten sind für Ihn eine Gelegenheit zur Ausübung seiner Liebe.
Seine Liebe zur Versammlung kommt zur Vollendung, wenn Er sie sich verherrlicht darstellen wird. Dann wird nichts mehr von der Beschmutzung der Sünde und von der Vergänglichkeit der Erde zu sehen sein. Sie wird dann heilig und untadelig vor Ihm sein, so wie Gott es sich in seinem ewigen Vorsatz vorgenommen hat.
Vers 30 betont die innige Verbindung der Versammlung zu Christus. Es ist eine Anspielung auf die Beziehung des ersten Menschenpaares: Eva wurde aus der Rippe von Adam gebildet. Der Grundsatz für den Weg in die Ehe in Vers 31 wird auch auf Christus angewandt. Hat Er nicht den Himmel verlassen, um sich seine Versammlung zu erwerben? Er liebt sie und ist aufs engste mit ihr verbunden.
Familie und Arbeit
Die Verse 1-4 behandeln die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Die Verse 5-9 enthalten Anweisungen für das Verhältnis zwischen Sklaven und Herren in der damaligen Zeit, die wir auf das heutige Berufsleben übertragen dürfen.
Die Kinder werden ermahnt, ihren Eltern zu gehorchen. Das bezieht sich auf die Zeit, in der sie als Kinder zu Hause wohnen. Es freut den Herrn, wenn sie sich ihren Eltern unterordnen und ihre Anweisungen befolgen. «Ehre deinen Vater und deine Mutter.» Auch als Erwachsene sollen die Kinder ihre Eltern ehren und achten, denn darauf ruht der Segen Gottes.
Die Väter sind für die Erziehung der Kinder verantwortlich. Sie werden aufgefordert, sie in Zucht und Ermahnung aufzuziehen. Einerseits ist es nötig, die Kinder zu bestrafen und korrigierend einzugreifen, um eine negative Entwicklung zu vermeiden. Anderseits benötigen sie auch Anweisung für den rechten Weg.
Die Arbeitnehmer sollen ihrem Chef gehorchen und sich seinen Anweisungen unterordnen. Der Herr möchte, dass sie dies in der rechten Einstellung tun: ehrlich, aufrichtig und bereitwillig. Sie dürfen ihre Arbeit – wenn sie auch schwierig oder eintönig ist – für den Herrn tun. Er wird einmal die Treue am Arbeitsplatz belohnen (Vers 8).
Schliesslich werden die Arbeitgeber aufgefordert, in ihrem Verhalten den Untergebenen ein Vorbild zu sein. Sie sollen nie vergessen, dass sie selbst einen Herrn im Himmel haben, dem sie für ihr Leben verantwortlich sind.
Der christliche Kampf
Die Verse 10 bis 20 beschreiben den christlichen Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die bösen, geistlichen Mächte, die uns den Genuss an den geistlichen Segnungen wegnehmen möchten. Diesen Kampf können wir nur in der Kraft des Herrn führen (Vers 10), der den Teufel am Kreuz besiegt hat. Zudem stellt Gott uns eine Waffenrüstung zur Verfügung (Vers 11), damit wir gegen die Listen des Teufels gewappnet sind. Die einzelnen Teile dieser Waffenrüstung sind sittliche Eigenschaften im praktischen Glaubensleben, die uns vor den Angriffen des Feindes schützen.
Den Gürtel der Wahrheit ziehen wir an, indem wir regelmässig die Wahrheit des Wortes Gottes auf unsere Herzen anwenden. Dort sind die Ausgänge des Lebens (Sprüche 4,23). Das wird eine Wirkung auf unser ganzes Leben haben. Der Brustharnisch der Gerechtigkeit weist auf ein Leben in praktischer Gerechtigkeit hin. So besitzen wir ein gutes Gewissen, das sich nichts vorzuwerfen hat. Die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens sprechen von unserer Bereitschaft, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Der Schild des Glaubens ist das völlige Vertrauen auf Gott und sein Wort. Damit wehren wir die feurigen Pfeile des Zweifels, die Satan auf uns abschiesst, ab. Der Helm des Heils schützt unsere Gedanken. Es ist das tägliche Bewusstsein unserer Annahme bei Gott: Niemand kann uns aus seiner Hand rauben (Johannes 10,29). Mit dem Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, können wir den Feind in die Flucht schlagen (Lukas 4,12-13).
Das Gebet
Eigentlich gehört das Gebet auch noch zur Waffenrüstung und ist besonders mit dem Wort Gottes verbunden. Beim Beten drücken wir einerseits unsere Abhängigkeit aus: Wir haben keine Kraft in uns, um dem Feind zu widerstehen. Anderseits zeigen wir beim Beten ein Vertrauen in Gott, der alles vermag.
Wie sollen wir beten? Mit allem Gebet, d.h. regelmässig und mit Flehen. Das ist ein spezielles Rufen zu Gott in einer Notlage. Weiter sollen wir wachsam und mit Ausharren beten.
Wofür sollen wir denn beten? Einmal für alle Erlösten. Da ist keiner ausgeschlossen. Wie vielfältig sind doch die Bedürfnisse der Glaubenden! So wie die Epheser aufgefordert werden, für den Apostel zu beten, dürfen wir für Mitarbeiter im Werk des Herrn vor Gott einstehen. Unsere Fürbitte umschliesst auch die Verkündigung der ganzen christlichen Wahrheit, insbesondere Gottes Gedanken über die Versammlung, damit noch viele Christen sie kennenlernen.
Paulus hält es nicht für nötig, über sich und seine persönlichen Umstände zu schreiben. Tychikus würde die Epheser darüber informieren. Der Apostel nennt ihn einen geliebten Bruder und einen treuen Diener im Herrn. Er gehörte zur Familie Gottes und war eifrig für seinen Meister tätig.
Frieden, Liebe und Glauben haben ihre Quelle in Gott, dem Vater, und im Herrn Jesus Christus. Frieden im Herzen ist ein Ruhen in der Liebe Gottes. Liebe entfaltet sich in den Beziehungen untereinander. Glauben prägt unser tägliches Leben mit Gott.
Einleitung
«Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende» (Johannes 13,1). Dieses Bibelwort fasst die Abschiedsworte des Herrn Jesus zusammen:
- Er wäscht seinen Jüngern die Füsse.
- Er spricht zu ihnen über das Haus des Vaters.
- Er zeigt ihnen, wie sie Frucht bringen können.
- Er stellt ihnen die Liebe seines Vaters vor.
- Er bittet den Vater um Bewahrung für die Gläubigen.
«Es ist vollbracht!» (Johannes 19,30). Jesus Christus lässt am Kreuz sein Leben, um das Werk zu vollbringen, das Ihm der Vater aufgetragen hat. Nach seiner Auferstehung steht Er in der Mitte seiner Jünger und spricht zu ihnen: «Friede euch!»
Buchtipp: Abschiedsworte des Herrn Jesus
Die Fusswaschung
Der Herr ist noch einmal mit seinen Jüngern zusammen. Während des Abendessens steht Er auf, um ihnen die Füsse zu waschen. Diese demütige Aufgabe ist eine Illustration des Dienstes, den Er jetzt im Himmel für die Seinen tut.
Wir leben in einer Welt, in der wir von der Sünde beschmutzt und im Glauben entmutigt werden. Damit wir dennoch Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben können, wäscht uns der Herr immer wieder die Füsse. Er reinigt uns vom Schmutz und befreit uns von dem, was uns niederdrücken will. Sein Beweggrund für diesen Dienst ist die Liebe (Vers 1). Das Mittel, das Er zu unserer Reinigung und Erfrischung benutzt, ist das Wasser des Wortes Gottes (Vers 5; Epheser 5,26).
Petrus macht in seiner Spontanität und in seiner Liebe zum Herrn drei Einwände, die der Herr benutzt, um uns über die Fusswaschung zu belehren:
- Die geistliche Bedeutung der Fusswaschung verstehen wir erst, seitdem Christus im Himmel und der Geist Gottes auf der Erde ist (Vers 7).
- Bei der Fusswaschung geht es um eine praktische, wiederholte Reinigung. Sie ist nötig, damit wir ein Teil mit Christus, d.h. Gemeinschaft mit Ihm haben können (Vers 8).
- Mit der Neugeburt sind wir bei unserer Bekehrung grundsätzlich gereinigt worden (Johannes 3,5; 1. Petrus 1,22.23). Durch diese einmalige Reinigung, die nicht wiederholt werden muss, haben wir neues Leben bekommen und haben dadurch Teil an Christus. In unserer Stellung vor Gott sind wir völlig rein (Vers 10).
Ich habe euch ein Beispiel gegeben
In den Versen 4-11 haben wir gesehen, was der Herr vom Himmel aus für uns tut: Er reinigt und erfrischt uns durch sein Wort. In den Versen 12-17 werden wir über das belehrt, was wir nach seinem Beispiel (Lehrer) und in seinem Auftrag (Herr) auf der Erde tun sollen: Wir sind schuldig einander die Füsse zu waschen. In Liebe und Demut sollen wir einander helfen, das wegzutun, was uns hindert, die Gemeinschaft mit Christus im Himmel zu geniessen. Vielleicht ist es unsere Aufgabe, einem Glaubenden behilflich zu sein, einen Fehltritt Gott gemäss in Ordnung zu bringen (Galater 6,1). Oder der Herr weist uns an, einem bedrückten Christen durch ein Bibelwort Mut zu machen, damit er seinen Glaubensblick wieder auf Christus richtet.
Wenn wir einander die Füsse waschen, gehorchen wir als Knechte unserem Herrn und handeln als Gesandte in seinem Auftrag. Dieser Dienst ist nicht einfach und erfordert eine demütige Herzenshaltung. Aber er bringt Segen und Freude, wenn wir ihn verwirklichen (Vers 17). Für einen Diener gibt es nichts Grösseres, als die Zustimmung seines Herrn zu besitzen.
Ab Vers 18 deckt der Herr Jesus den Verrat von Judas in drei Schritten auf. In einem ersten Schritt erklärt Er seinen Jüngern, dass etwas Schreckliches geschehen wird: Einer, der sich eine lange Zeit in der Nähe des Herrn aufgehalten hat, wird sich gegen Ihn wenden und sein Vertrauen entsetzlich missbrauchen (Vers 18). Der Sohn Gottes, der alles weiss, sagt es seinen Jüngern im Voraus, damit ihr Vertrauen zu Ihm nicht erschüttert wird.
Der Herr entlarvt den Verräter
Es schmerzt den Herrn zutiefst, dass Judas, der wie alle anderen Jünger seine Liebe und Gnade erfahren hat, Ihn verraten wird. In einem zweiten Schritt deckt Er nun die Sünde auf, die geschehen wird: Einer seiner Jünger wird Ihn durch Verrat an seine Feinde überliefern (Vers 21). Durch diese Mitteilung werden alle Jünger ins Licht Gottes gestellt, damit sie sich selbst fragen: Wie stehe ich zum Herrn Jesus?
Die elf anderen Jünger wissen nicht, wer der Verräter ist, denn Judas hat sich bis jetzt völlig unauffällig verhalten. Sie blicken einander an, doch die Antwort finden sie nicht bei sich. Nur der Sohn Gottes kann das Verborgene offenbaren. Johannes befindet sich ganz in seiner Nähe, weil er seine Liebe geniessen möchte. Darum ist er jetzt der geeignete Jünger, um Jesus zu fragen: «Herr, wer ist es?»
Nun offenbart der Herr in einem dritten Schritt den Verräter: Er gibt den eingetauchten Bissen Judas Iskariot. Mit dieser Entlarvung soll der Böse den vertrauten Kreis der Jünger verlassen. Das Gewissen von Judas ist bereits derart verhärtet, dass er nicht davor zurückschreckt, diesen Bissen vom Herrn anzunehmen. Sofort nimmt der Satan völlig von Judas Besitz, treibt ihn zu dieser schrecklichen Tat an und stürzt ihn ins Verderben.
Die anderen Jünger sind völlig überrascht und verstehen die Worte nicht, die der Herr an Judas richtet. Dieser weiss jedoch genau, was Jesus meint. Jetzt, wo er entlarvt ist, erträgt er die Gegenwart des Herrn nicht mehr. So geht er in die Nacht hinaus.
Du kannst mir jetzt nicht folgen
In Vers 31 spricht der Herr Jesus über seinen Tod am Kreuz. Dort wurden zwei Herrlichkeiten sichtbar:
- «Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht.» Als Jesus Christus am Kreuz sein Leben liess, zeigte sich am herrlichsten, wie vollkommen Er als Mensch war. Seine Liebe, sein Gehorsam, seine Hingabe wurden völlig ans Licht gestellt.
- «Gott ist verherrlicht in ihm.» Im Tod des Herrn Jesus zeigte sich am deutlichsten, wer Gott ist. Alle seine Wesenszüge wurden am Kreuz vollkommen dargestellt: seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Gnade und seine Gerechtigkeit.
In Vers 32 finden wir die göttliche Antwort auf das grosse Werk, das Jesus Christus vollbracht hat: Gott hat Ihn sogleich verherrlicht, indem Er Ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben hat.
In den Versen 33-35 hinterlässt der Herr den Seinen ein Gebot: Sie sollen einander lieben. Die Liebe des Herrn Jesus zu seinen Jüngern, die Er ihnen in den drei Jahren auf der Erde erwiesen hat, ist das Modell ihrer Liebe zueinander. Diese gegenseitige Liebe der Glaubenden ist das Band, das sie zusammenhält, und ein Zeugnis von Christus in der Welt.
In den Versen 36-38 warnt der Herr seinen Jünger Petrus ausdrücklich vor den kommenden Stunden: Bevor der Hahn am nächsten Morgen krähen wird, wird Petrus seinen Meister dreimal verleugnen. Er kann dem Heiland jetzt nicht folgen, denn Jesus Christus wird am Kreuz ins Gericht Gottes kommen und der Macht Satans begegnen. Diesen Weg muss Er allein gehen.
Der Weg zum Vater
Der Herr Jesus konnte nicht bei seinen Jüngern bleiben. Darum stand ihnen eine grosse Veränderung bevor:
- Anstatt Ihn weiter mit den leiblichen Augen zu sehen, würden sie von nun an eine Glaubensbeziehung zu Ihm haben (Vers 1).
- Ihre Erwartung im Blick auf das irdische Reich würde sich nicht jetzt erfüllen. Stattdessen gab der Herr ihnen eine himmlische Hoffnung (Johannes 14,2.3).
Das Haus des Vaters ist der ewige Wohnort Gottes. Dort befinden sich viele Wohnungen, denn nach dem göttlichen Vorsatz sollen die Erlösten der Gnadenzeit dort einmal ihr ewiges Zuhause haben. Um ihnen im Haus des Vaters einen Platz bereit zu machen, ging Jesus Christus nach vollbrachtem Werk als Mensch dorthin zurück. Bald wird Er wiederkommen und alle Glaubenden zu sich nehmen. Das ist der Kernpunkt der christlichen Hoffnung.
Der Sohn Gottes stand im Begriff, zum Vater zurückzukehren. Thomas dachte jedoch nicht an eine Person, sondern an einen physischen Ort. Seine Frage veranlasste den Herrn, weitere Erklärungen zu geben:
- Er ist der Weg zum Vater. Wer an Ihn glaubt, kommt schon jetzt in eine Beziehung zum Vater und wird in der Zukunft im Haus des Vaters wohnen.
- Jesus Christus ist auch die Wahrheit über den Vater, denn Er hat Ihn offenbart. Wer Ihn betrachtet, lernt den Vater kennen.
- Der Sohn Gottes ist das Leben (1. Johannes 5,20). Wer an Ihn glaubt, bekommt ewiges Leben. Dadurch besitzt er die Fähigkeit, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben (Johannes 17,3).
Grössere Werke
Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um Gott, den Vater, zu offenbaren (Johannes 1,14.18). Darum können wir in Ihm den Vater erkennen. Doch es ist kein physisches Sehen, wie Philippus es wünschte, sondern ein Blick des Glaubens, der in Jesus Christus den Vater in allen seinen Eigenschaften erkennt. Das Auge des Glaubens sieht mehr als das leibliche Auge, denn es kann ins Herz des Vaters hineinblicken und dort seine Liebe und Gnade erkennen.
Der Mensch gewordene Sohn Gottes sagte mit Recht: «Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.» Denn zwischen dem Vater und dem Sohn besteht eine vollkommene Einheit und eine absolute Übereinstimmung, so dass der Sohn den Vater völlig offenbaren konnte. Er tat es durch seine Worte und seine Werke. Alles, was Er sagte und tat, zeigte den Vater in seiner Liebe, Gnade, Weisheit und Macht.
Die Verse 12-14 betrafen in erster Linie die Apostel, die nach der Rückkehr des Herrn Jesus zum Vater als seine Vertreter auf der Erde wirkten und zeugten. In seinem Auftrag taten sie Werke von gleicher Art wie Christus und Werke in grösserem Umfang als Er (Apostelgeschichte 3,7; 5,15). Dafür gab es einen Grund: Der Herr befand sich als Mensch beim Vater und war dort die Quelle dieser Wunderwerke (Markus 16,20).
Durch das Gebet zum Vater öffnete sich den Jüngern diese Quelle göttlicher Kraft. Wenn sie sich im Namen des Herrn Jesus, d.h. in der Würde seiner Person, an den Vater wandten, wurde der Sohn zum Segen der Glaubenden und zur Verherrlichung des Vaters tätig.
Liebe und Gehorsam
Nachdem der Herr den Blick der Jünger auf den himmlischen Segen in ihrer Beziehung zum Vater gerichtet hat, spricht Er jetzt ihre Verantwortung an. Sie sollen ihre Liebe zu Ihm durch Gehorsam zeigen.
Zu ihrer Unterstützung wird der Heilige Geist auf die Erde kommen. Er wird nicht nur für eine Zeit, sondern ewig bei ihnen sein. Aber die Welt wird den Geist Gottes nicht sehen, denn Er wird in den Glaubenden wohnen. – Genauso ist es geschehen, als der Heilige Geist am Pfingsttag auf die Erde kam, um in den einzelnen Erlösten und in der Versammlung zu wohnen. Sein Wirken in den Glaubenden bringt ihnen einen grossen Segen: Durch den Geist erfahren sie die Gegenwart des Herrn Jesus (Vers 18) und sehen Ihn als den verherrlichten Menschen im Himmel (Vers 19).
Ab Vers 21 lernen wir, dass der Genuss des christlichen Segens von unserem Gehorsam abhängt:
- Wenn wir die Gebote des Herrn aus dem Wort Gottes in unser Herz aufnehmen und aus Liebe zu Ihm tun, erfahren wir die besondere Liebe des Vaters und des Sohnes. Ausserdem öffnet uns Christus sein Herz und lässt uns mehr von seiner herrlichen Person erkennen.
- Wenn wir das Wort des Herrn halten, indem wir nicht nur seine konkreten Anweisungen befolgen, sondern auch nach seinen Mitteilungen in der Bibel leben, freuen wir uns an der Liebe des Vaters. Ausserdem haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Sie wohnen bei uns, weil wir in unserem Leben mit Ihnen übereinstimmen. Das ist ein Vorgeschmack des Segens, den wir im Haus des Vaters geniessen werden.
Der Heilige Geist als Sachwalter
In Vers 26 stellt der Herr zwei Aufgaben des Heiligen Geistes vor:
- Er wird die Jünger alles lehren, d.h. die ganze christliche Wahrheit erklären (1. Johannes 2,20).
- Der Geist wird sie an alles erinnern, was der Herr ihnen gesagt hat, damit sie von Ihm zeugen können.
In Vers 27 ist zuerst vom Frieden des Gewissens die Rede, den der Herr Jesus als Auferstandener den Seinen als Folge seines Erlösungswerks gebracht hat (Johannes 20,19). Darauf verspricht Er ihnen den Frieden des Herzens, den sie wie Er im Gehorsam zu Gott und in Gemeinschaft mit dem Vater erleben können.
In Vers 28 möchte der Herr das Interesse der Jünger für das wecken, was Ihn persönlich betrifft. Eine selbstlose Liebe freut sich darüber, dass Er bald seinen Leidensweg beenden und zum Vater zurückkehren wird. Ausserdem liegt in seinem Weggehen zum Vater der Schlüssel für den Segen der Glaubenden. Als Folge davon wird der Heilige Geist zu ihnen kommen.
Die grosse Auseinandersetzung zwischen dem Herrn Jesus und dem Satan stand kurz bevor. Am Kreuz würde der Feind seine ganze Macht gegen Christus aufbieten, aber in diesem reinen und sündlosen Menschen keinen Anknüpfungspunkt finden, um einen Sieg davonzutragen. Im Gegenteil! Durch sein Erlösungswerk am Kreuz besiegte der Herr den Teufel und befreite alle Glaubenden aus seiner Macht (Hebräer 2,14.15). Sein Tod war also nicht das Ergebnis der Macht Satans, sondern der höchste Beweis, dass Jesus Christus den Vater liebte und Ihm bis zum Äussersten gehorchte (Vers 31).
Frucht bringen
Mit einem Bild zeigt der Herr den Jüngern ihre Aufgabe während seiner Abwesenheit: Weil sie durch ihr Bekenntnis zu Ihm in einer Beziehung zu Ihm stehen, sollen sie in Verbindung mit Ihm für Gott Frucht bringen.
- Jesus Christus ist der wahre Weinstock. Durch sein Kommen auf die Erde trat Er an die Stelle Israels. Vorher hatte Gott bei diesem Volk Frucht gesucht, aber nur schlechte Beeren gefunden (Jesaja 5,1-7). Der Herr Jesus, der im Gegensatz zu Israel in seinem Leben ununterbrochen Frucht für Gott brachte, ist jetzt für seine Jünger die Quelle jeder Frucht.
- Der Vater ist der Weingärtner, der die Reben am Weinstock pflegt. Fruchtbringende Reben reinigt Er, damit sie mehr Frucht bringen. Reben ohne Frucht nimmt Er weg.
- Alle Menschen, die sich dem Herrn Jesus anschliessen und sich zu Ihm bekennen, sind Reben am Weinstock. Einige von ihnen bringen Frucht für Gott, weil sie eine echte Beziehung zu Christus haben und in täglicher Abhängigkeit von Ihm leben. Andere Reben bringen keine Frucht, weil ihr Bekenntnis zu Christus nicht echt ist. Irgendwann geht auch ihre äussere Beziehung zu Ihm zu Ende. Was bleibt, ist das Feuer des Gerichts.
Wenn wir in beständiger Abhängigkeit vom Herrn Jesus leben und das Wort Gottes seinen prägenden Einfluss auf uns hat, werden unsere Bitten mit Gott übereinstimmen, so dass Er sie erhören kann (Vers 7). Weil wir dadurch Jesus Christus nachahmen, wird der Vater verherrlicht und die Welt erkennen, dass wir Jünger des Herrn Jesus sind (Vers 8).
Bleibt in meiner Liebe!
Wie der Vater den Menschen Jesus Christus in seinem Leben auf der Erde geliebt hat, liebt der Herr jetzt seine Jünger. Doch der Genuss seiner Liebe hängt von unserem Gehorsam ab. Wenn wir seine Gebote halten, wie Er die Gebote seines Vaters gehalten hat, bleiben wir in seiner Liebe. Als gehorsamer Mensch hat Jesus in der Gemeinschaft mit seinem Vater eine tiefe Freude empfunden. Diese Freude erleben wir auch, wenn wir dem Herrn gehorchen und die Gemeinschaft mit Ihm suchen.
Auf dem Weg der Jüngerschaft sind wir nicht allein. Andere Christen folgen dem Herrn Jesus ebenfalls nach. Nun soll die gegenseitige Liebe die Gemeinschaft der Glaubenden kennzeichnen. Das Vorbild und der Massstab dafür ist die Liebe des Herrn zu seinen Jüngern. Drei Jahre lang hat Er für sie gesorgt und ihnen gedient. Doch den grössten Ausdruck seiner Liebe zu ihnen finden wir am Kreuz, als Er sein Leben für seine Freunde gelassen hat.
Gehorsame Jünger sind die Vertrauten des Herrn. Er nennt sie seine Freunde und teilt ihnen alles mit, was Er vom Vater gehört hat. Zwischen einem Knecht und einem Freund besteht ein gewaltiger Unterschied: Dem Knecht gibt man nur so viele Informationen, damit er den Auftrag erfüllen kann. Dem Freund hingegen öffnet man das Herz und teilt ihm alles mit.
Der Herr Jesus hat die Zwölf als seine Jünger auserwählt (Lukas 6,13). Nun sollen sie in seinem Werk tätig sein und Frucht bringen. Der Vater wird ihnen für diese Aufgabe alles Notwendige schenken, damit ihre Frucht bleibe.
Von der Welt gehasst
Es gibt zwei Gründe, warum die Welt die Jünger des Herrn Jesus hasst und anfeindet:
- Weil sie dem verachteten Jesus von Nazareth nachfolgen, der bis heute von der Welt abgelehnt wird.
- Weil es keine innere Übereinstimmung zwischen glaubenden Menschen und der Welt mehr gibt.
Wir brauchen uns also nicht zu wundern, wenn wir in unserem Bekenntnis für Jesus Christus von ungläubigen Menschen Widerstand und Ablehnung erfahren. Auch hier gilt der Grundsatz: «Ein Knecht ist nicht grösser als sein Herr.» Als Zeugen und Jünger des Herrn erfahren wir das Gleiche wie Er: Die meisten Menschen lehnen uns ab, nur einige nehmen das Wort Gottes an.
Die Verse 22-25 sprechen vom Zeugnis, das Jesus in der Welt abgelegt hat. Er kam in Gnade und offenbarte den Menschen durch Worte (Vers 22) und durch Werke (Vers 24) den Vater. Doch die Welt – insbesondere die ungläubigen Juden – lehnte die Gnade Gottes in Christus ab. Für ihre Sünde war sie nun ohne Entschuldigung, denn das Verhalten des Herrn Jesus gab keinen Anlass für ihren Hass. Ihre Feindschaft gegen den Gesandten des Vaters und damit gegen Gott selbst kam aus ihrem bösen Herzen hervor. Das Fazit ist klar: «Die ganze Welt liegt in dem Bösen» (1. Johannes 5,19).
Der Heilige Geist, der vom Vater gesandt auf die Erde gekommen ist, bestätigt den Jüngern, dass Jesus Christus, der von der Welt gehasst und getötet worden ist, im Himmel anerkannt wird. Das gibt ihnen Überzeugungskraft, Ihm nachzufolgen und von seinem Leben auf der Erde zu zeugen.
Der Heilige Geist überführt die Welt
In Kapitel 15 hat der Herr den Jüngern bereits den wahren Charakter der Welt gezeigt, um sie auf ihren Hass und Widerstand vorzubereiten. In Kapitel 16 setzt Er dieses Thema bis Vers 11 fort.
Besonders die religiösen Menschen, die damals durch die ungläubigen Juden repräsentiert wurden, widerstehen der Wahrheit. Sie wollen nicht wahrhaben, dass Gott, der Vater, sich in seinem Sohn Jesus Christus in Gnade offenbart hat. Warum? Weil dadurch ihre religiösen Aktivitäten und ihr geistlicher Hochmut verurteilt werden.
Als der Herr bei seinen Jüngern gewesen ist, hat Er sie vor der Feindschaft der Welt beschützt. Doch bald wird Er sie verlassen. Als Folge davon sind sie direkt mit dem Widerstand der Welt konfrontiert. Darauf sollen sie vorbereitet sein. Doch es ist für die Jünger nützlich, dass der Herr zum Vater zurückkehrt, damit der Geist als Sachwalter zu ihnen kommen kann. Seine Gegenwart ist den Jüngern eine Hilfe, die Welt richtig zu beurteilen. Das Kommen des Geistes Gottes beweist den Jüngern drei Punkte im Blick auf die Welt:
- Er überführt die Welt von Sünde. Sie hat nicht an den Sohn Gottes geglaubt, sondern Ihn und damit auch Gott, den Vater, abgelehnt. Das ist ihre grosse Sünde.
- Er überführt sie von Gerechtigkeit. Jesus Christus, der einzig Gerechte, befindet sich beim Vater. Von der Welt kann man keine Gerechtigkeit erwarten.
- Er überführt sie von Gericht. Als Fürst der Welt ist Satan am Kreuz besiegt worden. Als Folge davon steht auch die Welt unter dem Gerichtsurteil Gottes.
Der Geist leitet in die ganze Wahrheit
Weil die Jünger den Heiligen Geist noch nicht hatten, konnten sie noch nicht alles aufnehmen und verstehen, was Gott ihnen mitteilen wollte.
Als der Geist auf die Erde kam, machte Er die Apostel mit der ganzen Wahrheit bekannt, damit sie diese göttliche Mitteilung mit dem Herzen erfassen konnten. Die Wahrheit ist die Art und Weise, wie Gott alles betrachtet. Sie ist das, was Er von sich selbst und von seinen Gedanken offenbart hat. Die Apostel besassen also Kenntnis von der ganzen Wahrheit und schrieben sie durch den Geist Gottes inspiriert im Neuen Testament nieder.
Der Heilige Geist nimmt auf der Erde eine Stellung der Unterordnung ein. Er redet das, was Er vom Herrn Jesus im Himmel hört:
- Er verkündet das Kommende und richtet so unseren Blick nach vorn! Wir erfahren die göttlichen Pläne über die zukünftige Welt. Der Geist spricht über das Haus des Vaters und über die öffentliche Verherrlichung des Herrn mit den Seinen.
- Er verherrlicht Christus und lenkt so unseren Blick nach oben! Wir sehen Jesus im Himmel mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Der Geist stellt uns alles, was der Herr in seiner Person und in seiner jetzigen Stellung ist, gross vor unsere Herzen.
Der verherrlichte Christus ist der ewige Sohn Gottes. Darum gehört Ihm alles, was der Vater besitzt. Darum ist in «dem Meinen» indirekt auch die Herrlichkeit des Vaters und sein ewiger Ratschluss enthalten.
Ihr werdet mich sehen
Nun lenkt der Herr die Gedanken seiner Jünger auf die bevorstehenden Ereignisse:
- «Eine kleine Zeit, und ihr schaut mich nicht mehr.» Bald würde Jesus am Kreuz sterben und anschliessend in ein Grab gelegt werden. Damit war die Zeit, Ihn als Mensch auf der Erde zu sehen, vorbei (1. Johannes 1,1).
- «Wieder eine kleine Zeit, und ihr werdet mich sehen.» Christus ist nach drei Tagen auferstanden. Die Jünger haben Ihn als Auferstandenen gesehen, aber nur zeitweise. Sie mussten lernen, dass Er jetzt in einer anderen Beziehung zu ihnen stand. Somit ist mit diesem «Sehen» auch der Blick des Glaubens gemeint, der Christus verherrlicht im Himmel sieht (Hebräer 2,9).
Der Tod des Herrn Jesus war für die Jünger ein Grund zur Trauer, weil sie meinten, Ihn dadurch zu verlieren. Die ungläubigen Menschen hingegen freuten sich über seine Kreuzigung. Endlich war die Stimme der Wahrheit verstummt, die sie nicht hören wollten. Doch die Traurigkeit der Jünger verwandelte sich in Freude, als der Herr am Auferstehungstag in ihre Mitte trat (Johannes 20,20). Dieser Wechsel von Traurigkeit zu Freude wird an einem Beispiel deutlich gemacht: Der Geburtsvorgang ist kein Anlass zur Freude, sondern bereitet Schmerzen und Kummer. Wenn jedoch das Baby geboren ist, denkt die Mutter nicht mehr an die Strapazen, sondern freut sich über ihr Kind.
Als der Herr Jesus in den Himmel auffuhr, blieb die Freude der Jünger bestehen (Lukas 24,52). Sie standen jetzt in einer Glaubensbeziehung zu Ihm und sahen Ihn mit den Augen des Herzens.
Der Vater selbst hat euch lieb
Mit dem Ausdruck «an jenem Tag» ist die christliche Zeit gemeint, in der die Glaubenden freien Zugang zu Gott, dem Vater, haben. Im Namen des Herrn Jesus, d.h. in der Annehmlichkeit seiner Person und seines Werks, können sie ihre Bitten direkt an den Vater richten. Er wird diese Gebete im Namen des Herrn erhören, weil sie mit seinem Willen übereinstimmen.
Vor seinem Tod sprach Jesus Christus noch nicht offen vom Vater zu seinen Jüngern. Erst nach seiner Auferstehung teilte Er ihnen durch Maria Magdalene mit: «Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott» (Johannes 20,17). Mit dem Erlösungswerk war die Grundlage geschaffen, dass glaubende Menschen in eine persönliche Beziehung zu Gott als Vater kommen können. Weil sie nun seine Kinder sind, brauchen sie keinen Vermittler, sondern können sich direkt an den Vater wenden, der sie liebt.
In Vers 28 spricht der Herr über seinen Auftrag: In der Fülle der Zeit kam der Sohn Gottes als Mensch in die Welt, um den Vater zu offenbaren. Am Kreuz gab Er sein Leben zur Verherrlichung des Vaters, um dann als Mensch zu seinem Vater zurückzukehren.
Die «Stunde» in Vers 32 ist die Zeit, in der Jesus Christus litt und starb. Die Jünger verliessen Ihn, als es schwierig wurde (Markus 14,50). Aber der Vater blieb bei Ihm. Das war die Quelle seiner Kraft auf seinem schweren Weg nach Golgatha.
In Vers 33 ermutigt der Herr seine Jünger: Trotz äusserer Schwierigkeiten in der Welt können sie den inneren Frieden in der Gemeinschaft mit Ihm geniessen.
Ich habe Dich verherrlicht
In diesem Kapitel spricht der Sohn Gottes zu seinem Vater und bittet für seine Jünger. In den Versen 1-5 geht es um die Person und das Werk des Herrn Jesus. Gedanklich steht Er hinter dem Kreuz, d.h. Er betrachtet das Erlösungswerk als schon vollbracht.
Zuerst bittet Er um seine Verherrlichung als Mensch im Himmel, damit Er von diesem Platz aus den Vater verherrlichen kann. In der Zeit der Gnade möchte Er den Glaubenden vom Himmel her den Vater und dessen Liebe zu ihnen gross machen.
Als Sieger von Golgatha besitzt Jesus Christus die Vollmacht, über alle Menschen zu bestimmen. Zudem schenkt Er allen, die an Ihn glauben, ewiges Leben (Johannes 10,10). Dieses Leben befähigt sie, Gott als Vater zu kennen und sowohl mit Ihm als auch mit dem Sohn Gemeinschaft zu haben.
Vers 4 zeigt uns den zweifachen Grund, warum der Sohn Gottes als Mensch auf die Erde kam:
- Er offenbarte Gott, den Vater, und stellte alle seine Wesenszüge – seine Liebe, seine Heiligkeit usw. – völlig ans Licht. Dadurch verherrlichte Er Ihn.
- Er erfüllte den Auftrag des Vaters. Sein Gehorsam führte Ihn ans Kreuz, wo Er zur Ehre Gottes sein Leben liess und das Erlösungswerk vollbrachte.
Der Sohn Gottes besitzt von Ewigkeit her eine Herrlichkeit: Er wird vom Vater geliebt! Diese Herrlichkeit erbittet Er sich nun als Mensch. Warum? Weil Er sie im Haus des Vaters den Erlösten zeigen will (Vers 24). Glaubende Menschen sollen dort die ewige Liebe des Vaters zum Sohn bewundern und anbeten.
Bewahre sie in deinem Namen
Diese Verse betreffen zuerst die Jünger, aber in einem weiteren Sinn alle Glaubenden der Gnadenzeit.
Der Herr hat seinen Jüngern Gott als Vater offenbart (Vers 6). Sie haben erkannt, dass Jesus Christus der Sohn des Vaters ist und Mitteilungen vom Vater an sie gemacht hat. Im Gegensatz zu den Juden haben sie diese Worte angenommen und geglaubt (Johannes 17,7.8).
Aus der zweiten Hälfte von Vers 6 lernen wir ausserdem folgende Wahrheit: Gott hat in seinem ewigen Ratschluss Menschen zu seinen Kindern auserwählt. Darum gehören sie Ihm. Als sie in der Zeit der Gnade zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, hat der Vater sie der Fürsorge des Sohnes übergeben.
Ab Vers 9 bittet der Herr für die Glaubenden, die Er in der Welt zurücklassen wird. Zuerst gibt Er zwei Gründe dafür an:
- «Sie sind dein.» Weil sie Kinder Gottes sind, hat der Vater ein grosses Interesse an ihnen.
- «Ich bin in ihnen verherrlicht.» Weil der Vater den Sohn liebt, ist es ganz in seinem Sinn, dass der Herr Jesus durch die Seinen verherrlicht wird.
Bis jetzt hat der Herr die Jünger vor den Angriffen Satans und der Welt beschützt. Nun bittet Er: «Heiliger Vater! Bewahre sie in deinem Namen.» Dieser Name drückt göttliche Liebe und göttliche Heiligkeit aus. Beides bewahrt die Glaubenden in der Welt.
In Vers 11 geht es um die Einheit der Apostel, die der Heilige Geist bewirkt hat. Sie haben durch Worte und Wunderwerke einmütig vom Herrn gezeugt.
Heilige sie durch die Wahrheit
In den Versen 14-19 spricht der Herr über das Verhältnis der Glaubenden zur Welt:
- Sie gehören nicht mehr zur Welt, weil der Herr Jesus sie aus diesem gottlosen System herausgenommen und sie in Beziehung zum Vater gebracht hat (Galater 1,4).
- Sie sind in der Welt, d.h. sie halten sich im Alltag unter ungläubigen Menschen auf, die ganz andere Ziele verfolgen als sie.
- Der Vater bewahrt sie vor dem Bösen, das sie umgibt. Sie müssen dem Einfluss der Welt nicht erliegen, weil Er ihre Herzen immer wieder auf seine Liebe richtet.
- Das Wort des Vaters zeigt den Glaubenden den wahren Charakter der Welt. Diese Wahrheit hilft ihnen, getrennt von der Welt zu leben.
- Der Herr sendet seine Jünger mit einem Auftrag in die Welt. Sie sollen von Ihm zeugen und den Menschen sagen: «Lasst euch versöhnen mit Gott!» (2. Korinther 5,20).
- Jesus Christus hat sich für die Seinen geheiligt: Er ist in den Himmel zurückgekehrt, um dort für sie, die noch in der Welt sind, der Anziehungspunkt ihrer Herzen zu sein. Dadurch sondert Er sie von der Welt ab.
Vers 20 macht klar, dass der Herr nicht nur für die Apostel bittet, sondern auch an alle denkt, die durch das Wort der Apostel, d.h. durch das inspirierte Wort Gottes, an Ihn glauben. Sie bilden gemeinsam die Familie Gottes, denn sie alle kennen Gott als ihren Vater. Diese Einheit zeugt, wenn sie sichtbar wird, vom Sohn Gottes, dem Gesandten des Vaters. Durch Ihn streckt Gott den Menschen die Hand der Versöhnung hin. Wer an Ihn glaubt, wird gerettet.
Zukünftige Herrlichkeiten
In den Versen 22-24 geht es um die Zukunft der Erlösten der Gnadenzeit. Sie teilt sich in zwei Bereiche ein:
- So wie der Vater den Herrn Jesus in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen hat, so werden auch die Glaubenden im Himmel verherrlicht. Das ist nötig, damit sie mit Ihm vor der Welt erscheinen und seine Herrlichkeit zeigen können (2. Thessalonicher 1,10). Dann wird ihre Einheit sichtbar werden, weil sie alle den Herrn begleiten werden. Ausserdem wird die Welt an diesem zukünftigen Tag erkennen, dass der Vater einst den Sohn auf die Erde gesandt hat und dass Er die Glaubenden der Gnadenzeit so liebt, wie Er den Menschen Jesus Christus geliebt hat. Das ist der öffentliche Bereich unserer Zukunft.
- Wenn der Herr zur Entrückung kommt, werden die Erlösten ins Haus des Vaters eingehen, wohin Er ihnen vorausgegangen ist (Johannes 14,2.3). Dort werden sie seine Herrlichkeit sehen. Voll Bewunderung werden sie im Mensch gewordenen Sohn Gottes erkennen, wie Er von Ewigkeit her vom Vater geliebt ist. Das ist der verborgene Bereich unserer Zukunft.
Der gerechte Vater unterscheidet zwischen der Welt, die Ihn in seinem Sohn nicht erkannt hat, und den Glaubenden, die an den Sohn Gottes geglaubt haben und dadurch in eine Beziehung zum Vater gekommen sind. Durch den Herrn Jesus haben sie Ihn und seine Liebe zum Sohn kennen gelernt. Zwei Tatsachen machen jetzt und in der Ewigkeit ihre Herzen glücklich: die Liebe des Vaters zum Sohn und das, was Jesus Christus in seiner herrlichen Person ist.
Wen sucht ihr?
Im Johannes-Evangelium zeigt uns der Geist Gottes die Kreuzigung des Herrn Jesus aus einem besonderen Blickwinkel: Er lässt die Herrlichkeit des Sohnes Gottes vor dem Hintergrund des Versagens und der Bosheit der Menschen hervorstrahlen. Deshalb wird weder sein Gebet in Gethsemane noch sein Leiden im Verlassensein von Gott erwähnt.
Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Es ist der Ort der Zurückgezogenheit, der Gemeinschaft und der Privatsphäre. Gerade dort will Judas seinen Meister an die Feinde verraten. Welche Herzenshärte!
Der Sohn Gottes, der alles im Voraus weiss und alles in seiner Hand hält, kommt seinen Häschern zuvor. Er tritt ihnen mit der Frage entgegen: «Wen sucht ihr?» Sein göttliches «Ich bin» wirft sie zu Boden. Damit wird völlig klar, dass keiner Ihn gefangen nehmen kann, wenn Er nicht freiwillig dazu bereit ist.
Weil seine Stunde gekommen ist, am Kreuz das Opfer zu bringen, geht Er nicht weg, sondern fragt zum zweiten Mal: «Wen sucht ihr?» Schützend stellt Er sich als der gute Hirte vor seine Schafe und erklärt: «Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen.»
Als Petrus sein Schwert zieht und Malchus das rechte Ohr abschlägt, muss der Herr ihn zurechtweisen. Der Sohn ist bereit, seinem Vater zu gehorchen und den Kelch der Leiden zu trinken. Darum nimmt Er alles, was die Menschen Ihm antun, aus der Hand Gottes an. Das ist das Geheimnis seiner Ruhe während der Verhaftung, der Gerichtsverhandlungen und der Kreuzigung.
Jesus vor dem Hohenpriester Annas
Am Kreuz musste der Heiland nach göttlichem Plan für Sünder sterben. Auf dem Weg dorthin unterwarf Er sich den Menschen, die in ihrer Feindschaft nur dazu beitrugen, diesen Ratschluss zu erfüllen. Darum liess Er sich binden und gestattete seinen Feinden, Ihn zum Hohenpriester zu führen.
Welche Unordnung herrschte damals im Judentum! Es gab mehrere Hohepriester, die vermutlich abwechslungsweise ihr Amt verrichteten (Lukas 3,2; Apostelgeschichte 4,6). Annas war einer von ihnen. Er scheint ein einflussreicher Mann gewesen zu sein. Bei ihm fand die erste inoffizielle Gerichtssitzung statt. Kajaphas, der amtierende Hohepriester, hatte schon früher den Tod des Herrn Jesus vorgeschlagen (Johannes 11,49-52). Das Urteil stand also schon vor dem Verhör des Gefangenen fest.
Johannes, der Schreiber des Evangeliums, war der andere Jünger, der Petrus in den Hof des Hohenpriesters führte. Er erwies ihm damit keinen guten Dienst, denn er brachte seinen Mitjünger an einen Ort, wo er besonderen Versuchungen ausgesetzt war. Der Aufenthalt dort stellte für Johannes selbst keinen Stolperstein dar, brachte aber seinen Freund zu Fall.
Petrus wurde schon an der Tür über seine Beziehung zu Jesus Christus angesprochen. Wenn er sich zu seinem Herrn bekannt hätte, wäre er vielleicht gar nicht hineingekommen. Doch er verleugnete Ihn vor einer Magd. Weil es kalt war, wärmte sich Petrus mit den Dienern am Kohlenfeuer der Welt. Wie sollte er dort die Kraft haben, sich auf die Seite des Herrn Jesus zu stellen?
Das Verhör des Hohenpriesters
Der Hohepriester Annas fragt Jesus nach seiner Lehre und seinen Jüngern, um in der Antwort einen Grund zur Verurteilung zu finden. Aber der Herr anerkennt ihn nicht als Hohenpriester und gibt ihm hier keine Gelegenheit, seine Aussagen zu benutzen, um Ihn schuldig zu sprechen. Da schlägt Ihn ein Diener ins Gesicht. Dieser Schlag ist
- gesetzwidrig, weil der Angeklagte nicht verurteilt ist,
- ungerecht, weil Jesus keine Schuld trifft,
- unverschämt, weil dieser Mann eigenmächtig handelt,
- feige, weil der Heiland gebunden ist.
Noch schlimmer ist jedoch, dass der Hohepriester diese gewalttätige Handlung einfach durchgehen lässt. Geduldig erträgt der Herr Jesus diese Misshandlung (Jesaja 50,6). Gleichzeitig hält Er dem, der Ihn geschlagen hat, seine Ungerechtigkeit vor. Mit welcher Würde und ruhiger Überlegenheit steht der Sohn Gottes vor seinen Anklägern!
In den Versen 25-27 wird Petrus noch zweimal auf seine Beziehung zu Jesus Christus angesprochen. Dass ihn gerade ein Verwandter von Malchus danach fragt, ist ein Meisterstück des Feindes. Wie kann sich Petrus vor diesem Mann zum Herrn Jesus bekennen? Er hat keine Kraft dazu, obwohl er seinen Meister aufrichtig liebt.
Wenn Gott uns in seinem Wort die Sünden der Glaubenden mitteilt, will Er uns zeigen, wozu auch wir fähig sind. Wir sollen von Petrus lernen, uns nicht zu überschätzen, sondern demütig in der Nähe des Herrn zu bleiben. Er kann uns vor einem Fehltritt bewahren.
Jesus vor Pilatus
Für den Hohen Rat der Juden (Synedrium) steht das Urteil fest: Jesus Christus muss sterben. Doch sie dürfen Ihn nicht selbst hinrichten, weil sie unter der römischen Besatzungsmacht stehen. Deshalb führen sie Ihn zu Pilatus und fordern von ihm das Todesurteil.
Obwohl sie im Begriff stehen, den Sohn Gottes zu töten und damit die grösste Sünde zu begehen, wollen sie nicht zu Pilatus hineingehen, um sich äusserlich nicht zu verunreinigen. Welche Heuchelei! Weil sie keinen richtigen Anklagegrund vorbringen können, behaupten sie einfach, Jesus sei ein Übeltäter, der die Todesstrafe verdiene. Welche Ungerechtigkeit!
Als Pilatus fragt: «Bist du der König der Juden?», prüft ihn der Herr mit einer Gegenfrage: Will der römische Richter wirklich die Wahrheit wissen? Erst auf die zweite Frage: «Was hast du getan?», legt Jesus Christus das gute Bekenntnis vor Pilatus ab:
- Er ist ein König, aber sein Reich ist himmlisch und deshalb nur für den Glauben eine Realität.
- Als der Mensch gewordene Sohn Gottes zeugt Er auf der Erde von der Wahrheit.
Der römische Richter will sich nicht öffentlich auf die Seite der Wahrheit stellen. Darum sucht er einen anderen Weg, um den unschuldigen Angeklagten freizubekommen. Zuerst benutzt er die Gewohnheit, am Passah einen Gefangenen freizugeben. Er lässt die Juden zwischen Jesus, dem Reinen und Sündlosen, und Barabbas, einem Mörder und Räuber, wählen. Es ist eine Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Sie entscheiden sich für den Bösen und die Finsternis.
Siehe, der Mensch!
Weil der erste Versuch, Jesus freizulassen, gescheitert ist, schlägt Pilatus nun einen anderen Weg ein. Er überlässt den Angeklagten seinen Soldaten, die Ihn grausam behandeln und mit beissendem Spott verletzen. Es erfüllt sich Jesaja 52,14: «Wie sich viele über dich entsetzt haben – so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt, mehr als der Menschenkinder.» In diesem Zustand stellt der Richter den Herrn Jesus vor das Volk.
«Siehe, der Mensch!» Vor den Juden steht der wahre, sündlose Mensch Jesus Christus, der die Leiden zutiefst empfindet. Wie hat Ihn die Geisselung und der Hohn der römischen Soldaten geschmerzt! Wie leidet Er in seiner Seele, als Ihm von der jüdischen Volksmenge nur Hass und Ablehnung entgegenschlägt!
Vermutlich hofft Pilatus, dass der Anblick des misshandelten Angeklagten das Mitleid der Zuschauer erregt und sie sich mit der Strafe der Geisselung begnügen. Vielleicht erwartet er auch, dass die Juden über diese Behandlung eines ihrer Volksgenossen empört reagieren und seine Freilassung fordern. Doch seine Rechnung geht nicht auf. Die Führer des Volkes Israel sind gegenüber dem leidenden Christus völlig erbarmungslos. In ihrem Hass wollen sie unter keinen Umständen, dass Er freikommt.
Obwohl der Richter dreimal die Unschuld des Herrn Jesus vor den Juden bezeugt hat (Johannes 18,38; 19,4.6), verlangen sie seinen Tod. Sie begründen ihre Forderung mit der Tatsache, dass Er sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet.
Kreuzige Ihn!
Auf die neugierige Frage des Richters: «Woher bist du?», gibt der Herr Jesus keine Antwort. Nie befriedigt Er die Neugier, beantwortet jedoch immer den Glauben. Pilatus ist in seinem Stolz gekränkt. So stellt er dem Angeklagten seine Macht vor, Ihn zum Tod verurteilen oder freilassen zu können. Da erinnert ihn Jesus an die höchste Autorität: Nur wenn Gott es will, kann der Mensch etwas gegen Christus tun. Nach dem göttlichen Plan muss der Heiland am Kreuz von Golgatha sterben. Darum besitzt Pilatus die Gewalt, Ihn zu verurteilen.
Obwohl Judas, die Juden, Herodes und Pilatus nur das tun können, was nach Gottes Ratschluss vorgesehen ist, sind sie für das Böse, das sie Jesus Christus zufügen, voll verantwortlich. Das Mass der Schuld ist aber nicht für alle gleich. Je besser jemand den Heiland kennt, umso grösser ist seine Verantwortung.
In Vers 12 versucht Pilatus nochmals den Angeklagten freizulassen. Doch die Juden stellen ihm die möglichen Folgen einer solchen Entscheidung vor: «Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers.» So setzen sie den römischen Richter unter Druck, damit er endlich nach ihrem Willen entscheidet.
Auf die spöttische Frage des Richters: «Euren König soll ich kreuzigen?», sagen sich die Juden öffentlich vom Messias los. Da sich ein Aufruhr unter den Juden anbahnt, gibt Pilatus aus Menschenfurcht seinen Widerstand gegen die ungerechte Anklage auf. Er entscheidet nicht nach der Wahrheit, sondern durch politische Erwägungen. So macht auch er sich am Tod des Sohnes Gottes schuldig.
Jesus geht nach Golgatha
In diesem Evangelium ist Jesus Christus der Handelnde:
- Im Garten Gethsemane geht Er seinen Häschern entgegen (Johannes 18,4).
- Später tritt Er mit einer Dornenkrone gekrönt vor die Juden (Vers 5).
- Nun trägt Er sein Kreuz nach Golgatha hinaus (Vers 17).
Es werden noch zwei andere mit Ihm gekreuzigt. Aber Jesus hängt in der Mitte. Er ist sowohl der Mittelpunkt der menschlichen Verachtung als auch das Zentrum der göttlichen Ratschlüsse. Am Kreuz lässt Er sein Leben zur Verherrlichung Gottes, damit alle seine Pläne erfüllt werden.
Pilatus lässt über dem Kreuz eine Aufschrift anbringen, weil er die Juden ärgern will. Gott benutzt sie, um ein klares Zeugnis über seinen Sohn abzulegen: Jesus ist der verachtete Nazaräer und gleichzeitig der verheissene Messias. Viele lesen diesen Text, denn er ist in den wichtigsten Sprachen der damaligen Zeit verfasst.
Welche Erniedrigung für den Herrn Jesus, dass die Soldaten noch zu seinen Lebzeiten über seine Kleider verfügen! Sie fallen über das wenige her, was Er als Mensch auf der Erde besitzt. Dadurch erfüllen sie – ohne es zu wissen – eine Prophezeiung des Alten Testaments. Das Untergewand, das ohne Naht ist, spricht symbolisch von seinem Verhalten vor den Menschen. Er hat sich jederzeit und in jeder Situation untadelig benommen. Seine Lebensführung ist aus einem Guss gewesen, alles hat miteinander übereingestimmt.
Es ist vollbracht!
Die Hingabe der gläubigen Frauen zeigt sich in einer beharrlichen Liebe zu Jesus Christus. Deshalb stehen sie jetzt bei seinem Kreuz.
Bevor der Heiland stirbt, sorgt Er noch für seine Mutter, die vermutlich Witwe geworden ist. Johannes, der sich gern in der Nähe seines Meisters aufgehalten hat, ist geeignet, Maria aufzunehmen und sich um sie zu kümmern. Jesus spricht zu ihr: «Siehe, dein Sohn.» Seinem Jünger erklärt Er: «Siehe, deine Mutter.» Damit stellt Er die beiden in eine familiäre Beziehung zueinander. Es bewegt unser Herz, dass der Herr in seinen schweren Stunden am Kreuz an die Sorgen seiner Mutter denkt und ihr seine menschliche Zuneigung zeigt.
«Mich dürstet!» Diese kurze Aussage lässt uns einerseits ein wenig erahnen, wie der Heiland am Kreuz physisch Durst gelitten hat. Anderseits spricht dieser Durst von seinem Verlangen nach der Errettung sündiger Menschen – als Frucht seiner Leiden und seines Todes.
«Es ist vollbracht!» Das kann nur Gott sagen. Kein Diener des Herrn erfüllt alles, was Gott ihm aufträgt. Nur der Sohn Gottes hat den Auftrag seines Vaters vollständig ausgeführt. Er hat das grosse Erlösungswerk vollbracht. Welche Heilssicherheit gibt dieser Ausspruch des Heilands jedem Glaubenden!
«Er neigte das Haupt und übergab den Geist.» Das ist eine göttliche Handlung, denn kein Mensch kann das tun. Der Mensch gewordene Sohn Gottes lässt sein Leben in göttlicher Kraft (Johannes 10,18). Das gehört zu seinem Werk, das Er zur Verherrlichung seines Vaters und zu unserer Errettung erfüllen muss.
Blut und Wasser
Nochmals zeigt sich die Scheinheiligkeit der Juden. Sie wollen nicht gegen das Gesetz verstossen (5. Mose 21,23). Deshalb bitten sie Pilatus, noch am gleichen Tag die Körper vom Kreuz zu nehmen.
Um den Tod herbeizuführen, brechen die Soldaten den beiden gekreuzigten Verbrechern die Beine. Jesus ist schon gestorben – aber nicht an den Folgen der Kreuzigung. Er hat sein Leben selbst gelassen. Da durchbohrt ein Soldat seine Seite mit einem Speer, um ganz sicher zu sein, dass Er tot ist. Das ist die letzte böse Tat, die sündige Menschen dem Heiland antun. Gleichzeitig erfüllen sich dadurch zwei Aussagen des Alten Testaments (Johannes 19,36.37).
Aus der Seite des Erlösers kommt Blut und Wasser heraus. Damit wird nicht nur sein Tod bestätigt, sondern auch die Auswirkungen seines Sterbens gezeigt. Der Herr Jesus ist nicht als Märtyrer gestorben. Nein, sein Tod ist ein Opfer mit herrlichen Ergebnissen:
- Sein Blut hat vor Gott Sühnung getan. Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz Gott im Blick auf die Sünde vollkommen verherrlicht. Er hat auch unsere Sünden gesühnt (1. Johannes 2,2; 4,10).
- Das Wasser zeigt uns, dass der Tod des Herrn Jesus die Grundlage der Neugeburt bildet. Gott bewirkt dieses einmalige Werk der Reinigung in jedem, der an den Erlöser glaubt (Johannes 3,5).
Johannes hat die Handlung des Soldaten miterlebt. Darum kann er sie als Augenzeuge bestätigen. Ausserdem weiss er, welche geistliche Bedeutung das Blut und das Wasser haben (1. Johannes 5,6).
Jesus wird begraben
Gott hat zwei gläubige Männer bereit, die in der Lage sind, seinem Sohn ein würdiges Begräbnis zu machen:
- Joseph von Arimathia ist ein reicher Mann und ein angesehener Ratsherr. Er bittet den römischen Statthalter, dass er den Körper des Herrn Jesus vom Kreuz abnehmen und begraben dürfe. Damit bekennt er, der bis jetzt aus Furcht vor den Juden ein verborgener Jünger gewesen ist, sich offen zum verachteten Nazaräer. Er legt den Herrn in eine neue Gruft und erweist Ihm dadurch eine besondere Ehre.
- Nikodemus ist einst in der Nacht zu Jesus gekommen und ist von Ihm über die Neugeburt belehrt worden (Johannes 3,1-21). Später ist er ein wenig für Christus eingetreten (Johannes 7,50). Doch jetzt stellt er sich öffentlich auf seine Seite und beweist Ihm seine Wertschätzung. Er bringt eine wertvolle Salbenmischung mit, um den Körper des Gestorbenen einzubalsamieren.
Bei der Grablegung des Herrn Jesus erfüllten sich zwei Worte aus dem Alten Testament:
- «Man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt; aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod» (Jesaja 53,9). Die Römer hätten Jesus im Massengrab der anderen Gekreuzigten beigesetzt. Aber Gott sorgte dafür, dass Er bei einem reichen Mann würdig begraben wurde.
- «Meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe» (Psalm 16,10). Der Herr sah die Verwesung nicht, denn Er kam in ein Grab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Zudem ist Er nach drei Tagen auferstanden.
Das leere Grab
Jesus Christus ist am ersten Tag der Woche, d.h. am Sonntag, auferstanden. Damit wird ein markanter Wechsel angedeutet. Die Juden hielten den Sabbat. Dieser Tag steht für den Grundsatz des Gesetzes: Der Mensch muss zuerst wirken, damit er Gottes Segen bekommt. Für die Christen ist der Sonntag der besondere Tag. Sie leben nach dem Grundsatz der Gnade: Gott schenkt ihnen zuerst Segen, damit sie für Ihn wirken können.
Aus Markus 16,2 wissen wir, dass Maria Magdalene mit anderen Frauen zum Grab ging, um den Körper des Herrn Jesus zu salben. Hier wird nur sie erwähnt, weil der Geist Gottes ihre besondere Liebe zum Heiland zeigen möchte. Sie kam als Erste zur Gruft, weil es sie mit allen Fasern ihres Herzens zu Christus zog. Als sie sah, dass das Grab offen stand, meinte sie, jemand habe ihren Herrn weggenommen. Sofort musste sie Petrus und Johannes erzählen, dass der Stein von der Gruft weggewälzt sei. Da liefen die beiden Jünger zum Grab ihres Meisters:
- Johannes war schneller, weil ihn die Liebe des Heilands zog (Hohelied 1,4).
- Petrus lief langsamer. Er hatte seinen Herrn verleugnet. Das belastete sein Gewissen.
Das leere Grab und die ordentlich zusammengelegten Tücher bezeugten, dass Jesus Christus in würdiger Ruhe auferstanden war. Johannes sah die Beweise der Auferstehung und glaubte verstandesmässig. Doch dieser Glaube wirkte sich nicht auf sein Herz und sein Leben aus. Er ging wieder heim, weil er nicht erfasste, was die Auferstehung des Herrn Jesus für ihn bedeutete.
Der Herr begegnet Maria Magdalene
Maria Magdalene fehlt das Verständnis für die Auferstehung ihres Herrn. Aber sie liebt Ihn und kann nicht ohne Ihn leben. Darum bleibt sie beim Grab und weint. Auf einmal sieht sie zwei Engel in der Gruft sitzen, die sie fragen: «Frau, warum weinst du?» Ihre Antwort ist kurz und klar: «Weil sie meinen Herrn weggenommen haben.» Diese Worte offenbaren sowohl ihre Not als auch ihre Hingabe an Ihn.
Dann wendet sie sich zurück, d.h. sie dreht nur leicht ihren Kopf. Darum erkennt sie Jesus noch nicht, als Er plötzlich vor ihr steht. Der Heiland stellt ihr zwei Fragen: «Frau, warum weinst du? Wen suchst du?» Damit unterscheidet Er sich von den Engeln. Die himmlischen Geschöpfe können nur ihre Tränen sehen. Aber der Sohn Gottes sieht in ihr Herz und weiss, dass sie ihren Herrn sucht. Maria antwortet: «Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen.» Diese Worte offenbaren nicht nur ihre mangelnde Erkenntnis, sondern zeigen auch, was der Herr Jesus für sie bedeutet.
Nun nennt der gute Hirte sein Schaf beim Namen: «Maria!» Da erkennt sie seine Stimme und wendet sich um. Sie muss innerlich voll umdenken, denn sie hat ihren Herrn nicht unter den Lebenden, sondern unter den Toten gesucht.
Vers 17 spricht von den neuen Beziehungen, in denen die Glaubenden nun auf der Grundlage des Erlösungswerks stehen: Der Herr nennt sie seine Brüder, weil sie zur Familie Gottes gehören. Darum ist sein Vater auch ihr Vater und sein Gott auch ihr Gott.
Jesus steht in der Mitte der Jünger
Diese Begegnung des Herrn Jesus mit seinen Jüngern am Auferstehungstag lässt sich gut auf das Zusammenkommen als Versammlung anwenden:
- Das Zusammentreffen fand am ersten Tag der Woche statt. – An diesem Tag versammeln wir uns, um das Brot zu brechen und an unseren Erlöser zu denken (Apostelgeschichte 20,7).
- Die Jünger hatten die Tür aus Furcht vor den Juden verschlossen. – Genauso ist heute die Absonderung von der religiösen Welt eine Voraussetzung, damit wir im Namen des Herrn Jesus zusammenkommen können.
- Jesus kam und stand in der Mitte der Jünger. – Wenn wir in seinem Namen versammelt sind, ist Er in unserer Mitte gegenwärtig (Matthäus 18,20).
- Nach dem Gruss «Friede euch!» zeigte der Herr ihnen seine Hände und seine Seite. – In der Zusammenkunft zum Brotbrechen denken wir an seine Leiden, an seinen Tod und an die Ergebnisse seines Erlösungswerks.
- Jesus sandte seine Jünger in die Welt, damit sie von Ihm zeugten. – Auch wir haben den Auftrag, nachdem wir Segen und Frieden in der Gegenwart des Herrn Jesus genossen haben, in die Welt hinauszugehen, um den Menschen von Ihm zu erzählen.
- Der Herr hauchte in die Jünger und sprach: «Empfangt den Heiligen Geist!» – Auf uns übertragen bedeutet dies, dass in den Versammlungsstunden alles unter der Leitung des Geistes Gottes stehen soll.
- Vers 23 deutet die Autorität der örtlichen Versammlung an, in die Gemeinschaft am Tisch des Herrn aufzunehmen oder davon auszuschliessen (Matthäus 18,18).
Mein Herr und mein Gott!
Thomas ist nicht dabei gewesen, als Jesus Christus am Auferstehungstag den Seinen erschienen ist. Die Jünger erzählen ihm nachher, dass sie den Herrn gesehen haben. Seine negative Reaktion auf diese Mitteilung lässt uns vermuten, dass er ohne stichhaltigen Grund weggeblieben ist. Deshalb fasst er den Hinweis seiner Mitjünger als Ermahnung auf und beteuert seinen Unglauben.
Trotz seiner ungläubigen Worte ist Thomas eine Woche später anwesend, als Jesus Christus den Seinen wieder erscheint. Der Herr spricht ihn direkt an und fordert ihn auf: «Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite.» Dadurch wird nicht nur sein Kleinglaube beseitigt. Er bekommt auch einen tiefen Eindruck davon, dass der Heiland für ihn persönlich gelitten hat und Gott ihm trotz seines Kleinglaubens die Ergebnisse des Erlösungswerks anrechnet.
Thomas bekennt Jesus als seinen Herrn, dem er von jetzt an glauben und gehorchen will. Er bezeugt Ihn auch als seinen Gott, mit dem er in praktischer Gemeinschaft zu leben wünscht. – Prophetisch spricht Thomas von den Gläubigen des Volkes Israel in der Zukunft. Sie werden erst glauben, wenn Jesus Christus sichtbar kommen und ihnen seine Wundmale zeigen wird. Dann werden sie Ihn als ihren Herrn und ihren Gott anerkennen (Offenbarung 1,7).
Die Verse 30 und 31 geben den doppelten Grund an, warum Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Erstens sollen wir dadurch an den Sohn Gottes glauben und zweitens durch diesen Glauben ewiges Leben bekommen.
Der Fischfang
Dieser Abschnitt hat einerseits eine prophetische Bedeutung: Im Tausendjährigen Reich werden auch Menschen aus den Nationen einen Platz haben. Durch den Dienst der gläubigen Juden – dargestellt durch den Fischfang – werden sie zum Glauben an Gott kommen und als Folge davon ins Reich eingehen.
Anderseits enthält diese Geschichte manche Belehrung und Ermutigung für unser Glaubensleben.
Sieben Jünger fahren zum Fischen hinaus. Petrus ergreift die Initiative, die anderen folgen ihm. In jener Nacht fangen sie nichts. Ihr Einsatz bleibt ohne Ergebnis. Ist es nicht entmutigend, wenn die berufliche Arbeit oder der Dienst im Evangelium erfolglos sind?
Schon steht Jesus am Ufer. Seine Anwesenheit verändert die Situation. Sie hören seine Hirtenstimme, gehorchen seinem Wort und machen einen grossen Fischfang. Da erklärt Johannes: «Es ist der Herr.» Er erkennt nicht nur seinen Meister, sondern schreibt Ihm auch den Erfolg zu. Petrus kleidet sich an und springt in den See. Diese beiden Handlungen bezeugen seine Ehrfurcht vor dem Herrn und seinen Wunsch, möglichst schnell bei Ihm zu sein.
An Land ist ein Kohlenfeuer angelegt. Fisch und Brot liegen darauf. Das ist eine schöne Illustration von dem, was die Glaubenden beim Herrn Jesus vorfinden: Wärme, Geborgenheit und Nahrung! Der Herr fordert seine Jünger auf: «Kommt her, frühstückt!» Er hat Nahrung für die Seinen bereit: Brot und Fisch! Das Brot spricht von der Lebenskraft und der Fisch von der Lebensfreude, die Er ihnen durch sein Wort geben möchte.
Petrus wird öffentlich wiederhergestellt
Petrus hat seinen Herrn verleugnet. Der liebevolle Blick von Jesus Christus hat ihn sofort zur Einsicht und Buße seiner Sünde geführt. Nach der Auferstehung ist ihm der Herr persönlich begegnet (Lukas 24,34). Das Verhalten von Petrus vor und nach diesem Gespräch lässt erkennen, dass der Heiland ihm da vergeben hat. Nun muss er noch lernen, dass Selbstvertrauen und fehlende Demut die Ursache seines Falls gewesen sind. Der Herr will ihn davon reinigen (1. Johannes 1,9).
In seiner Gnade stellt Er seinen Jünger öffentlich wieder her und vertraut ihm seine Herde an. Er geht in drei Schritten vor:
- «Liebst du mich mehr als diese?» Damit demütigt der Herr ihn vor seinen Mitjüngern. Petrus nimmt diese Demütigung an, bestätigt aber seine Liebe: «Ja, Herr, du weisst, dass ich dich lieb habe.» Darauf erklärt der gute Hirte: «Weide meine Lämmer!»
- «Liebst du mich?» Jetzt prüft der Herr die Qualität seiner Liebe. Er fragt gleichsam: Ist deine Liebe echt? Petrus beugt sich mit beschämtem Herzen unter diese zweite Frage und erwidert: «Ja, Herr, du weisst, dass ich dich lieb habe.» Nun gibt ihm Christus den Auftrag: «Hüte meine Schafe!»
- «Hast du mich lieb?» Der Heiland fragt eigentlich: Hast du mich wirklich lieb, wie du sagst? Traurig antwortet Petrus: «Herr, du weisst alles; du erkennst, dass ich dich lieb habe.» In seinem Herzen gibt es vieles, was nicht gut ist. Dennoch ist er überzeugt, dass der Sohn Gottes daneben auch seine Liebe sieht. Wieder bekommt er eine Aufgabe: «Weide meine Schafe!»
Petrus und Johannes
In den Versen 15-19 hat der Herr Jesus seinen Jünger Petrus über dessen weiteren Weg in der Nachfolge und im Dienst informiert. Er hat ihm angedeutet, dass er Gott mit dem Märtyrertod verherrlichen wird.
Nun möchte Petrus auch den Weg von Johannes kennen, der die Liebe und Gemeinschaft des Herrn Jesus besonders genossen hat. Seine Frage drückt weder Neid noch Rivalität aus. Sie zeigt vielmehr sein echtes Interesse an seinem Mitjünger. Die Antwort des Herrn besteht aus drei Teilen:
- «Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme …» Es geht hier nicht um Johannes als Person, sondern um seinen Dienst. Im Gegensatz zu Petrus, dessen Aufgabe an den Menschen aus dem Judentum mit seinem Tod zu Ende ging, ist der Dienst von Johannes ein zeitloser. Das wird aus seinen Bibelbüchern klar.
- «… was geht es dich an?» Nachfolge und Dienst sind in erster Linie eine persönliche Sache zwischen dem Glaubenden und seinem Herrn. Jeder soll darin für sich selbst den Weg erkennen und ihn mit der Hilfe Gottes gehen.
- «Folge du mir nach!» Wie Petrus stehen wir alle in Gefahr, uns durch das, was um uns her vor sich geht, von einer konsequenten Nachfolge abhalten zu lassen. Darum gilt dieser Appell auch uns.
Am Ende des Evangeliums gibt Johannes als treuer Zeuge seine Unterschrift zu dem, was er unter der Leitung des Geistes niedergeschrieben hat. Er ist überzeugt, dass der Sohn Gottes, der als Mensch auf der Erde gelebt und gewirkt hat, eine unergründliche Person ist.
Einleitung
Mit Kapitel 10 beginnt der zweite Teil der Sprüche. Im Gegensatz zum ersten Teil besteht in den folgenden Kapiteln meistens kein offensichtlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Sprüchen. Trotzdem ist es das Wort Gottes, das Er durch seinen Geist inspiriert hat.
Gott zeigt uns mit den einzelnen Sprüchen, wie wir uns als Gläubige verhalten sollen. Er spricht viele möglichen Lebenssituationen an und stellt uns seine Gedanken dazu vor. Wenn wir seine Hinweise beherzigen, werden wir auf dem Glaubensweg bewahrt und in der Gottesfurcht gestärkt. Und vergessen wir nicht: Die Sprüche zeigen, dass jeder das erntet, was er gesät hat.
Buchtipp: Leben in Weisheit
Wandel und Worte
Vers 3 erinnert daran, dass der Herr für die Seinen besorgt ist. Gleichzeitig aber fordert Er uns auf, bei unserer Berufsarbeit fleissig zu sein (Sprüche 10,4.5). Wer träge und faul ist, kann nicht mit dem Segen Gottes rechnen.
In den Versen 6 und 7 wird der Gerechte und sein Teil dem Gottlosen und seinem Los gegenübergestellt. Der Gerechte ist der gottesfürchtige Gläubige.
In Vers 8 geht es um unser Herz, das die Gebote annehmen soll. Sie umfassen alles, was Gott in seinem Wort sagt. Dann werden die Füsse auf dem rechten Weg bleiben (Vers 9).
In den Versen 10-14 geht es um den Mund, um das, was wir reden. Ist er wirklich eine Quelle des Lebens? Wird auf unseren Lippen göttliche Weisheit gefunden? Der Herr möge uns helfen, dies zu verwirklichen, und uns vor unnützen Worten bewahren.
Mit oder ohne Gott leben
Nur wenn wir auf den Herrn und sein Wort hören, bleiben unsere Füsse auf dem rechten Weg. Wir wollen seine Unterweisung beachten und eine Korrektur, die Er für nötig findet, annehmen (Vers 17).
Es fällt auf, wie viele Verse von dem handeln, was wir reden und wie wir etwas sagen (Sprüche 10,19.20.21.31.32). Worte können viel Unheil anrichten, besonders dann, wenn wir reden, ohne dabei zu überlegen, was wir gerade aussprechen. Worte können aber auch sehr wohltuend, ja, helfend wirken. «Die Lippen des Gerechten weiden viele.» Mit der Hilfe des Herrn dürfen wir uns Gedanken machen, wie wir mit unseren Worten anderen eine Freude bereiten können (Vers 32).
Wie wichtig ist Vers 22 für jeden, der dem Herrn dienen möchte! Seinen Jüngern sagte der Meister einst: «Ausser mir könnt ihr nichts tun» (Johannes 15,5). Hier lernen wir, dass unsere Anstrengung zu nichts führt, wenn Er nicht seinen Segen schenkt. So wollen wir demütig nach dem Willen des Herrn fragen und ihn dann mit seiner Hilfe tun.
Die Furcht des Herrn ist das Schlüsselwort dieses Buches. Viele Zusagen hängen davon ab. In Vers 27 geht es um eine Verheissung für den Israeliten, dessen Segnung irdischer Art war. Gottesfurcht führt zu einem langen Leben. Und wir als Gläubige der Gnadenzeit? Die Verse 27 und 31 lassen uns an 1. Johannes 2,17 denken: «Die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.»
Guter Umgang mit Besitz
Wir verstehen gut, dass dem Herrn, der ein Gott der Treue und ohne Trug ist, jeder Betrug ein Gräuel ist. Hingegen werden wir sein Wohlgefallen finden, wenn wir in unseren Geschäften ehrlich sind (Vers 1).
Wenn in den Versen 4-6 von Gerechtigkeit die Rede ist, dann geht es um unser Verhalten als Gläubige. Es soll recht vor Gott sein und seine Anerkennung finden.
Der ungläubige Mensch hat keine Perspektive über den Tod hinaus. Wenn er stirbt, wird seine Hoffnung zunichte, er aber existiert weiter und wird ins Gericht Gottes kommen (Vers 7; Hebräer 9,27).
Vers 8 erinnert an Daniel, der unversehrt aus der Löwengrube herausgeholt wurde, weil er unschuldig war. Seine Feinde aber wurden von den Bestien zerrissen (Daniel 6,24.25). Bei Vers 10 können wir an Mordokai und Haman im Buch Esther denken. In Esther 8,15 heisst es dort, dass die Stadt Susan nach dem Tod Hamans und der Erhöhung Mordokais jauchzte und fröhlich war.
Nicht jedem fällt es gleich schwer, sich im Reden zurückzuhalten. Wer aber gern und leicht plaudert, kann unversehens zum Ausplauderer eines Geheimnisses mit unangenehmen Folgen werden (Vers 13). Lasst uns den Herrn bitten, dass Er uns hilft, dann zu schweigen, wenn es nötig ist, und das für uns zu behalten, was nicht an die Öffentlichkeit gehört.
In den Sprüchen werden wir mehrmals davor gewarnt, für einen anderen Bürge zu werden. Keiner weiss, was die Zukunft bringt. Versprechen wir deshalb nichts, was wir unter Umständen nicht einhalten können.
Gewinn oder Verlust
Heute bereichern sich viele auf unrechtmässige Weise. Vers 18 bezeichnet dies als trügerischen Gewinn. Im Gegensatz dazu steht der wahre Lohn, der für den ist, der Gerechtigkeit sät. Dieser Lohn kann nicht in einer Geldwährung ausgedrückt werden. Er besteht in dem, was der Herr uns einmal schenken will, wenn Er unser Tun in seinem Licht beurteilt (Offenbarung 22,12). – Der Herr wertet nicht nur unser Verhalten. Er sieht auch auf das Herz, den Ursprung unseres Handelns (Vers 20).
Wir leben in einer Zeit, in der Gott die Regierung zur Bestrafung des Bösen eingesetzt hat (Römer 13,4). Weil die Menschen sich aber immer mehr vom Massstab Gottes über Gut und Böse entfernen, bleibt vieles ungestraft. Doch nicht für immer. Kein Ungläubiger wird dem göttlichen Endgericht entrinnen können. Aber alle, die an den Herrn Jesus glauben, der die Strafe für ihre Sünden auf sich genommen hat, werden entkommen.
Die Verse 24-26 reden vom freiwilligen Geben. In 2. Korinther 8 und 9 spricht der Apostel Paulus dieses Thema an. In Anlehnung an unseren Vers 24 heisst es dort: «Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten.» Es folgt noch ein wichtiger Nachsatz: «Einen fröhlichen Geber liebt Gott» (2. Korinther 9,6.7).
Das Vertrauen auf materiellen Reichtum führt oft zu bitteren Erfahrungen (Vers 28). Besser ist es, seinen Reichtum auf Gott gemässe Weise zu verwalten und zu verwenden (1. Timotheus 6,17-19).
Gerecht oder gottlos leben
Es ist gut, daran zu denken, dass es in den Sprüchen weder um Erlösung noch um Versöhnung geht. Der Zustand des Menschen vor Gott wird als gegeben angenommen. Es gibt Gottlose, die im Unglauben ohne Gott leben. Die Gerechten sind die gottesfürchtigen Gläubigen, und die Narren oder Toren lassen sich weder zurechtweisen noch belehren. – Als gläubige Menschen sind wir jedoch nicht vollkommen. Deshalb haben wir Unterweisung nötig, um geistlich zu wachsen. Manchmal muss der Herr uns auch erziehen. Wie gut, wenn wir seiner Erziehung nicht ausweichen (Vers 1).
Manche dieser Verse zeigen, dass das Leben eines Ungläubigen niemals gut enden kann (Sprüche 12,3a.7a). Vers 7 erinnert an den törichten und den klugen Mann in Matthäus 7,24-27. Der erste baute sein Haus auf Sand, und es stürzte in den Stürmen ein. Der andere gründete es auf den Felsen. Es hielt den Naturgewalten stand.
Demut und Bescheidenheit sind uns nicht angeboren. Doch der Glaubende darf dies von seinem Herrn lernen und mit dessen Hilfe verwirklichen (Sprüche 11,2; 12,9; Matthäus 11,29). – Wenn bei einem Bauern Barmherzigkeit und Fleiss Hand in Hand gehen, wird der Erfolg nicht ausbleiben (Sprüche 12,10.11).
In Vers 13 werden wir ermahnt, bei dem, was wir sagen, vorsichtig zu sein. Suchen wir aber mit unseren Worten das Wohl der anderen, werden die positiven Resultate nicht ausbleiben. Im Neuen Testament werden wir ermahnt, Worte der Gnade zu reden und das zu sagen, was dem Hörenden weiterhilft (Epheser 4,29; Kolosser 4,6).
Gute oder törichte Worte
Meinen wir nicht manchmal, wir wüssten schon, was wir zu tun haben, und sind nicht bereit auf einen Rat anderer zu hören (Vers 15)?
Auch in diesem Abschnitt haben wir verschiedene Sprüche, die von unseren Lippen, d.h. von unseren Worten, handeln. Lügen zu verbreiten ist nicht nur vor Menschen schlimm, sondern auch für Gott ein Gräuel (Vers 22). Bestand hat nur die Lippe der Wahrheit (Vers 19). Oft merken wir gar nicht, wie wir mit unseren Worten den anderen verletzen. Aber Gottes Wort macht uns darauf aufmerksam und zeigt, dass auch unsere Zunge unter dem Einfluss göttlicher Weisheit stehen soll (Vers 18).
Frieden ist die Voraussetzung, dass Freude einkehren kann (Vers 20). Das gilt für unsere Beziehung zu Gott. Wer Frieden mit Gott hat, kann sich am Herrn Jesus, seinem Erlöser, freuen. Ähnliches gilt auch für das Zwischenmenschliche. Herrscht in einer Familie Frieden, wird auch die gemeinsame Freude nicht ausbleiben.
Immer wieder greift Salomo in den Sprüchen das Thema Fleiss auf. Dabei zeigt er den Gegensatz zur Faulheit oder Trägheit auf (Sprüche 12,24.27). – Die Verse 26 und 28 gehören zusammen. Nur ein Gläubiger kann seinen Nächsten auf den richtigen Weg – d.h. den Weg nach Gottes Gedanken – weisen. Wenn dieser den Pfad der Gerechtigkeit einschlägt, ist er auf dem schmalen Pfad, der zum Leben führt (Matthäus 7,14). «Aber der Weg der Gottlosen führt sie irre.» Wie viele solcher Irrwege werden in der Welt angepriesen!
Auswirkungen unserer Worte
Normalerweise haben die Eltern mehr Lebenserfahrung als die Kinder. Darum sollen wir auf ihre Unterweisung hören, sofern diese Hinweise nicht im Widerspruch zu den Belehrungen der Bibel stehen (Vers 1).
Wie bereits in Sprüche 12,24.27 wird in Vers 4 wieder das Thema «Trägheit oder Fleiss» aufgegriffen. Sowohl in beruflicher Hinsicht als auch im geistlichen Leben sind Einsatz und Fleiss gefragt, wenn wir etwas erreichen wollen. Die Menschen sagen zu Recht: Ohne Fleiss kein Preis.
Der siebte Vers warnt vor dem Vorspiegeln falscher Tatsachen. Gott möchte von den Seinen, dass sie aufrichtig und ehrlich sind. Der Herr ist uns darin das grosse Vorbild (Johannes 8,25).
Seit unserer Bekehrung sind wir der Stellung nach Licht in dem Herrn. Nun soll auch unser praktisches Verhalten unserer Stellung vor Gott entsprechen: «Wandelt als Kinder des Lichts.» Wenn wir dies beherzigen und befolgen, werden wir als glückliche und frohe Christen leben (Vers 9; Epheser 5,8).
Es liegt in unserer alten Natur, dass wir reich werden möchten, und zwar möglichst schnell. Aber nicht nur Vers 11, sondern auch das Neue Testament warnt uns davor (1. Timotheus 6,9.10).
Niemand wartet gern. Wir finden es besonders schwer, wenn sich die Wartezeit in die Länge zieht. Können wir aber auf Gott warten, wird es umso schöner sein, wenn seine Antwort eintrifft (Vers 12).
Vom Nutzen weiser Worte
Wir wollen Vers 13 auf das Wort Gottes und seine Autorität beziehen. Wer es ignoriert oder sich dagegen auflehnt, wird die entsprechenden Folgen tragen müssen. Wer sich aber in Gottesfurcht unter die Autorität der Bibel stellt, wird gesegnet sein. Der Weise in Vers 14 ist Gott (Römer 16,27). Wenn wir auf seine Belehrung in seinem Wort achten und danach leben, bewahrt uns dies vor den uns drohenden Gefahren.
Der Vers 16 ist nicht der einzige in den Sprüchen, der uns empfiehlt, überlegt zu handeln. Doch wie oft reagieren wir vorschnell und können das angerichtete Unheil nicht mehr ungeschehen machen.
Die Wahrheit in Vers 20 wird auch im Neuen Testament bestätigt. Den Korinthern schrieb der Apostel Paulus: «Böser Verkehr verdirbt gute Sitten» (1. Korinther 15,33). Anderseits wird die Gemeinschaft der Glaubenden untereinander betont, so z.B. in Hebräer 10,24: «Lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken.»
Etwas kann der Gute in Vers 22 seinen Nachkommen nicht vererben: seinen Glauben. Jeder Mensch muss eine persönliche Glaubensbeziehung zu Gott und zum Herrn Jesus haben. Hingegen wird das gottesfürchtige Leben eines Vaters oder Grossvaters eine bleibende Wirkung auf die Kinder bzw. Enkel haben. – Ein Kind muss erzogen werden (Vers 24). Es ist keine Liebe der Eltern, wenn sie ihrem Sohn oder ihrer Tochter alles durchgehen lassen. Denken wir daran, dass unser himmlischer Vater uns erzieht, weil Er uns liebt (Hebräer 12,5-7).
Der Kluge und der Narr
Das Haus in Vers 1 erinnert an die Familie. Wie gross ist da der Einfluss der Frau und Mutter! Ihr göttlich weises Verhalten trägt viel zum Wohlergehen der Familie bei. Verhält sie sich aber töricht und fleischlich, wird dies zum Schaden ausschlagen.
Wie nötig ist die Gottesfurcht, um den Lebensweg gerade, d.h. in Übereinstimmung mit Gott zu gehen! Wer aber Ihn und sein Wort verachtet, muss sich nicht wundern, wenn sein Weg verkehrt verläuft (Vers 2).
In Vers 7 geht es nicht um das Evangelium, das wir allen Menschen, auch den törichten, vorstellen sollen. Hier handelt es sich um den engeren Kontakt mit solchen, die von Gott und dem Herrn Jesus nichts wissen wollen. Wir sollen ihn meiden, um nicht negativ beeinflusst zu werden.
Weil niemand in das Innere (das Herz) seines Nächsten sehen kann, werden Menschen einander nie ganz verstehen (Vers 10). Doch der Glaubende weiss, dass sein Heiland ihn durch und durch kennt und ihn völlig versteht (Apostelgeschichte 1,24; Johannes 10,14.27).
Viele Menschen richten ihr Leben nach ihrem Gutdünken ein. Sie lassen sich von niemand dreinreden und entscheiden selbst, was für sie gut und recht ist. Sie vergessen, dass ihr Gewissen kein sicherer Führer ist. Nur das Wort Gottes wird uns richtig raten und leiten. Wie mancher meinte, auf dem Weg guter Werke und eines anständigen Lebens den Himmel zu erreichen. Doch es ist ein Weg, der ins Verderben führt. Nur der Glaube an den Herrn Jesus errettet für den Himmel.
Umgang mit Mitmenschen
Vers 13 ist eine Folge der Sünde, die in die Welt gekommen ist. Solange wir hier leben, gelten diese Worte auch für Glaubende. Irdische Freuden sind von den Lebensumständen abhängig und vergänglich. Wie schnell werden sie oft von der Traurigkeit verdrängt! Erst im ewigen Zustand, wo es keine Sünde mehr geben wird, wird auch die Trauer verschwunden sein (Offenbarung 21,4).
Vers 14 ist eine einfache Illustration zu Galater 6,7: «Was irgend ein Mensch sät, das wird er auch ernten.»
Der Kluge lebt nicht gedankenlos in den Tag hinein. Er weiss, wie schnell er vom richtigen Weg abkommen und vom Bösen beeinflusst werden kann. Deshalb achtet er auf seine Schritte, fürchtet sich und meidet das Böse (Sprüche 14,15.16).
Arme Menschen haben meistens wenig oder keine Freunde. Hingegen gibt es viele, die die Gunst der Reichen suchen (Vers 20). Doch das ist nicht die Haltung, die der Herr von den Seinen wünscht. Er selbst hat sich über Arme und Elende erbarmt. Wir sollen in seine Fussstapfen treten und Ihn nachahmen (Vers 21). Wenn wir den Nächsten verachten, der sozial tiefer steht als wir, sündigen wir gegen Gott, der niemand verachtet (Hiob 36,5; Jakobus 2,1-9).
In Vers 22 geht es um das Herz. Dort entstehen die Beweggründe für unser Tun. Schmieden wir wirklich das Gute? Wir wissen, dass in unserem Herzen auch hässliche Gedanken aufkommen können. Doch wir müssen sie sofort verurteilen, damit sie nicht zu Taten werden.
Die Furcht des Herrn
Gottesfurcht geht Hand in Hand mit Gottvertrauen. Sie ist es auch, die uns auf dem Glaubensweg durch diese Welt, in der uns viele Gefahren drohen, bewahrt (Sprüche 14,26.27).
Langmut und Gelassenheit sind keine Charakterzüge, die uns angeboren sind. Meistens reagieren wir zu schnell, wenn uns etwas Ungewohntes widerfährt, oder wir ereifern uns, wo wir ruhig bleiben sollten. Darum ist es gut, wenn wir die Empfehlungen der Verse 29 und 30 beherzigen.
Wenn jemand arm ist oder sozial auf einer tieferen Stufe steht als wir, ist das überhaupt kein Grund, auf ihn herabzuschauen. Verachten wir einen solchen Menschen, dann sündigen wir nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen Gott, der sowohl ihn als auch uns geschaffen hat (Vers 31).
Der Verständige muss seine Weisheit nicht zur Schau stellen. Sie ruht in seinem Herzen und zeigt sich nur, wenn z.B. eine wichtige Entscheidung getroffen werden muss. Der Tor hingegen redet unüberlegt drauflos, so dass jeder merkt, was in seinem Innern vorgeht (Vers 33).
Inhaltlich deckt sich die Aussage von Vers 35 mit Römer 13,3: «Die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten? So übe das Gute aus, und du wirst Lob von ihr haben.»
Mund und Herz
Bei Vers 1 denken wir an Gideon, der als Richter den aufgebrachten Männern von Ephraim eine milde Antwort gab. Was war das Resultat? «Da liess ihr Zorn von ihm ab, als er dieses Wort redete» (Richter 8,1-3).
Der dritte Vers wird durch andere Stellen in der Bibel bestätigt (2. Chronika 16,9; Hebräer 4,13). Nichts entgeht dem Auge Gottes. Das ist für jeden Glaubenden ein grosser Trost. Er darf sicher sein: Das Auge meines himmlischen Vaters übersieht mich nicht. Er weiss, wo ich bin und wie es mir geht. Doch bedenken wir: Er sieht uns auch dann, wenn wir uns an einem Ort aufhalten, wo wir nicht hingehören!
Die Verse 2 und 7 ermuntern uns, auf solche zu hören, von denen wir göttliche Weisheit lernen können. Sind das nicht die Gläubigen, die in ungetrübter Gemeinschaft mit ihrem Herrn und Gott leben?
Unmöglich kann der heilige Gott ein Opfer aus den Händen eines Ungläubigen annehmen (1. Mose 4,5). Erst wenn der Mensch Buße getan und auf der Grundlage des Erlösungswerks von Jesus Christus Frieden mit Gott hat, ist er in der Lage, Gott Lob- und Dankopfer zu bringen (Psalm 51,16-19; 50,23). Glaubende aber dürfen ihr Herz im Gebet vor Gott ausschütten (Vers 8).
Warum ist der Weg der Gottlosen dem Herrn ein Gräuel (Vers 9)? Weil Er weiss, dass dieser ins ewige Verderben führt. Der Herr aber will nicht den ewigen Tod des Sünders (Hesekiel 18,23; 2. Petrus 3,9).
Der Herr sieht nicht nur alle Menschen, Er kennt auch das Herz jedes Einzelnen (Sprüche 15,3.11).
Bescheidenheit und Ehrlichkeit
Niemand wird gern zurechtgewiesen. Und doch gebraucht Gott in seiner Erziehung mit uns manchmal andere Menschen, die uns auf etwas hinweisen, das bei uns nicht in Ordnung ist. Wie gut, wenn wir dann darauf hören (Vers 12).
Vers 13 spricht von einem frohen und Vers 15 von einem fröhlichen Herzen. Unsere Lebensumstände geben oft mehr Anlass zu Kummer als zu Freude des Herzens. Als Glaubende aber können wir uns allezeit im Herrn freuen (Philipper 4,4).
Die Verse 16 und 17 fordern uns auf, mit dem zufrieden zu sein, was der Herr uns hier zugedacht hat, auch wenn es wenig ist und andere Leute mehr haben als wir. «Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein grosser Gewinn» (1. Timotheus 6,6).
Bei Vers 18 denken wir an Galater 5,20 und 22. Dort wird erklärt, dass Zorn und Zank zu den Werken des Fleisches gehören, während Langmut ein Teil der Frucht des Geistes ist. Als Glaubende dürfen wir in der Kraft des Heiligen Geistes langmütig sein, den Streit beschwichtigen und als Friedensstifter tätig sein.
Vers 22 kann gut auf die Ehe angewendet werden. Es kommt nicht gut, wenn Mann und Frau nicht mehr miteinander reden. Indem sie aber alle Fragen und Probleme, die das Leben mit sich bringt, miteinander und vor dem Herrn besprechen, finden sie den Weg.
Wie können wir Vers 23 verwirklichen, so dass wir das rechte Wort im richtigen Augenblick sagen? Da hilft uns das Neue Testament. Denken wir an Kolosser 4,6 und 1. Petrus 3,15.16!
Gute Kommunikation
Der Weg des Lebens in Vers 24 ist der schmale Weg, auf den man durch den Glauben an den Heiland Jesus Christus gelangt. Dieser Pfad führt aufwärts und endet in der Herrlichkeit beim Herrn. Der breite Weg aber, auf dem sich jeder Ungläubige befindet, führt ins ewige Verderben (Matthäus 7,13.14).
Vers 25 zeigt, wie Gott dem Hochmütigen widersteht (1. Petrus 5,5). Er reisst das nieder, was der Stolze aufrichtet. Vers 26 spricht unsere Gedankenwelt an. Oft verharmlosen wir sie, weil uns zu wenig bewusst ist, dass der Herr böse Gedanken verabscheut.
Habsucht hat schon manche Familie ruiniert. Wenn sich alle Gedanken nur noch ums Geld drehen, werden die selbstlose Liebe, die gegenseitige Achtung und die Hilfsbereitschaft gegenüber den anderen verdrängt. Dann herrscht der Egoismus (Vers 27).
Der erste Teil von Vers 29 gilt, solange ein Mensch bewusst ohne Gott lebt. Sobald er aber anfängt, Gott aufrichtig zu suchen, gilt Römer 10,13: «Jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden.»
Wir alle werden in der Schule Gottes erzogen. Er will uns von dem befreien, was nicht mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit vereinbar ist. Darum ist es wichtig, dass wir ein offenes Ohr für das haben, was Er uns durch sein Wort sagt (Sprüche 15,31.32).
Der zweite Teil von Vers 33 lässt uns an den Herrn Jesus denken. In seinem wahrhaft gottesfürchtigen Leben erniedrigte Er sich bis zum Tod am Kreuz. Doch jetzt nimmt Er als Mensch den höchsten Ehrenplatz ein.
Überlegungen im Herzen
Zu Vers 1 gilt: Der Mensch denkt und Gott lenkt (vergleiche Vers 9). Eine eindrückliche Illustration dieses Verses ist Bileam. Er plante mit Balak, das Volk Israel zu verfluchen. Doch Gott zwang ihn, es zu segnen.
Vers 3 erinnert an Psalm 37,5.6. Wir sind dann gesegnet, wenn wir unseren Lebensweg in Abhängigkeit vom Herrn gehen, alles Ihm anbefehlen und auf Ihn vertrauen.
Vers 4 zufolge hat Gott für alles einen Plan. Aber niemals will Er das Böse oder den Tod des Sünders. Nein, wenn ein Mensch in seinem gottlosen Zustand verharren will, dann ist es nicht Gottes Schuld, wenn er verloren geht. Er hätte sich bekehren können. Doch an Menschen, die sich bewusst der Gnade verschliessen, wird Gott sich einmal im Gericht verherrlichen.
Der erste Teil von Vers 6 ist nicht leicht zu verstehen. Wir wollen festhalten: Die Sühnung unserer Ungerechtigkeit geschah durch das Opfer unseres Erlösers. Doch es ist die Güte Gottes, die uns dazu geführt hat, die Wahrheit über uns selbst anzuerkennen und dann zu glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Der zweite Teil von Vers 6 zeigt, dass echte Gottesfurcht im Herzen und im Leben des Glaubenden vor bösen Wegen bewahrt.
Vers 8 ist heute, wo manche auf unrechtmässige Weise reich werden wollen, hochaktuell (vergleiche Vers 11). Lasst uns als Glaubende mit dem zufrieden sein, was wir auf gerechte Weise verdienen, auch wenn es vielleicht wenig ist.
Das Herz des Weisen
Die Verse 10-15 handeln vom König und seinem Verhalten gegenüber seinen Untertanen. Der Monarch stellt die Regierung dar, die Gott zum Wohl der Menschen eingesetzt hat. Die Regierenden, egal ob sie an der Spitze einer Demokratie, einer Monarchie oder einer Diktatur stehen, sind Gott als der höchsten Instanz verantwortlich. Als Bewohner eines Landes sind wir nach Gottes Wort gehalten, uns der Staatsbehörde zu unterziehen. Die diesbezüglichen Grundsätze, die wir in den Sprüchen finden, gelten auch heute (Römer 13,1-7).
Wonach streben wir? Nach göttlicher Weisheit und geistlichem Verständnis oder nach materiellem Reichtum? (Vers 16).
Der Vers 18 hat sich im Lauf der Zeit tausendfach bewahrheitet, so dass die Menschen das Sprichwort geprägt haben: Hochmut kommt vor dem Fall. Diese Warnung richtet sich auch an uns Gläubige.
Vers 19 hat ein neutestamentliches Gegenstück in Römer 12,16: «Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen.»
Mit dem Wort in Vers 20 ist die Bibel gemeint. Wenn wir das geschriebene Wort Gottes zum Prinzip unseres Lebens machen und in allem auf den Herrn vertrauen, sind wir glücklich und auf dem guten Weg. Durch das Lesen der Bibel bekommen wir Weisheit und Einsicht, die für ein Leben der Gottesfurcht unentbehrlich sind (Sprüche 16,21.22). Aber ebenso wichtig ist, dass wir jeden Schritt unseres Lebens in Abhängigkeit vom Herrn gehen.
Das Herz des Bösen
Den Worten in Vers 25 sind wir bereits in Sprüche 14,12 begegnet. Wenn Gott in seinem Wort einen Vers wiederholt, dann weiss Er, dass wir den Hinweis besonders nötig haben. Wie leicht und wie schnell schlagen wir einen eigenwilligen Weg ein und meinen, alles sei in Ordnung! Nur in der steten Abhängigkeit von Gott bleiben wir als Glaubende von verkehrten Lebenswegen bewahrt.
Ein Belialsmensch ist einer, der nur Böses und Schlechtes im Sinn hat. Hüten wir uns vor solchen, aber auch vor denen, die uns im Vertrauen Böses über andere erzählen. Meistens versuchen böse Menschen, andere in ihre Machenschaften hineinzuziehen. Gott will uns durch die Verse 27-30 ernsthaft davor warnen.
Vers 31 spricht von der Würde des Alters. Sie wird aber nur auf dem Weg der Gerechtigkeit gefunden, d.h. wenn der Grau- oder Weisshaarige sich auch so verhält, wie es vor Gott recht ist.
Um sich selbst zu beherrschen, sind manchmal mehr Kraft und Energie nötig als um eine Heldentat zu vollbringen (Vers 32; Richter 12,1-6).
Im Alten Testament wurde das Los benutzt, um in einer Sache den Willen Gottes zu erkennen. Oft ordnete Er selbst das Werfen des Loses an (Josua 7,14-18; 1. Samuel 10,20.21; 14,41.42). Zum letzten Mal wurde diese Methode in Apostelgeschichte 1 angewendet. Heute haben wir den Heiligen Geist, der uns – oft durch das Wort Gottes – den Willen des Herrn klarmacht.
Frieden oder Streit?
Vers 1 liegt auf der gleichen Linie wie Sprüche 15,16.17 und 16,8. Wenn wir diese Aussagen auf eine Familie beziehen, kommen wir zum Schluss: Lieber ein bescheidenes Einkommen, aber Gottesfurcht, Liebe und Frieden unter den Angehörigen als Reichtum und Wohlstand, aber zerrüttete Familienverhältnisse.
Wenn Gott uns erprobt, gebraucht Er in seinem Wort oft das Bild des Schmelztiegels für Edelmetall (Maleachi 3,2.3; 1. Petrus 1,7). In Psalm 17,3 spricht Jesus Christus prophetisch davon, dass Gott Ihn geläutert habe. Im Gegensatz zu uns musste bei Ihm keine Schlacke entfernt werden. Er war absolut rein.
Über das Hassen und Geringachten des Armen haben wir bereits in Sprüche 14,20.31 gelesen. In Vers 5 geht es um das Verspotten dessen, der sozial tiefer steht als wir, aber auch um die Schadenfreude, wenn dem anderen ein Unglück passiert. Niemals dürfen wir solchen Gefühlen Raum lassen, auch dann nicht, wenn es um unseren Feind geht (Sprüche 24,17.18).
Vers 9 erinnert an 1. Petrus 4,8: «Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden.» Das bedeutet nicht, tolerant über das Böse hinwegzugehen. Nein, Sünden müssen Gott gemäss gerichtet werden, damit Er vergeben kann. Doch dann sollen wir nicht mehr davon reden, sondern zudecken und den, der gefehlt hat, lieben.
Wie reagieren wir, wenn wir zurechtgewiesen werden? Wie ein Verständiger oder wie ein Tor? (Vers 10). – Vers 13 zeigt wie viele andere Verse in den Sprüchen die Regierungswege Gottes mit uns. Wir werden das ernten, was wir gesät haben.
Ursachen für Entzweiung und Unglück
Heute leben wir in einer Zeit, in der manches Böse gutgeheissen und das Gute angeprangert wird. Schon der Prophet Jesaja sagte: «Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse» (Jesaja 5,20). Hier in Vers 15 sehen wir, dass eine solche Einstellung dem Herrn ein Gräuel ist.
Haben wir nicht schon die Wahrheit von Vers 17 erlebt? Wie gut, wenn wir in Zeiten, da es uns schlecht geht, solche haben, die uns beistehen! Doch es gibt Einen, der uns nie im Stich lässt: unser Herr und Heiland Jesus Christus (Matthäus 28,20; Hebräer 13,5).
Der Warnung vor einer Bürgschaft sind wir bereits früher begegnet (Vers 18; Sprüche 11,15). Kein Mensch weiss, wie seine Zukunft aussieht. Deshalb sollen wir keine solchen Versprechen abgeben.
Ein fröhliches Herz trägt zur Besserung des kranken Körpers bei (vergleiche Vers 22 mit Sprüche 15,13.15).
In der Welt versuchen gewisse Menschen, durch Bestechungsgeschenke auf unrechtmässige Weise zu ihrem Ziel zu kommen (Vers 23). Möchten wir uns als Glaubende davor hüten, die Gunst der anderen so oder durch Schmeichelei zu erschleichen (Hiob 32,21.22).
Manche gläubige Eltern trauern um ihre Söhne oder ihre Töchter, die im Unglauben verharren und sich in der Welt verloren haben (Sprüche 17,21.25). Mögen die Gebete dieser Väter und Mütter dazu führen, dass es bei den verlorenen Kindern zu einer echten Umkehr kommt!
Die Sprüche empfehlen uns immer wieder, beim Reden zurückhaltend zu sein (Sprüche 17,27.28).
Gute oder schlechte Worte
In Vers 1 geht es nicht um die Absonderung vom Bösen, die Gottes Wort an manchen Stellen von den Gläubigen fordert (2. Korinther 6,17 – 7,1; 1. Thessalonicher 5,22; 2. Timotheus 2,20.21). Hier dient die Absonderung dazu, besser sein zu wollen als andere. Dann lässt man sich auch von niemand korrigieren.
Menschen, die ohne Gott leben, verachten das, was von Ihm kommt, ja, sie spotten über Ihn und sein Wort und ziehen es ins Lächerliche (Vers 3).
Die Verse 6 und 7 stehen im Gegensatz zu Vers 4. Was rufen unsere Worte hervor? Führen sie zu Streit oder sprudeln sie göttliche Weisheit?
Vom Ohrenbläser haben wir bereits in Sprüche 16,28 gelesen. Hier geht es um seine Worte. Sie beinhalten meistens Klagen über andere oder Anschuldigungen gegen sie. Man fühlt sich geschmeichelt, auf diese Weise ins Vertrauen gezogen zu werden. Doch es ist zum Schaden.
Der Name des Herrn umfasst alle Charakterzüge Gottes. Hier wird Er mit einem unüberwindbaren Turm verglichen. Wir können nirgendwo sicherer sein als bei Ihm. Von seinen Schafen sagt der Herr Jesus als der gute Hirte: «Ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben» (Johannes 10,28). Während der Glaubende seine Sicherheit in Gott findet, stützt sich der ungläubige Reiche auf sein Vermögen und meint, dies sei seine feste Stadt (Vers 11). Welch eine Illusion!
Gutes oder schlechtes Verhalten
Es gibt Leute, die sehr von sich überzeugt sind. Sie meinen, alles zu wissen, und geben eine Antwort, bevor sie richtig zugehört haben. Vers 13 warnt uns davor.
Mit Willenskraft erreicht der Mensch manches. Er kann sogar eine Krankheit ertragen. Wenn aber sein Geist zerschlagen und seine Willenskraft gebrochen ist, was dann (Vers 14)? Der Gläubige weiss, dass die Kraft, die er benötigt, um unter schweren Umständen nicht zusammenzubrechen, ausserhalb von ihm liegt. Er findet sie in seinem Gott (Psalm 62,6-8; 68,20).
Wichtig ist es, in einem Konflikt beide Seiten anzuhören. Vielleicht kann der Erste so überzeugend auftreten, dass man meint, der Fall sei klar. Doch dann kommt der Nächste und stellt eine andere Sicht der Dinge vor (Vers 17).
Wie handelt man an einem Bruder treulos? Indem man z.B. sein Vertrauen missbraucht (Vers 19). Das hinterlässt tiefe, fast unheilbare Wunden. Oft kann hier nur der Herr in seiner Gnade helfen.
Vers 21 erinnert uns an das Unheil, das die Zunge anrichten kann. Jakobus 3,5-10 bestätigt dies.
In Vers 22 geht es nicht um irgendeine Frau, die ein Mensch gefunden hat und die er dann heiratet. Es geht um die Frau, die Gott für einen gläubigen Mann vorgesehen hat. Wenn der Herr ihm jene zeigen kann, die seine Frau werden soll, dann hat er wirklich «Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt von dem Herrn».
Vers 24b lässt uns an den Herrn Jesus denken, der uns wirklich liebt und uns nie verlässt.
Armut und Reichtum
Nicht die Höhe seines Bankkontos macht den Wert eines Menschen aus, sondern sein moralisches Verhalten (Vers 1).
Wenn in den Sprüchen von «Kenntnis» bzw. «Unkenntnis» die Rede ist, geht es immer um die Kenntnis von Gott und wie Er alles beurteilt. Wer sich nicht um Ihn und seine Gedanken kümmert, wird sich bald als sein Gegner entpuppen (Sprüche 19,2.3).
Wenn der Reichtum die Basis für eine Freundschaft ist, wird diese nur so lange halten, wie Geld vorhanden ist (Vers 4).
Dass die Worte von Vers 5 in Vers 9 praktisch wiederholt werden, zeigt, wie schlimm falsche Aussagen und Lügen in Gottes Augen sind. Wenn am Schluss der Bibel jene aufgezählt werden, die einmal ewig draussen sind, heisst es unter anderem: «Jeder, der die Lüge liebt und tut» (Offenbarung 22,15). Weil sie über diese Sünde nie Buße getan haben, gehen sie ewig verloren.
Vers 8 enthält eine gewisse Voraussetzung für Vers 11. Zuerst kommt das Verständnis der göttlichen Wahrheit. Daraus folgt wahre Einsicht und ein Verhalten, in dem wir Gottes Eigenschaften nachahmen. Ist Er nicht langmütig und voll Barmherzigkeit?
Eltern können ihren Kindern materielle Güter hinterlassen. Aber die Frage des Ehepartners sollten sie ganz Gott überlassen, denn «eine einsichtsvolle Frau kommt von dem Herrn» und nicht von Vater und Mutter (Vers 14)!
Fleiss und Nächstenliebe
In den Sprüchen werden wir oft vor Faulheit, Trägheit und Passivität gewarnt (Sprüche 19,15.24; Sprüche 20,4). Das betrifft auch unser geistliches Leben. Deshalb finden wir in der Bibel Aufforderungen wie: «Betet! – Wacht! – Widersteht! – Wandelt! – Arbeitet!»
Wer sich der sozial schwachen Menschen annimmt, tritt in die Fussstapfen seines Herrn und Heilands, der sich um die Ärmsten gekümmert hat (Lukas 10,33.34; 18,38-42). Darüber hinaus wird ihm sogar eine Belohnung versprochen (Vers 17). – Die Bibel macht klar, dass es in der Kindererziehung Situationen gibt, wo Körperstrafe nötig wird. Doch sie warnt uns zugleich vor jeder Unbeherrschtheit. Wie leicht und wie schnell gehen wir zu weit (Sprüche 19,18.19)!
In Vers 21 wird der Nachdruck auf die Souveränität Gottes gelegt. Wir Menschen mögen viele Überlegungen anstellen. Doch was unter allen Umständen zustande kommt, sind nicht unsere, sondern Gottes Pläne. Der Mensch denkt und Gott lenkt!
Die in der Bibel erwähnten Spötter machen sich über Gott und das, was Ihm wichtig ist, lustig. Der Gläubige wird vor dem Kreis solcher Menschen gewarnt (Psalm 1,1). Wenn diese Leute ihre Gesinnung nicht ändern, werden sie einmal von Dem gerichtet werden, den sie verspottet haben (Vers 29; Offenbarung 20,11-15).
Nicht nur die Söhne, sondern wir alle sollten die Warnung in Vers 27 beherzigen. Es ist äusserst gefährlich, auf die Lehren und Ideen zu hören, die in der Welt kursieren. Sie führen in die Irre, denn sie stehen den Anweisungen der Bibel direkt entgegen.
Der klare Blick für Lebenssituationen
Der übermässige Genuss von Alkohol bewirkt ein hemmungsloses Verhalten. Das zeigt sich vor allem beim Reden (vergleiche Vers 1 mit Sprüche 23,29-35).
Vers 2 und Sprüche 19,12 sind inhaltlich sehr ähnlich und werden durch Römer 13,3.4 bestätigt. Die Regierung ist von Gott eingesetzt. Sie soll das Gute fördern und das Böse bestrafen. Als Christen sind wir gehalten, uns jenen Menschen unterzuordnen, die Regierungsautorität besitzen (Römer 13,1.5).
Vers 6 ist heute noch so wahr wie damals. Jeder von uns neigt dazu, sich ins beste Licht zu setzen. Aber kann man sich wirklich auf uns verlassen? Sind wir in jeder Hinsicht zuverlässig? Denken wir an 2. Korinther 10,18!
Die Frage von Vers 9 wird erst im Neuen Testament vollständig beantwortet. Römer 3,22-26 zeigt, dass ein Mensch durch den Glauben und auf der Grundlage reiner Gnade von Gott gerechtfertigt wird. Als Glaubende dürfen wir bekennen: «Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde» (1. Johannes 1,7).
Die Verse 10 und 23 erinnern uns an früher Gelesenes (Sprüche 11,1; 16,11). Wer im Geschäftsleben den anderen betrügt, begeht eine Sünde, die Gott als Gräuel bezeichnet.
Gott, unser Schöpfer, hat uns Ohren gegeben, damit wir auf Ihn hören und sein Wort befolgen. Er hat uns auch Augen geschenkt, um das zu sehen und zu erkennen, was Er uns von sich zeigen möchte (Vers 12). Und vergessen wir nicht: Auch Er hört und sieht uns!
Falschheit oder Besonnenheit
Bereits in Sprüche 6,1-5 warnte Salomo davor, für einen anderen Bürge zu werden (siehe auch Sprüche 11,15; 22,26). In Vers 16 unseres Kapitels werden die Folgen einer eingegangenen Bürgschaft aufgezeigt.
Wer sich als Kind dem Vater oder der Mutter widersetzt und gegen sie auftritt, bekommt es mit Gott zu tun (Vers 20). Denn Er hat die Eltern als eine Autorität auf dieser Erde eingesetzt.
Es liegt in unserer Natur, dass wir zurückgeben wollen, wenn uns Unrecht getan worden ist. Aber das Wort Gottes empfiehlt uns etwas anderes: «Vergeltet niemand Böses mit Bösem.» – «Rächt nicht euch selbst, Geliebte» (Römer 12,17.19). «Harre auf den Herrn, so wird er dich retten» (Vers 22). Er möge uns helfen, dies zu verwirklichen.
Es ist eine unserer menschlichen Schwächen, dass wir mit unserem Mund vorschnell sind. Wir versprechen Gott etwas, ohne die Kosten zu überschlagen (Vers 25; Lukas 14,28-33). Unser Herr hingegen konnte sagen: «Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund» (Psalm 17,3), und: «Ich bin durchaus das, was ich auch zu euch rede» (Johannes 8,25). Möchten wir von Ihm lernen und zurückhaltender sein.
Der Geist ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Vers 27 zeigt nicht nur, dass der Geist eine Gabe des Herrn ist, sondern dass er den Menschen auch befähigt, über etwas nachzudenken, etwas zu erforschen (Psalm 77,7). Während Satan den Sinn der Ungläubigen verblendet, wird der Geist der Gläubigen durch den Heiligen Geist erleuchtet.
Gutes oder böses Herz
Der erste Vers ist ein Trost für jeden Gläubigen. Er weiss, dass der souveräne Gott das Herz der Mächtigen in der Welt, ja sogar das Herz seiner Feinde, so lenken kann, dass es zum Wohl der Seinen und zur Erfüllung seiner Pläne ausschlägt. Gott hat alles, was auf der Erde geschieht, in seiner Hand.
Vers 2 gleicht inhaltlich Sprüche 16,2. Auch im Blick auf unsere persönlichen Wege hat der Herr das letzte Wort. Lasst uns dies nicht vergessen und Ihm voll vertrauen.
Eine rechte Herzenseinstellung ist dem Herrn wichtiger als äusserliche Opfergaben (Vers 3; Hosea 6,6; Matthäus 9,13).
In Vers 5 wird der Unterschied zwischen Fleiss und Hast sehr extrem ausgedrückt. Das erste führt zum Überfluss, das zweite zum Mangel (vergleiche Sprüche 20,21).
Wer auf unlauterem Weg reich werden will, kommt nur scheinbar zum Ziel. «Der Lautere oder Aufrichtige aber, sein Tun ist gerade» (Sprüche 21,6.8).
Vers 11 und Sprüche 19,25 zeigen, dass es Menschen gibt, die sich belehren lassen und dadurch weise werden. Sie lernen auch aus den Fehlern von anderen.
Wie oft schon hat sich Vers 13 in der Praxis des täglichen Lebens bewahrheitet! Da sind Menschen, die in ihrem Geiz nichts für Arme und Bedürftige übrig haben. Wenn sich jedoch das Blatt wendet und sie selbst in Not kommen, ist keiner da, der ihnen helfen will.
Pläne mit oder ohne Gott
Mit der Freude in Vers 17 ist nicht die Freude gemeint, die der Herr schenkt, sondern das Vergnügungsangebot der Welt. Dies alles hat seinen Preis. Wer zu viel davon geniesst, verarmt. – Vergleiche Vers 18 mit Sprüche 11,8 und Jesaja 43,3. Der Überrest aus Israel in der Zukunft wird einmal erfahren, wie der Herr ihn befreien und seine Bedränger richten wird.
In Vers 21 geht es um praktische Gerechtigkeit und Güte im täglichen Leben. Wer diese Eigenschaften an den Tag legt, wird schon in diesem Leben dafür belohnt. Er erntet, was er gesät hat.
In den Sprüchen taucht immer wieder die Empfehlung auf, die Zunge zurückzuhalten (Vers 23). Wie nötig haben wir es, schnell zum Hören und langsam zum Reden zu sein (Vers 28; Jakobus 1,19).
Unmöglich kann ein Mensch, der keine geordnete Beziehung zu Gott hat, Ihm ein wohlgefälliges Opfer bringen (Vers 27). Und doch gibt es viele religiöse Menschen wie z.B. König Saul, die meinen, trotz ihres Ungehorsams gegenüber Gottes Anweisungen Ihm opfern zu können (1. Samuel 15,17-23).
Menschen, die in der Sünde leben, verhärten sich Gott gegenüber und werden immer trotziger. Der Gläubige aber, der mit dem Herrn leben möchte, ist bereit, seinen Lebensweg stets ins Licht Gottes zu stellen und wenn nötig Korrekturen vorzunehmen (Vers 29).
Vers 30 zeigt einmal mehr, dass echte Weisheit nur von Gott kommt. Die Weisheit der Welt führt niemals zur Erkenntnis Gottes und ist daher Torheit in seinen Augen (1. Korinther 1,19-21).
Charakter und soziale Stellung
In Prediger 10,19 heisst es: «Das Geld gewährt alles.» Geht es jedoch um moralische Werte eines Menschen, müssen wir einsehen, dass ein guter Name und Anmut nicht zu kaufen sind. Zudem bedeuten sie mehr als Silber und Gold (Vers 1). – Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe und verdienen deshalb unsere Achtung. Die sozialen Unterschiede aber, die unter ihnen bestehen, gehören zu den allgemeinen Folgen der Sünde, die durch uns in die Welt gekommen ist (Vers 2).
Der dritte Vers warnt vor blindem Optimismus. Die göttliche Weisheit hilft uns, den Unglück bringenden Gefahren auszuweichen. – Auch wenn uns Christen als Folge eines demütigen und gottesfürchtigen Lebens keine materiellen Vorteile versprochen sind, wissen wir doch, dass wir mit dieser Haltung in die Fussstapfen unseres Herrn treten (Vers 4; Matthäus 11,29).
Wie wichtig ist Vers 6 für die Kindererziehung! Sie soll der Natur der einzelnen Kinder angepasst sein. Dann wird der Herr Gelingen und Erfolg schenken.
Wir haben zu Beginn unserer Überlegungen über die Sprüche gesehen, dass sie den göttlichen Grundsatz illustrieren: «Was irgend ein Mensch sät, das wird er auch ernten» (Galater 6,7). Das wird in den Versen 8 und 9 direkt bestätigt.
Es ist ein grosser Trost zu wissen, dass der Glaubende unter den Augen des Herrn leben darf und daher vor vielem bewahrt bleibt (Vers 12). Doch wir sollen keineswegs sorglos vorangehen, sondern uns der vielen drohenden Gefahren bewusst sein (Vers 14). Der Herr will uns bewahren. Bleiben wir nahe bei Ihm!
Worte der Wahrheit
Ab Vers 17 bis zum Ende von Kapitel 24 folgt ein neuer Unterabschnitt im Buch der Sprüche. Ähnlich wie in den Kapiteln 1 bis 9 richtet sich der inspirierte Schreiber direkt an seinen Sohn. Auf uns bezogen können wir sagen: Es ist die göttliche Weisheit, die uns persönlich anspricht.
Haben wir ein offenes Ohr für all die Sprüche gehabt, die uns Salomo unter der Leitung des Heiligen Geistes seit Kapitel 10 vorgestellt hat? Wie wichtig ist es, diese Worte der Weisen im Herzen zu bewahren! Dann können wir sie zu gelegener Zeit auch anderen weitergeben (Vers 21). Doch den Hauptgrund, warum Salomo diese Sprüche für uns aufgeschrieben hat, finden wir in Vers 19: «Damit dein Vertrauen auf den Herrn sei.» Nur mit seiner Hilfe gelingt es uns, diese praktischen Ratschläge zu verwirklichen.
Gott hat ein besonderes Augenmerk auf die sozial Schwachen in der menschlichen Gesellschaft. Das gleiche Verhalten wünscht Er auch von uns (Sprüche 22,22.23).
Die Verse 24 und 25 warnen uns vor dem Umgang mit einem zornigen und hitzigen Mann. Wir würden dadurch negativ beeinflusst werden.
Die alte Grenze in Vers 28 bezieht sich auf das Erbteil, das jede israelitische Familie im Land Kanaan bekommen hatte (5. Mose 19,14). Als der gottlose König Ahab den Weinberg Nabots kaufen und dort seinen Gemüsegarten anlegen wollte, weigerte sich dieser treue Israelit, sein Erbe zu veräussern (1. Könige 21,3). Nabot musste schliesslich seine Standhaftigkeit und sein Festhalten am Wort Gottes mit dem Tod bezahlen.
Mahnung zur Bescheidenheit
Gott hat die Regierungsautoritäten gegeben. Er ist es auch, der Könige absetzt und Könige einsetzt (Römer 13,1; Daniel 2,21). Wir sind gehalten, diese Personen und ihre Autoritätsstellung zu achten (1. Petrus 2,17). Wenn sie uns Gunst erweisen, berechtigt uns dies nicht zu einer Missachtung des sozialen Unterschieds (Sprüche 23,1-3).
Die Liebe zum Geld ist in uns allen verwurzelt. Deshalb warnt uns die Bibel sowohl im Alten wie im Neuen Testament davor, reich werden zu wollen. Es wäre ein Streben nach einer äusserst unsicheren Sache (Sprüche 23,4.5; 1. Timotheus 6,9-11).
Der missgünstig Blickende ist eine eifersüchtige Person. Mit so jemand sollen wir uns nicht näher einlassen, denn wir werden nie wissen, woran wir wirklich sind. Es kann sogar sein, dass uns das Vertrauen in eine solche Person teuer zu stehen kommt (Sprüche 23,6-8).
Die Verse 10 und 11 zeigen einmal mehr, dass der Herr auf der Seite der Schwachen und sozial Benachteiligten steht. Er ist ihr starker Erlöser, der sich für ihre Sache einsetzen wird (Psalm 68,6).
Obwohl wir unseren Verstand niemals ausschalten, sondern richtig gebrauchen sollen, geht es doch beim Hören und Aufnehmen des Wortes Gottes immer um die Ohren und das Herz. Wenn die Worte der Erkenntnis, die wir aus der Bibel lernen, reines Kopfwissen bleiben, werden sie uns wenig nützen. Sie sollen doch zu einer Auswirkung in unserem Leben führen! Dazu kommt es nur, wenn wir sie mit dem Herzen aufnehmen.
Höre, mein Sohn!
Kinder empfinden die Erziehung durch die Eltern nicht als etwas Angenehmes, vor allem wenn Strafe nötig wird! Auch wir als Kinder des himmlischen Vaters freuen uns nicht, wenn Er uns erziehen und zurechtbringen muss. Doch das Resultat ist Errettung und Frucht für Gott (Vers 14; Hebräer 12,5-11).
Jeder Vater freut sich, wenn er merkt, dass sein Sohn seine Unterweisung beherzigt. Noch viel mehr freut sich der himmlische Vater, wenn Er sieht, wie die Erziehung seiner Kinder Wirkung zeigt (Sprüche 23,15.16).
Haben wir nicht schon die Ungläubigen beneidet, denen es besser ging als uns? (Sprüche 23,17.18; Psalm 73). Um von diesen verkehrten Gedanken loszukommen, gibt es nur eine Lösung: sich von neuem auf den Herrn auszurichten und an unsere Hoffnung als Gläubige zu denken. Ja, es gibt ein Ende oder eine Zukunft, sowohl für den Ungläubigen als auch für den Glaubenden. Doch welch ein Unterschied! Die einen enden im Gericht Gottes, die anderen in der Herrlichkeit bei Ihm.
Gott hat uns alle Speise «zur Annahme mit Danksagung» gegeben (1. Timotheus 4,3; 6,17). Keiner soll darben. Aber wir werden vor dem übermässigen Genuss von Alkohol und der Schlemmerei gewarnt (Sprüche 23,19-21). – Vers 23 ist ein allgemein gültiger Grundsatz im Blick auf die göttliche Wahrheit, wie wir sie in der Bibel finden. Sie fällt uns nicht einfach in den Schoss. Geistliche Energie und Ausharren beim Lesen und Studieren der Bibel sind nötig, um die Gedanken Gottes kennen zu lernen. Was wir erfasst (gekauft) haben, sollen wir nicht wieder aufgeben (verkaufen)!
Warnung vor Sünden
Das Herz ist der Sitz der Persönlichkeit. «Von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens» (Sprüche 4,23). Wenn wir an den Herrn Jesus als unseren Heiland glauben, möchte Er unser ganzes Herz haben, damit Er uns nach seinem Willen führen kann. Doch wie sieht die Praxis unseres Christenlebens aus? Geben wir nicht oft einen Teil unserer Zuneigungen der Welt und ihren Ideen? Wie schade!
Ab Vers 29 haben wir eine eindrückliche Beschreibung der Gefahr des Alkoholmissbrauchs. Bis heute führt diese Droge viele Menschen ins Elend, ruiniert die Gesundheit und zerstört sowohl Ehen als auch Familien. Möchten wir auf die Warnung der Bibel hören: «Sieh den Wein nicht an, wenn er sich rot zeigt, wenn er im Becher blinkt, leicht hinuntergleitet», und uns bewahren lassen.
Vers 33 zeigt, dass der Mensch, der dem Alkohol zuspricht, keinen klaren Sinn mehr hat. Sein Herz wird Verkehrtes reden.
Doch das Ernsteste steht in Vers 35: Alkoholmissbrauch macht abhängig! Wie manch einer ist dieser Sucht verfallen und kann sich nicht mehr aus eigener Willenskraft daraus befreien. Er erlebt die Wahrheit von Johannes 8,34: «Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht.» Doch der Herr Jesus ist als Retter gekommen, um uns Menschen von jeder Sklaverei der Sünde zu befreien – auch von der Alkoholsucht. «Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein» (Johannes 8,36). Lasst uns unser ganzes Vertrauen auf Ihn setzen!
Aspekte der Weisheit
Äusserlich gesehen haben ungläubige Menschen oft mehr Erfolg im Leben als Glaubende, die in Gottesfurcht vorangehen möchten. Das kann zu Neid in unserem Herzen führen. Doch der Herr warnt uns davor, denn Er kennt die Motive und Ziele der Gottlosen. Er weiss auch, was für einer schrecklichen Zukunft sie entgegengehen (Sprüche 24,1.2.19.20).
Beim Haus in Vers 3 können wir an unser Leben oder an unsere Familie denken. Das beste Fundament sowohl unseres Lebens als auch unserer Familie ist das Hören und Befolgen des Wortes Gottes (Matthäus 7,24.25). So setzen wir die weisen Belehrungen der Bibel im täglichen Leben um.
Wie verhalten wir uns, wenn unsere Lebensumstände schwierig werden, wenn wir in äussere Bedrängnis kommen? (Vers 10). Der Herr möchte nicht, dass wir dann aufgeben, sondern uns mit geistlicher Energie auf seine Hilfe und Kraft stützen. Glückselig der Mensch, der seine Stärke in Gott findet (Psalm 84,6)!
Die Verse 11 und 12 erinnern uns an die Verantwortung, die wir gegenüber unseren ungläubigen Mitmenschen haben. Sie merken nicht, wie Satan sie durch die Verführungen der Welt auf einen Weg lockt, der in der ewigen Verdammnis endet. Darum ist es unsere Aufgabe, so vielen wie möglich die gute Botschaft vom Herrn Jesus zu bringen. Er möchte auch sie retten und zu Gott zurückführen. Nehmen wir auch Hesekiel 33,7-9 diesbezüglich zu Herzen!
Gerechte und Gottlose
In den Versen 13 und 14 wird das Bild des Honigs gebraucht, um die Süssigkeit der göttlichen Weisheit, wie wir sie in der Bibel finden, aufzuzeigen. Wenn wir uns davon nähren, wird dies zu einer ungetrübten Gemeinschaft mit dem Herrn und zu einem ewigen Gewinn führen.
Solange wir als Glaubende hier leben, haben wir noch die Sünde in uns. Wir müssen zwar nicht mehr sündigen wie die Ungläubigen. Wenn wir jedoch nicht wachsam sind, kommen wir leicht zu Fall. So sagt Jakobus: «Wir alle straucheln oft» (Jakobus 3,2). Aber wir müssen nicht liegen bleiben, sondern dürfen als Kinder Gottes dem Vater unsere Sünden bekennen, seine väterliche Vergebung erfahren und dann den Glaubensweg weitergehen (1. Johannes 1,9).
Wie schlimm ist die Schadenfreude! Der Herr möge uns davor bewahren. Die Verse 17 und 18 stehen warnend in der Bibel, weil so etwas auch bei einem Gläubigen vorkommen kann.
Gottlose leben ohne geordnete Beziehung zu Gott. Wenn sie sterben, verlöscht ihre Leuchte, und das, wofür sie gelebt haben, ist zu Ende. Sie haben keine Hoffnung über den Tod hinaus und nur noch das Gericht zu erwarten (Vers 20; Hebräer 9,27).
Der Herr ist die oberste Instanz und der König eine von Ihm eingesetzte Autorität auf der Erde. Wir werden aufgefordert, uns nicht gegen diese Autoritäten aufzulehnen, sondern jedem die ihm zustehende Ehre zu erweisen. «Erweist allen Ehre; liebt die Brüderschaft; fürchtet Gott; ehrt den König» (1. Petrus 2,17).
Warnung vor Unrecht und Faulheit
Diese Sprüche werden nicht mehr direkt Salomo zugeschrieben. Doch sie stammen auch von weisen Menschen, und der inspirierte Schreiber dieses Bibelbuchs hat sie in seine Sammlung aufgenommen.
Richter, die Urteile fällen müssen, sollen sich nicht von der Person, die sie zu richten haben, beeinflussen lassen. Doch kein Mensch ist so absolut gerecht, dass er ganz ohne Ansehen der Person richtet. Das kann und tut nur Gott (1. Petrus 1,17).
Vers 27 gibt den göttlichen Grundsatz an, nach dem ein gläubiger Mann eine Ehe eingehen und eine Familie gründen soll: Zuerst kommt die Ausbildung und der Beruf. Erst wenn er eine Grundlage besitzt, auf der er eine Familie erhalten kann, soll er eine Ehe eingehen. Manche junge Christen übersehen dies leider und gehen schon als Studenten oder Lernende eine feste Beziehung ein.
Vers 29 deckt sich mit dem neutestamentlichen Hinweis: «Vergeltet niemand Böses mit Bösem … Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden» (Römer 12,17.18).
Die Verse 30-34 illustrieren die Folgen der Faulheit. Das Bild, das der Schreiber sieht und von dem er praktische Unterweisung empfängt, lässt sich auch auf geistliche Trägheit übertragen. Wenn wir in unserem Glaubensleben oder im Dienst für den Herrn träge und nachlässig werden, trägt unser Leben bald keine Frucht mehr für den Herrn. Zudem werden wir innerlich verarmen. Aber so weit wollen wir es nicht kommen lassen!
Weiser Umgang mit Worten
Die Kapitel 25 bis 29 bilden einen weiteren Teil des Buchs der Sprüche. Diese Sprüche Salomos wurden erst zur Zeit von König Hiskia zusammengetragen. Doch auch sie gehören zum inspirierten Wort Gottes.
Der zweite Vers lässt uns an 1. Korinther 2,9 denken: «Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz aufgekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.» Wir als seine geliebten Kinder dürfen uns mit Königen vergleichen. Seit unserer Bekehrung besitzen wir den Heiligen Geist, durch den wir das erforschen können, was Gott uns offenbart hat.
Die Verse 6 und 7 ermahnen zur Demut. Auch der Herr Jesus fordert mit ähnlichen Worten zur Bescheidenheit auf (Lukas 14,7-11). Er, der auf der Erde immer den letzten Platz einnahm, ist uns darin das grosse Vorbild.
Wenn es um das Bestehen auf den eigenen Rechten geht, ist es immer gut, zurückhaltend zu sein (Sprüche 25,8-10). In 1. Korinther 6,7 geht der Apostel sogar noch einen Schritt weiter. Er fragt dort: «Warum lasst ihr euch nicht lieber unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen?»
Durch die Illustrationen werden die Aussagen der Verse 11-15 so deutlich gemacht, dass sie nicht weiter erklärt werden müssen. Trotzdem bleibt ihre Verwirklichung schwierig. Sagen wir immer das richtige Wort zur rechten Zeit? Ist unser Tadel so weise, dass der andere sich nicht davor verschliesst? Sind wir treue Boten, die das Herz unseres Herrn erquicken?
Taktloses oder diszipliniertes Verhalten
Die Verse 16 und 17 sagen Ähnliches aus. Es geht um das Masshalten in verschiedener Beziehung. Auch wenn wir etwas Schönes oder Gutes geniessen, sollte dies mit Mass geschehen. Und der Kontakt mit dem Nächsten sollte nicht übertrieben werden. Ein freundschaftliches Verhältnis könnte schnell ins Gegenteil umschlagen. Vergessen wir nicht, dass dies eine Empfehlung der göttlichen Weisheit ist, und beachten wir sie!
Wie soll unser Verhalten zu den Menschen sein? Das zeigen uns die Verse 18-24. Sie warnen zunächst vor dem, der falsches Zeugnis ablegt, und vor solchen, die unser Vertrauen nicht verdienen. Aber sie zeigen auch, wie schnell wir andere verletzen können: Wenn wir einem traurigen Herzen sagen: «Es ist nicht so schlimm!» und ihm ein Lied singen. Hingegen wird es nie umsonst sein, wenn wir jemand, der gegen uns ist, Liebe und praktische Hilfe erweisen.
Bei der guten Nachricht aus fernem Land (Vers 25) denken wir an das Evangelium, das vom Himmel gekommen und bis zu uns gelangt ist. Welch eine Freude für jeden betrübten Sünder, der die Botschaft, dass Jesus Christus auch für seine Sünden gestorben ist, im Glauben erfasst und Frieden mit Gott bekommt!
Wenn aber unser Leben als Christen zu wünschen übrig lässt, wird unser Zeugnis gegenüber den Ungläubigen beeinträchtigt. Das Evangelium ist dann kein frisches Wasser mehr, sondern ein durch uns getrübter Quell (Vers 26).
Der Narr
In den Versen des heute gelesenen Abschnitts geht es um die Toren oder Narren. Was sind das für Menschen? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Wenn die Bibel von Toren spricht, meint sie nicht Menschen mit einer geistigen Behinderung. Im Buch der Sprüche werden all jene als Toren bezeichnet, die sich von der göttlichen Weisheit weder zurechtweisen noch belehren lassen. Oft ist ihnen ihr Zustand gar nicht bewusst, weil sie zu sehr von sich überzeugt sind (Vers 12).
Die Verse 4 und 5 widersprechen sich in keiner Weise. Sie zeigen vielmehr, dass wir uns mit unbelehrbaren Menschen, die Gott ablehnen, nicht in eine Diskussion einlassen sollten. Wir würden uns auf ihre Linie stellen. Hingegen können wir ihnen einfach das Wort Gottes entgegenhalten und damit zeigen, dass für uns nicht menschliche Weisheit, sondern die Bibel massgebend ist.
Wer sich mit Menschen näher einlässt, die von der Bibel als Toren bezeichnet werden, kann unangenehme, wenn nicht sogar ernste Folgen ernten. Wir wollen daher die Verse 6-10 nicht leichtfertig überlesen, sondern zu Herzen nehmen.
Der elfte Vers wird in 2. Petrus 2,22 zitiert, um das Verhalten der ungläubigen Menschen zu illustrieren, die sich nicht wirklich bekehrt, sondern nur äusserlich verändert haben. Trotz ihres frommen Anstrichs werden sie immer noch von den gleichen sündigen Wünschen angetrieben. Auch ein gut erzogener Hund behält seine ureigenen Leidenschaften.
Der Faule und der Streitsüchtige
Der Faule hat immer eine Ausrede, um seine mangelnde Aktivität zu entschuldigen. Alles ist ihm zu viel und zu beschwerlich. Um das Mass voll zu machen, glaubt er denen nicht, die versuchen, ihm seine verkehrte Haltung aufzuzeigen (Sprüche 26,13-16).
Die Aussage von Vers 17 ist deutlich genug: Verwickle dich nicht in Streitigkeiten, die dich nichts angehen! – Ohrenbläser sind Menschen, die etwas im Geheimen oder unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit weitersagen. Dadurch schüren sie den Zank. Leider gibt es auch immer solche, die für geheimnisvolle Mitteilungen ein offenes Ohr haben (Sprüche 26,20-22).
Die Lippen und was sie reden, können täuschen. So hat Judas Iskariot seinen Meister mit dem Kuss eines Freundes an seine Feinde verraten. Und wie mancher hat sein trügerisches Inneres mit schönen und schmeichelnden Worten verborgen. Doch einmal wird alles ans Licht kommen, spätestens am Tag des Gerichts, wenn jeder von uns vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden muss. Dann wird jeder für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen müssen (Vers 26; Römer 14,10-12; 2. Korinther 5,10).
Haman im Buch Esther ist eine eindrückliche Illustration von Vers 27. Das Böse, das er plante und Mordokai zufügen wollte, hat ihn selbst getroffen. Schliesslich wurde er an seinen eigenen Galgen gehängt, den er für einen anderen aufgestellt hatte (Esther 7,10).
Egoismus oder Zuneigung
Keiner von uns weiss, was der morgige Tag mit sich bringt (Vers 1). Deshalb wollen wir bei unseren Zukunftsplänen vorsichtig sein und sagen: «Wenn der Herr will und wir leben, so werden wir auch dieses oder jenes tun» (Jakobus 4,15).
Warum ist Eifersucht schlimmer als Grimm und Zorn? Weil Zorn und Grimm sich nach einem Ausbruch wieder legen können, während die Eifersucht nie befriedigt ist (Vers 4).
Die Verse 5 und 6 beweisen, dass es Lebenssituationen gibt, wo eine Korrektur nötig wird. Keiner von uns ist fehlerfrei. Die Frage ist nur: Wie sieht unsere Korrektur, unsere Ermahnung oder unser Tadel aus? Handeln wir von oben herab oder in Abhängigkeit vom Herrn und in echter Liebe zum Nächsten (Galater 6,1)?
In Vers 8 geht es um einen Mann, der sich ungewollt weit weg von seinem Wohnort aufhält. Er sehnt sich nach Hause. Als Glaubende leben wir heute in einer Welt, die für uns ein fremdes Land ist. Unsere Heimat ist droben im Vaterhaus. Wir sind Himmelsbürger, auch wenn wir noch auf der Erde leben (Philipper 3,20.21).
Vers 12 erinnert uns an das Gericht, das der Welt bevorsteht. Die Klugen stellen die Glaubenden dar. Sie haben ihre Zuflucht zum Erlöser Jesus Christus genommen. Nun gilt ihnen das Wort des Herrn in Offenbarung 3,10: «Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung.» Vor Beginn der Gerichte wird der Herr Jesus wiederkommen und all die Seinen zu sich nehmen. Die Ungläubigen aber werden nicht entkommen.
Weises Verhalten und weise Vorsorge
Aus Vers 14 wollen wir lernen, dass es nicht nur darauf ankommt, was man sagt. Ebenso wichtig ist, wann und wie man sich äussert. Wie leicht vergessen wir dies!
Die Verse 15 und 16 zeigen, dass eine zänkische Person nicht aufgehalten werden kann. Man kann es ihr nie recht machen. Immer findet sie einen Grund zum Streiten.
In Vers 17 geht es nicht nur um das Angesicht eines Mannes, sondern um seinen ganzen Charakter. Er wird durch den Kontakt mit anderen geformt. «Eisen wird scharf durch Eisen.» Für uns Gläubige bedeutet dies, dass wir die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten suchen sollen, denn dadurch werden wir zum Guten beeinflusst.
Wenn andere uns rühmen oder loben, bedeutet das eine Prüfung für uns. Wie gehen wir damit um? Werden wir dadurch hochmütig oder bleiben wir demütig und bescheiden (Vers 21)?
Die Verse 23-27 beziehen sich auf einen guten und aufmerksamen Hirten. Er kümmert sich um das Wohl seiner Herde. Als Folge davon werden er und seine Familie zu Wohlstand kommen.
Das Gleiche gilt in geistlicher Hinsicht. Wenn die älteren Christen sich vom Herrn gebrauchen lassen und sich um die jüngeren Gläubigen kümmern, wird es der ganzen Familie Gottes gut gehen. Dabei ist es wichtig, dass Jung und Alt entsprechend ihrer geistlichen Bedürfnisse genährt werden. Dann wird niemand Mangel leiden. Alle werden vom geistlichen Wohlstand profitieren.
Unsere Einstellung zum Gesetz
Der erste Vers zeigt einerseits etwas von der Unruhe und Unsicherheit der ungläubigen Menschen und anderseits die Ruhe und Sicherheit, die der Glaubende in seinem Gott findet. Alle, die ihr Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt haben, stehen auf der Seite des Stärkeren und wissen: Er hält alles in seiner Hand (Hebräer 1,3).
Vers 2 hat sich in der Geschichte Israels bewahrheitet. Ein gottesfürchtiger König wie z.B. David gab dem Land Sicherheit und Bestand. Als jedoch im Zehnstämme-Reich der Götzendienst überhandnahm, gab es eine Zeit, in der verschiedene Könige nacheinander an die Macht kamen – meistens gewaltsam (2. Könige 15).
Gott möchte nicht, dass wir auf unrechtmässige Weise reich werden (Sprüche 28,6.8). Er warnt uns auch vor dem Betrug des Reichtums (Vers 11).
Das Gebet ist untrennbar mit dem Hören auf das Wort Gottes und dem Befolgen seiner Anweisungen verbunden. Unmöglich kann Gott auf das Gebet eines Menschen reagieren, der sein Wort in den Wind schlägt (Vers 9).
Die in Vers 13 enthaltenen Grundsätze gelten für alle Zeiten. David beschreibt in Psalm 32,3.4, wie schlimm es ihm ergangen war, als er seine Übertretungen verbergen wollte. Auch der gläubige Christ, der in eine Sünde fällt, kann nur durch ein aufrichtiges Bekenntnis wieder mit seinem himmlischen Vater ins Reine kommen (1. Johannes 1,9). Das Bekennen ist wichtig, aber ebenso nötig ist das Meiden der Gefahren, die zur Sünde geführt haben, sonst wiederholt sie sich.
Unsere Einstellung zum Besitz
In Vers 14 geht es nicht um menschliche Angst, sondern um Gottesfurcht, d.h. um die Furcht, etwas zu tun, was Gott missfällt. – Die Verse 15 und 16a haben sich in der Geschichte der Völker wiederholt bewahrheitet. Wie mancher korrupte Herrscher hat sein Land in die Armut getrieben.
Der erste Mensch, auf den Vers 17 angewandt werden kann, ist Kain. Er sagte zum Herrn, dass er unstet und flüchtig sein werde auf der Erde (1. Mose 4,14). Gibt es für einen Mörder keine andere Aussicht? Doch! Wenn er seine Sünden bekennt, zum Erlöser Jesus Christus Zuflucht nimmt und an sein vollbrachtes Erlösungswerk glaubt, wird ihm Gott auch das schlimmste Vergehen vergeben (Jesaja 1,18).
Kann man auf zwei Wegen gehen (Sprüche 28,6.18)? Der Herr Jesus sagte einst: «Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon» (Lukas 16,13). Der Prophet Elia fragte das Volk Israel: «Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten?» (1. Könige 18,21). Wir Christen wollen manchmal mit dem Herrn und mit der Welt gehen. Doch das funktioniert nicht (2. Korinther 6,14-18)!
Die Verse 20, 22 und 25 zeigen etwas von den Folgen der Habsucht. Lasst uns auf den Herrn vertrauen! Er wird uns das zum Leben Nötige schenken. Weil Er immer mehr gibt als nur das Minimum, können wir auch denen weitergeben, die weniger oder nichts haben (Vers 27). – Gott will, dass wir die Eltern ehren und sie wenn nötig unterstützen (1. Timotheus 5,8). Wer das Gegenteil tut und sie beraubt, ist ein Genosse des Verderbers (Vers 24).
Der schädliche Einfluss des Gottlosen
Wir können Vers 1 sicher auch auf das Evangelium anwenden. Für den, der das Angebot der Rettung durch den Erlöser Jesus Christus immer wieder zurückweist, kann es einmal plötzlich zu spät sein.
Der dritte Vers hat sich in Lukas 15 bewahrheitet, aber in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst richtete der Sohn durch ein ausschweifendes Leben das Vermögen zu Grunde. Doch nachdem er mit einem aufrichtigen Schuldbekenntnis nach Hause zurückgekehrt war, freute das den Vater zutiefst (Lukas 15,13.24).
Wenn uns geschmeichelt wird, weckt dies unseren Hochmut. Doch das ist gerade das Netz, durch das wir zu Fall kommen können (Vers 5; Sprüche 16,18).
In den Versen 6-11 ist wiederholt von den Gerechten oder Weisen die Rede. Das sind gläubige Menschen, die ihr Leben nach den göttlich weisen Anordnungen der Bibel führen möchten. Sie und ihr Verhalten stehen im Gegensatz zu den ungläubigen Menschen, die leben, ohne nach Gott und seinen Ansprüchen zu fragen. Wie gross ist doch der Unterschied zwischen einem Leben des Glaubens und des Gottvertrauens und einem Leben des Unglaubens und des Eigenwillens!
Vers 12 zeigt die Verantwortung, die eine Autoritätsperson hat. Ihr Verhalten wirkt sich auf ihre Untergebenen aus.
Im Zusammenleben der Menschen in dieser Welt gibt es soziale Unterschiede (der Arme, der Bedrücker). Doch vor Gott und seinem Licht verschwinden diese Differenzen.
Wie reagieren wir auf Zurechtweisung?
Die Obrigkeit – in Vers 14 im Bild des Königs – ist verantwortlich, gerecht zu handeln. Wenn sie es tut, wird Gott als höchste Instanz dafür sorgen, dass eine solche Regierung Bestand hat.
Die Erziehung der Kinder verlangt von den Eltern vollen Einsatz. Wenn wir diese Aufgabe nicht ernst genug nehmen oder sie sogar vernachlässigen, wird dies für uns und unsere Kinder böse Folgen haben (Sprüche 29,15.17).
Vers 20 erinnert an Sprüche 15,28 und an Jakobus 1,19. Haben wir nicht alle mehr oder weniger Probleme damit, dass wir in unseren Worten zu hastig sind? Der Herr kann uns helfen, zuerst zu überlegen und erst dann zu antworten.
Stolz kommt aus unserer alten Natur und wird immer negative Folgen haben (Vers 23). Wahre Demut aber lernen wir bei unserem Herrn, der von sich sagen konnte: «Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig» (Matthäus 11,29; Philipper 2,3.4).
Manche Gläubige haben Mühe mit der Menschenfurcht (Vers 25). Wie können wir sie überwinden? Nur durch ein festes Vertrauen in unseren Herrn. Er will uns Kraft zu einem treuen und klaren Zeugnis geben, ohne uns vor den möglichen Konsequenzen zu fürchten. Aus eigener Kraft werden wir dies nie schaffen.
Wir wollen unsere Hilfe nicht von Menschen, sondern vom Herrn erwarten (Vers 26).
Vers 27 zeigt zum Schluss noch einmal den grossen, unüberbrückbaren Unterschied zwischen einem Glaubenden und einem Ungläubigen auf.
Die Worte Agurs (1)
Wir wissen nicht, wer Agur war, der die Worte in diesem Kapitel unter der Leitung des Heiligen Geistes ausgesprochen hat (Vers 1). Aber Gott hat dafür gesorgt, dass es den Sprüchen von Salomo hinzugefügt wurde.
Die Aussagen Agurs zeugen von der göttlichen Weisheit, die er besass. Er selbst aber bezeichnet sich in aller Demut als einer, der nichts weiss. In Vers 4 stellt er einige Fragen über die Grösse und Allmacht Gottes. Wie nötig haben wir es, über die Majestät unseres Schöpfers nachzudenken, um demütig zu bleiben! Ähnlich wie in Psalm 2,7 finden wir am Schluss von Vers 4 bereits einen Hinweis auf den Sohn Gottes. Die eigentliche Offenbarung des ewigen Sohnes Gottes finden wir jedoch erst im Neuen Testament, wo auch von seiner Menschwerdung berichtet wird (Johannes 1,1.14.18).
Der grosse Gott hat sich uns Menschen durch sein geschriebenes Wort offenbart. Die Bibel ist die Wahrheit. Sie gibt uns Antwort auf die Fragen, die wir Menschen haben. Die wörtlich inspirierte Heilige Schrift ist zugleich Autorität, unter die wir uns zu beugen haben (Vers 6; vergleiche 5. Mose 4,2; 13,1; Offenbarung 22,18.19). Sie ist das felsenfeste Fundament unseres Glaubens.
Agur erkannte die Gefahren sowohl der Armut als auch des Reichtums. Darum bat er Gott aufrichtig, ihn vor beidem zu bewahren. Er wollte mit dem zufrieden sein, was Gott ihm zugedacht hat, und ganz von Ihm abhängig bleiben. Ist das auch unser Wunsch?
Die Worte Agurs (2)
Was ist das für ein Geschlecht, das Agur in den Versen 11-14 beschreibt? Es sind die ungläubigen und gottlosen Menschen. Sie lehnen sich gegen die von Gott gegebenen Autoritäten auf, sind selbstgerecht, stolz und gewalttätig, vor allem gegenüber den Schwächeren.
Der Schreiber dieser Verse war ein guter Naturbeobachter. Aus dem, was er sah, zog er Lehren für sein Leben. So beschreibt er anhand verschiedener Beispiele die Unersättlichkeit des natürlichen Menschen, ja, unseres eigenen Herzens. Wahre Befriedigung findet der Mensch nur beim Herrn Jesus. Bei Ihm kommt das Herz zur Ruhe (Matthäus 11,28).
Wie ernst sind die Verse 11 und 17! Sie stehen im Gegensatz zum fünften Gebot, das im Neuen Testament bestätigt wird: «Ehre deinen Vater und deine Mutter» (Epheser 6,2).
In den Versen 18 und 19 beschreibt Agur vier Wege, die nicht nachvollziehbar sind. Vom Flug eines Adlers, vom Weg einer Schlange auf dem Felsen und von der Fahrt eines Schiffes im Wasser bleibt nichts Sichtbares zurück. Ähnlich unerklärlich ist der Weg, den Gott einen gläubigen Mann führen möchte, wenn Er ihm die Frau nach seinem Plan schenken will. Gott macht es mit jedem Paar wieder anders. Keine zwei Lebenswege sind identisch. Wenn wir dem Herrn vertrauen und wirklich von Ihm abhängig bleiben, werden wir sehen, wie wunderbar Er einen Mann und eine Frau, die Er füreinander bestimmt hat, zusammenführt.
Die Worte Agurs (3)
In den Versen 21-23 werden vier Tatsachen erwähnt, unter denen «die Erde zittert». Wenn wir die aufgeführten Beispiele näher ansehen, geht es eigentlich darum, dass das Normale auf den Kopf gestellt wird. In der Anwendung für uns können wir sagen: Wenn der Mensch die Schöpfungsordnung nicht mehr respektieren will und alles umkehrt, werden tragische Folgen nicht ausbleiben.
Welche geistliche Bedeutung können wir aus den Versen 24-28 ableiten? Die Kleinen der Erde, die aber weise sind, geben ein Bild der Glaubenden ab. Sie gelten in der Welt nicht viel, sind oft verachtet und werden manchmal sogar verfolgt. Aber sie sind in die Gedanken Gottes eingeweiht. Durch den Herrn und den Heiligen Geist besitzen sie göttliche Weisheit (1. Korinther 1,30; 2,12-16).
- Die Ameisen: Als Gläubige leben wir nicht gedankenlos in den Tag hinein, sondern denken an die Zukunft.
- Die Klippdachse: Wir setzen unser Vertrauen auf den Herrn und sein Wort.
- Die Heuschrecken: Wir Christen haben keinen sichtbaren Führer, aber unter der Leitung des Heiligen Geistes dürfen wir gemeinsam den Weg des Glaubens in Ordnung und Frieden gehen.
- Die Eidechse: Wir sind an sich schwach und schutzlos. Aber wir haben eine Glaubensbeziehung zu Christus, der einmal als König der Könige herrschen wird – und wir mit Ihm.
Die Verse 29-31 lassen uns an den Herrn Jesus denken, wie Er als Mensch entschieden durch allen Widerstand hindurch nach Golgatha gegangen ist.
Die Worte Lemuels
Das letzte Kapitel der Sprüche enthält die Worte des Königs Lemuel. Wir wissen nicht, wer dieser Lemuel war, denn kein König von Israel oder Juda trug diesen Namen. Vielleicht war er ein Mann aus den Nationen wie Melchisedek, der König von Salem (1. Mose 14,18-20).
In den Versen 2-9 gibt Lemuel die weisen Worte weiter, mit denen seine Mutter ihn unterwiesen hat. Zuerst warnt sie ihren Sohn vor zwei Gefahren: vor sexueller Zügellosigkeit und vor Drogenmissbrauch. Diese Gefahren drohen heute auch unseren Kindern. Haben wir sie genügend davor gewarnt?
Wenn wir nach der geistlichen Bedeutung dieser Verse fragen, dann sind sie eine Warnung an alle Glaubenden. Wir sollen uns vor den Verführungen der Welt, die unsere fleischlichen Begierden ansprechen, in Acht nehmen, und in allem nüchtern bleiben (2. Timotheus 4,5), damit unser geistliches Urteilsvermögen nicht beeinträchtigt wird.
In den Versen 8 und 9 ruft die Mutter Lemuels ihren Sohn auf, als König barmherzig zu handeln. Weil er als Regent die Möglichkeit hat, den Benachteiligten zu helfen, soll er es auch tun. – Und wir? Wir werden an Jakobus 1,27 erinnert, wo uns echte Glaubenspraxis vorgestellt wird:
- Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen,
- sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten.
Die tüchtige Frau (1)
Das Buch der Sprüche schliesst mit der Beschreibung einer gottesfürchtigen Frau. Sie ist die Ehefrau eines ebenfalls gottesfürchtigen Mannes, der aber nur nebenbei erwähnt wird. Ihr ganzes Verhalten ist nicht von menschlicher, sondern von göttlicher Weisheit geprägt, wie wir sie in diesem Buch immer wieder gefunden haben.
Wenn wir uns fragen, was der Nutzen eines solchen Abschnitts für uns Christen ist, dann gibt es sicher verschiedene Antworten. Zunächst bekommt jede gläubige Ehefrau aus diesen Versen praktische Hinweise für ihr eigenes Leben. Weiter können wir die Worte auch geistlich auf uns als Gläubige übertragen, die ein Leben des Fleisses und der Treue für unseren Herrn führen möchten. Vielleicht dürfen wir in dieser tüchtigen Frau auch einen Hinweis auf die Versammlung – d.h. die Gesamtheit der Erlösten der Gnadenzeit – sehen, die im Neuen Testament als die Braut oder Frau von Christus gesehen wird.
Wir sind beeindruckt vom Eifer dieser Frau und vom Einsatz, den sie in ihrem häuslichen Bereich an den Tag legt. Sie beschämt uns sowohl in praktischer als auch in geistlicher Hinsicht. Doch wir wollen von ihr lernen und uns mit der Hilfe unseres Herrn an dem Platz, wo Er uns hingestellt hat, voll einsetzen und unsere Aufgaben treu erfüllen. Unsere Hingabe wird sein Herz erfreuen.
Die tüchtige Frau (2)
Aus diesem Abschnitt wollen wir einige praktische Hinweise für die gläubige Ehefrau in ihrem Tätigkeitsbereich herausgreifen:
- In Vers 20 sehen wir, wie sie nicht nur an ihr eigenes Haus und ihre Familie denkt. Sie hilft auch solchen, die nicht zu ihrem Kreis gehören, aber elend und arm sind. – Haben wir auch offene Augen und eine gebende Hand für die Nöte anderer, oder denken wir nur an uns?
- Viele Verse dieses Abschnitts beschreiben die fleissige Tätigkeit dieser Frau. Doch in Vers 26 geht es um ihren Mund. Jede Hausfrau und Mutter sollte auch einmal die Hände ruhen lassen und Zeit finden, sich mit ihren Kindern zu unterhalten, auf ihre Fragen und Probleme einzugehen, und dann eine mütterliche Antwort geben.
- Vers 27 zeigt, wo die Hauptverantwortung einer Ehefrau und Mutter liegt: in ihrem Haus. Da überwacht sie die Vorgänge. Sie weiss z.B. was im Leben ihrer Kinder vorgeht, was für Kontakte diese haben, was sie lesen oder sich ansehen. Sind die Kinder einmal erwachsen, werden sie dankbar sein, eine solche Mutter und ein solches Zuhause gehabt zu haben (Vers 28).
- Wie wichtig ist Vers 30! Sicher möchte jede Frau gern schön und anziehend sein. Doch viel wichtiger als äussere Schönheit ist die Gottesfurcht. «Eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie wird gepriesen werden.»
Einleitung
Nachdem der Apostel Paulus den ersten Brief an die Versammlung in Korinth geschrieben hatte, sandte er zuerst Timotheus und dann Titus nach Korinth.
- Timotheus sollte feststellen, wie die Gläubigen dort den ernsten und korrigierenden Brief aufgenommen hatten.
- Titus hatte den Auftrag, die weitere geistliche Entwicklung der Versammlung in Korinth zu beobachten.
Als der Apostel von Titus einen vorwiegend guten Bericht über die Korinther bekam, konnte er Gott dafür danken. In der Folge schrieb Paulus den zweiten Brief, um ihnen auf dem guten Weg weiterzuhelfen.
Im zweiten Korinther-Brief stellt der Apostel seinen Dienst vor. Er zeigt auch, wie ein Christ, der in Sünde gefallen ist, wiederhergestellt wird. Dann gibt er Anweisungen über das Verwalten der materiellen Gaben. Schliesslich muss er sein Apostelamt gegen ungerechtfertigte Angriffe verteidigen.
Trost von Gott
Der zweite Brief des Apostels Paulus an die Korinther ist kein eigentlicher Lehrbrief wie der erste. Er enthält neben den wenigen belehrenden Abschnitten viele Passagen, in denen die persönlichen Empfindungen von Paulus zum Ausdruck kommen. Wir finden darin die inneren Motive seines Dienstes für seinen Herrn und sein Wunsch nach völliger Wiederherstellung der Herzensgemeinschaft mit den Korinthern. Die Worte «Dienst», «Trost» und «trösten» kommen in diesem Brief besonders häufig vor.
In Vers 3 beginnt der Schreiber mit einem Lobpreis gegenüber unserem Gott und Vater. In seinem Leben erfuhr der Apostel Paulus Leiden verschiedener Art. Von Heiden und ungläubigen Juden wurde er immer wieder verfolgt. Er litt als ein Nachfolger des verachteten Jesus von Nazareth und er litt, weil er eine Botschaft verkündigte, die alle Menschen auf die gleiche Stufe vor Gott stellte – als verlorene Sünder –, aber allen die wunderbare Errettung in Jesus Christus vorstellte.
Besondere innere Nöte bereitete ihm der Zustand der Korinther. Wie sehr hoffte er auf eine Wendung zum Besseren. Die Nachricht von Titus war ihm ein grosser Trost (2. Korinther 7,6-9).
Gott selbst tröstete seinen Apostel. Was er von Gott empfing, befähigte ihn, andere zu trösten. Das gilt auch für uns. Wenn wir die Liebe und das Erbarmen Gottes in unseren Lebenssituationen erfahren haben, dürfen wir anderen davon erzählen. – Paulus hoffte, dass die Korinther ähnliche Erfahrungen mit dem Trost Gottes machen würden, wie er sie selbst erlebte.
Grosse Bedrängnis
Mit der Bedrängnis, die dem Apostel und seinen Mitarbeitern in Asien widerfahren war, meinte er den Widerstand und die Verfolgung in Ephesus (Apostelgeschichte 19). Es ging damals um Leben und Tod. Sie meinten, nicht lebend aus diesem Tumult herauszukommen.
Auch andere Knechte des Herrn kamen in so grosse Nöte, dass sie am Leben verzweifelten (Elia: 1. Könige 19,1-4; Jeremia: Jeremia 20,14-18). Aber einer, der es schwerer hatte als alle Übrigen, verzweifelte nicht am Leben, sondern unterwarf sich mit einem «Ja, Vater» in allem dem Willen seines Gottes: unser Herr und Heiland!
Gott hielt seinen Knecht Paulus aufrecht. Er wurde nicht beschämt, sondern konnte sowohl von einer hinter ihm liegenden Errettung Gottes als auch von einer gegenwärtigen und einer zukünftigen schreiben. Er freute sich, dass auch die Korinther für ihn gebetet hatten. Wie wichtig ist die Fürbitte für die Diener des Herrn! Eine Aufgabe für dich und für mich!
Warum erwähnt der Apostel ab Vers 12 sein Verhalten und die Weise, wie er bei den Korinthern gelebt hatte? Was er ihnen schrieb, war nichts anderes, als was sie von ihm wussten. Es waren falsche Propheten und falsche Apostel nach Korinth gekommen, die durch unwahre Aussagen das Vertrauen der Korinther in den Apostel Paulus untergraben hatten. Die Folge war, dass er von den Briefempfängern nur noch zum Teil anerkannt wurde.
Gott ist treu
Paulus hatte vor, einen zweiten Besuch in Korinth zu machen. Doch es kam anders. Wenn er in jenem Moment gegangen wäre, hätte er bei ihnen in der Autorität als Apostel auftreten müssen. Doch er wollte sie schonen. Konnte man ihn deswegen als wankelmütig bezeichnen, der einmal so und dann wieder anders entscheidet? Sicher nicht! Indem Gott alles lenkte, schenkte Er uns diesen Brief als Teil seines inspirierten Wortes.
Die Menschen mochten Paulus angreifen. Aber das, was er zusammen mit Silvanus und Timotheus den Korinthern gepredigt hatte, war das unveränderliche Wort Gottes. Es war die Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der nie ein Wort richtigstellen und nie eine Entscheidung rückgängig machen musste. In Ihm ist alles Ja. So ist es auch mit den Verheissungen Gottes. Sie sind uns im Herrn Jesus gesichert.
Die Verse 21 und 22 enthalten drei Wahrheiten im Blick auf den Heiligen Geist, der in jedem Gläubigen wohnt:
- Wir sind mit dem Heiligen Geist gesalbt. Das befähigt uns, das aufzunehmen und zu verstehen, was von Gott kommt (1. Johannes 2,20).
- Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist der Stempel, den Gott auf jeden Glaubenden drückt und damit bestätigt, dass er sein Eigentum ist.
- Wir besitzen den Heiligen Geist als Unterpfand. Er ist die sichere Garantie für alles, was wir heute noch nicht besitzen, aber in der Zukunft empfangen werden. Über diese zukünftige Herrlichkeit dürfen wir uns heute schon freuen.
Vergeben
Jetzt kommt der Apostel auf seinen ersten Brief an die Korinther zu sprechen. Er hatte nicht leichtfertig geschrieben (Vers 4). Es war vielmehr die Liebe zu den Korinthern, die ihn bewogen hatte, in allem Ernst über die in Korinth vorgefallenen Sünden zu schreiben. Sein Ziel war eine völlige Wiederherstellung, damit er sich wieder ungetrübt mit den Korinthern freuen konnte. Aber so weit war es scheinbar noch nicht.
Ab Vers 5 spricht Paulus von dem Mann, der wegen Hurerei von der Gemeinschaft am Tisch des Herrn ausgeschlossen werden musste (1. Korinther 5). In dieser Hinsicht war der erste Brief nicht ohne Wirkung geblieben. Die Korinther, die vorher das Böse in ihrer Mitte geduldet hatten, hatten nun als Versammlung gehandelt. Das ist «die Strafe, die von den Vielen ist». Sie war nicht vergeblich gewesen, sie hatte ihr Ziel erreicht. Der Fehlbare hatte sich wirklich gebeugt. Nun war es an der Versammlung, dem Ausgeschlossenen gegenüber Liebe zu erweisen, damit er nicht durch übermässige Traurigkeit in die Verzweiflung getrieben wurde. Wenn die Korinther dem Mann vergeben würden, wollte auch Paulus ihm vergeben.
Vers 11 zeigt, dass der Teufel im Angriff auf die Gläubigen zwei Taktiken anwendet. Die eine ist Gleichgültigkeit gegenüber dem Bösen. Damit hatte er in 1. Korinther 5 Erfolg. Die zweite ist Herzenshärte gegenüber echter Betrübnis und Buße. Hüten wir uns auch vor dieser Schlinge des Teufels!
Der Triumph Gottes
Auf dem Weg von Ephesus nach Mazedonien machte der Apostel Paulus in Troas Halt, wo er eine vom Herrn geöffnete Tür für das Evangelium vorfand. Warum blieb er nicht dort? Er war innerlich zu sehr beunruhigt, weil er Titus nicht fand, von dem er Nachricht aus Korinth erwartete. Er musste wissen, wie sie seinen ersten Brief aufgenommen hatten. So zog er weiter nach Mazedonien, wo er Titus schliesslich traf (2. Korinther 7,6.7).
Ab Vers 14 spricht Paulus von seinem Dienst, den er mit dem Triumphzug eines siegreichen römischen Feldherrn vergleicht. Dabei ist er selbst wie ein Weihrauchträger, die diese Triumphzüge begleiteten. In einem solchen Zug befanden sich Gefangene des besiegten Volkes. Die einen wurden begnadigt, andere getötet. Für die einen war der Weihrauchgeruch ein Geruch zum Leben, für die anderen ein Geruch zum Tod.
Im Dienst des Herrn verbreitete der Apostel Paulus überall, wohin er gelangte, das Evangelium der Gnade von Jesus Christus. Für alle, die die Botschaft und den Heiland im Glauben annahmen, war es «ein Geruch vom Leben zum Leben». Für die anderen aber, die es im Unglauben oder in Gleichgültigkeit ablehnten, war die gleiche Botschaft «ein Geruch vom Tod zum Tod». Sie gingen wegen des Unglaubens verloren.
Der letzte Vers ist eine weitere Antwort an solche, die ihm eine Verfälschung des Wortes Gottes unterschoben. Er gab nur das von Gott empfangene Wort weiter.
Ein Brief Christi
Weil es in Korinth Menschen gab, die sowohl das Apostelamt als auch den Dienst von Paulus infrage stellten, musste er von sich reden. Doch er brauchte sich bei ihnen nicht zu empfehlen. Die Korinther selbst waren sein «Brief». Durch seinen Dienst hatten sie sich bekehrt, und so war in jener Stadt durch die Wirkung des Heiligen Geistes eine Versammlung entstanden. Gemeinsam waren sie ein Brief Christi, der von allen Menschen gelesen wurde. Der Inhalt des Briefs war Christus. Paulus hatte den Namen des Herrn Jesus auf die Tafeln ihrer Herzen geschrieben. Es fragte sich nur, ob man diesen Namen noch lesen konnte oder ob er durch das ungeistliche Verhalten der Korinther weitgehend unleserlich geworden war.
Der Hinweis auf die Empfehlungsbriefe ist immer noch gültig. Damals und heute sollten Gläubige, die eine örtliche Versammlung aufsuchen, wo man sie nicht kennt, einen Empfehlungsbrief von ihrem Ort mitbringen. So wissen die Gläubigen, wenn ein Fremder kommt, dass er ein Bruder ist und von seiner «Heimatversammlung» zur vollen Gemeinschaft (am Tisch des Herrn) mit ihnen empfohlen wird.
In aller Demut und Abhängigkeit von Gott bekennt der Apostel, dass er nicht aus sich heraus tüchtig ist. Er setzt sein Vertrauen auf Gott, der ihn befähigt, den Dienst zu tun, zu dem Er ihn berufen hat. Die Verkündigung des Evangeliums und der Wahrheit über die Versammlung steht im Kontrast zur Gesetzgebung am Sinai: jetzt ein Dienst des Geistes, der lebendig macht – damals ein Dienst des Buchstabens, der tötet.
Die Herrlichkeit des Herrn anschauen
Die Verse 7-16 stehen in einer Klammer. In diesem Abschnitt zeigt der Apostel den grossen Unterschied zwischen dem Bund vom Sinai, der das Gesetz zur Grundlage und zum Inhalt hat, und dem Evangelium. Der alte Bund ist ein Dienst des Todes und ein Dienst der Verdammnis. Die Verkündigung des Evangeliums aber ist ein Dienst des Geistes und ein Dienst der Gerechtigkeit.
Die Einführung des Gesetzes geschah mit äusserer Herrlichkeit. Doch das Leuchten verschwand wieder vom Angesicht Moses. Die Wolke der Herrlichkeit verliess den Gipfel des Sinai. Weil das Gesetz vom Menschen Gerechtigkeit fordert, ihm aber keine Kraft gibt, so zu leben, wird es weggetan, um dem Evangelium der Gnade Platz zu machen.
Die Grundlage des Evangeliums ist der Opfertod von Jesus Christus am Kreuz. Weil unser Heiland alle Forderungen Gottes erfüllte und an unserer Stelle die gerechte Strafe Gottes auf sich genommen hat, kann Gott jetzt jedem Glaubenden vergeben und Gnade erweisen. Doch viele Juden ziehen bis heute das Gesetz dem Herrn Jesus vor. Sie sehen beim Lesen des Alten Testaments nicht, dass Christus alles erfüllt hat. Eine Decke liegt auf ihren Herzen.
Jeder aber, der das Evangelium im Glauben annimmt, empfängt von Gott neues Leben und den Heiligen Geist. So ist er fähig, Gott wohlgefällig zu leben. Mit aufgedecktem Angesicht sieht er die Herrlichkeit seines Erlösers. Das wird praktische Auswirkungen auf sein Leben haben. Er wird Ihm ähnlicher.
Das Evangelium der Herrlichkeit
In Kapitel 3 geht es um den Dienst, der dem Apostel Paulus anvertraut worden war. Er hat ihn als eine Gnade, als ein Geschenk vom Herrn empfangen. Jetzt stehen die Merkmale des Dieners vor uns.
Trotz des Widerstands, dem er da und dort begegnete, wurde er nicht mutlos. Stets bemühte er sich mit seinen Mitarbeitern um ein Leben der Gottesfurcht. Es sollte wirklich eine Empfehlung für die Wahrheit sein, die sie verkündeten. Im Gegensatz zu den falschen Lehrern, die ihre Botschaft oft zuerst im Geheimen weitersagen, mit Schlauheit vorgehen und das Wort Gottes verfälschen, war beim Apostel alles offen, ehrlich und durchsichtig.
Trotz der klaren Botschaft und ihres herrlichen Inhalts und trotz der Treue, in der diese Zeugen ihren Dienst taten, verschlossen sich viele Menschen dem Evangelium. Das ist heute noch so. Durch den Unglauben verblendet Satan, der Gott dieser Welt, den Sinn von vielen. Wer seinen Unglauben nicht aufgeben will, geht ewig verloren.
Glücklicherweise ist Gott immer noch am Werk, um Menschenherzen zu überführen, damit das Evangelium auch in ihre Herzen leuchtet. Dann werden durch den Unglauben verfinsterte Herzen dahin gebracht, sich dem Heiland zu öffnen. Wenn sie diese Botschaft, die Jesus Christus als Herrn zum Inhalt hat, annehmen, wird sich das nach aussen zeigen. Es strahlt etwas vom Herrn Jesus zurück.
Ein Schatz in irdenen Gefässen
Der Schatz ist das Evangelium der Herrlichkeit, dessen Inhalt Christus ist, der als Mensch Gott in allem offenbart hat. Er hat gezeigt, was Gott in sich ist: Licht und Liebe.
Das irdene Gefäss, in dem sich dieser Schatz befindet, ist der schwache Mensch, der diese Botschaft predigt. Paulus wusste, wie zerbrechlich er in sich selbst war. Den Dienst für seinen Herrn konnte er nur in der Kraft Gottes vollbringen.
Die Verse 8 und 9 zeigen etwas von den Nöten des Apostels, die er in seinem Dienst durchzumachen hatte. Doch die Hilfe des Herrn hielt ihn aufrecht.
Wann wird das Leben Jesu an uns offenbar? Wenn nicht mehr unser Ich, sondern der Wille Gottes zum Zug kommt. Im Leben unseres Herrn galt nur der Wille seines Gottes und Vaters. Er lebte stets zu Gottes Wohlgefallen. Wo endet ein solcher Weg der Selbstverleugnung? Nicht im Tod, sondern in der Auferstehung und in der Herrlichkeit bei und mit dem Herrn Jesus!
Die Schlussverse unseres Kapitels ermuntern jedes geprüfte Kind Gottes, von den Umständen weg auf die ewige Herrlichkeit zu blicken. Gerade beim Älterwerden spürt der Gläubige den Verfall des äusseren Menschen. Aber das neue Leben, das wir seit unserer Bekehrung besitzen, unser innerer Mensch, altert nicht. Und gemessen an der vor uns liegenden ewigen Herrlichkeit ist das jetzige Leben, das mühsam und schwer sein kann, schnell vorübergehend und leicht.
Die irdische Hütte, das himmlische Haus
Wenn der Apostel schreibt: «Wir wissen …», dann denkt er sicher an 1. Korinther 15. In jenem Kapitel hat er den gleichen Empfängern die leibliche Auferstehung der Gläubigen erklärt. Der Körper, den wir jetzt haben – er wird als irdisches Haus oder Hütte bezeichnet –, gehört zur ersten Schöpfung. Er ist noch nicht erlöst. Deshalb seufzen wir in diesem Körper (Römer 8,23). Doch wir wissen, dass wir einen Herrlichkeitsleib – einen Bau von Gott – bekommen werden. Er wird dem Leib unseres verherrlichten Erlösers gleichförmig sein (Philipper 3,21).
Nach dieser «Behausung» sehnen wir uns. Aber der Apostel erwartet nicht den Tod und die Auferstehung, sondern das Kommen des Herrn zur Entrückung. Dann wird der sterbliche Körper aller dann lebenden Gläubigen vom Leben verschlungen werden, d.h. in einen unsterblichen Herrlichkeitsleib verwandelt werden. Das ist die Hoffnung der Christen. Die Garantie dafür ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Wenn Christus kommt, werden alle gestorbenen Gläubigen mit einem Herrlichkeitsleib auferstehen und die dann lebenden werden verwandelt werden.
Heute halten wir das alles im Glauben fest. Wir sind noch nicht zum Schauen gelangt. Bis es soweit ist, hat jeder von uns eine Aufgabe an dem Platz zu erfüllen, wo der Herr ihn hingestellt hat. Solange Er uns hier lässt, beeifern wir uns, Ihm wohlgefällig zu leben. Am Richterstuhl des Christus wird unser Leben ins Licht Gottes gestellt werden. Dann wird der Herr all das belohnen, was seine Anerkennung findet.
Lasst euch versöhnen mit Gott!
Alle Menschen müssen einst vor dem Herrn Jesus als dem Richter erscheinen. Die Gläubigen werden offenbar (ins Licht Gottes gestellt), aber nicht gerichtet. Für die Ungläubigen hingegen wird die Begegnung schrecklich sein. Dieser Gedanke sollte uns anspornen, die Menschen, die noch unversöhnt mit Gott dahinleben, zu überreden, mit Gott ins Reine zu kommen. Aber nicht nur der Schrecken des göttlichen Gerichts, sondern auch die Liebe des Christus – seine Liebe zu den Verlorenen – drängt uns, diesen Dienst der Versöhnung zu tun.
Die Verse 11-13 handeln vom Verhältnis zwischen den Korinthern und dem Apostel. Er wollte sich nicht verteidigen. Durch seinen Dienst und sein Verhalten empfahl er sich jedem Gewissen der Menschen vor Gott.
Christus ist für alle gestorben, weil alle geistlich tot waren (Vers 14; Epheser 2,1). Aber sein Opfertod kommt nur denen zugut, die an Ihn glauben. Wer dieses Erlösungswerk für sich in Anspruch nimmt, dem öffnet sich ein ganz neues Leben. Er ist eine neue Schöpfung und lebt nicht mehr für sich selbst, sondern für seinen Heiland.
Gott kam in der Person des Herrn Jesus auf diese Erde und bot den Menschen die Versöhnung an. Doch als Antwort darauf kreuzigten sie Ihn, den Sohn Gottes. Aber Gott hat bis jetzt nicht aufgehört, den Menschen seine Gnade anzubieten. Wir dürfen diese Botschaft der Versöhnung weitersagen. Grundlage dafür ist der Tod Dessen, der Sünde nicht kannte, aber für uns zur Sünde gemacht worden und gestorben ist.
Der Tag des Heils
Im ersten Vers warnt der Apostel vor einem vergeblichen Empfangen der Gnade Gottes. Diese Ermahnung richtet sich einerseits an solche, die sich äusserlich zu den Gläubigen halten, aber selbst kein neues göttliches Leben besitzen. Sie haben die Gnade nur äusserlich, aber nicht im Herzen aufgenommen. Diese Warnung spricht auch Gläubige an, die sich weder konsequent von der Welt trennen, noch entschieden für den Herrn leben. In ihrem Leben hat die Gnade ihr Ziel noch nicht erreicht (Titus 2,11.12).
Das Verhalten und die Einstellung eines Dieners des Herrn beeinflussen seine Arbeit viel stärker als wir oft meinen. Paulus und seine Mitarbeiter bemühten sich, alles zu vermeiden, was sich negativ auf ihren Dienst ausgewirkt hätte.
In jeder Hinsicht erwiesen sie sich als Gottes Diener. In den schwierigen Umständen, die in den Versen 4 und 5 aufgezählt werden, bewiesen sie Ausharren und Geduld. Die Verse 6 und 7 erwähnen die moralischen Merkmale des Ausharrens dieser Knechte des Herrn.
In den Verse 8-10 nennt der Apostel eine Reihe paradoxer Zustände. Woher kommen diese Gegensätze? Wer seinem Herrn und Erlöser treu nachfolgt und nur für Ihn leben will, wird nicht von allen verstanden. Die einen sagen Gutes über ihn, die anderen behaupten das Gegenteil. Für die einen war Paulus ein Apostel des Herrn, für die anderen ein Verführer. Er erlebte viel Trauriges in seinem Dienst, aber die Freude am Herrn konnte ihm niemand nehmen.
Absonderung
Paulus war ein Mann mit weitem Herzen, weil er, abgesondert von der Welt, Christus zum Mittelpunkt hatte und mit Ihm in die Weite seiner Interessen eintrat. Die Korinther aber waren gegenüber dem Apostel zugeknöpft. Sie hielten ihre Zuneigungen zu ihm zurück. Wo lag die Ursache? Sie hatten sich von der Welt beeinflussen lassen. Der weltlich gesinnte Gläubige verengt sich auf seine eigenen selbstsüchtigen Interessen.
Paulus ermahnt die Korinther und auch uns, weit zu werden und zwar durch konsequente Absonderung von der Welt. Dabei geht es um ihre Ideen, ihre Institutionen, aber auch um die ungläubigen Menschen. Als Glaubende leben wir zwar noch in der Welt, aber wir gehören nicht mehr zu ihr (Johannes 17,11.15.16).
Das ungleiche Joch mit Ungläubigen bezieht sich z.B. auf die Ehe, eine Partnerschaft im Geschäft, die Mitgliedschaft einer politischen Partei oder eine Zusammenarbeit auf religiösem Gebiet. «Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis?» Keine! Wenn daher ein Gläubiger mit der Welt zusammen ihre Ziele verfolgt, gibt er unweigerlich den himmlischen Charakter des wahren Christentums auf.
Wer den Weg der Absonderung entschieden verfolgt, wird die Vertrautheit der praktischen Gemeinschaft mit Gott erfahren. Wenn wir uns klar von der Welt trennen, nimmt der grosse Gott uns auf. Unsere Beziehung zu Ihm gleicht dann der, die ein Vater mit seinen erwachsenen Kindern pflegt.
Das Herz des Dieners
Die Verheissung, dass Gott uns väterlich aufnehmen wird, wenn wir uns von der Welt absondern, sollte auch zu einer inneren Reinigung führen. Diese Reinigung umfasst jede Befleckung des Fleisches und des Geistes, d.h. der Gedanken. Lasst uns mehr nach praktischer Heiligkeit streben sowohl persönlich als auch gemeinschaftlich als Versammlung!
Die Gefahr besteht, dass wir uns nur äusserlich von der Welt trennen. Dann werden wir zu Heuchlern. Wenn wir uns nur innerlich vom Bösen trennen, aber äusserlich mit der Welt mitmachen, gleichen wir einem Lot, dessen Leben ohne Frucht für Gott blieb und sehr traurig endete.
Ab Vers 2 wird uns das Herz des Apostels gezeigt. Wie sehr schlug es für die Korinther und wie wünschte er, dass sich die abgekühlte Beziehung der Korinther zu ihm wieder erwärmte!
Vers 5 schliesst an 2. Korinther 2,13 an. In Mazedonien kamen zu den inneren Befürchtungen bezüglich der Korinther noch Kämpfe von aussen. Unter welch einem Druck spielte sich doch das Leben des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter ab! Aber Gott hatte seinen Diener nicht verlassen. Zur rechten Zeit erreichte ihn der göttliche Trost durch Titus. Dieser brachte ihm gute Nachricht aus Korinth. Der erste Brief des Apostels hatte bei den Empfängern eine positive Wirkung hervorgerufen. Jetzt konnte Paulus sich wieder von Herzen freuen.
Freude statt Traurigkeit
Der Apostel Paulus hatte den ersten Brief an die Korinther unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben. Doch als Mensch ging es ihm, wie es uns manchmal geht. Wir fragen uns, nachdem wir etwas für den Herrn getan haben: War es richtig? Hätten wir es vielleicht anders machen sollen? Gott kam Paulus zu Hilfe. Er wird auch uns nicht im Ungewissen lassen.
Nach dem Bericht von Titus war der Apostel beruhigt. Der Brief hatte eine Gott gemässe Betrübnis bewirkt. Die Korinther hatten über das bei ihnen vorgefallene Böse Buße getan und dagegen Stellung bezogen. Der Fehlbare wurde von der Gemeinschaft der Gläubigen am Tisch des Herrn ausgeschlossen. Durch ihre Betrübnis und ihr Handeln gegen das Böse zeigten sie, dass sie «an der Sache rein» waren.
Die Gott gemässe Buße steht im Gegensatz zur Betrübnis der Welt, bei der man nur über die Folgen der Sünde, über den entstandenen Schaden betrübt ist. Doch das bewirkt keine Buße zum Heil. Das sehen wir z.B. bei Esau (Hebräer 12,16.17).
Paulus hatte Titus manches Positive über die Korinther erzählt, obwohl der Abgesandte auch die in Korinth herrschenden Zustände gekannt haben musste. Zur Freude des Apostels durfte er nun erfahren, dass Titus durch das positive Verhalten der Korinther innerlich erquickt worden war. Dadurch wurden die Zuneigungen von Titus zu ihnen vertieft.
Die Gnade des Gebens
Mit diesem Kapitel schneidet der Apostel ein neues Thema an. Es geht um die materiellen Gaben, die in diesem Fall den bedürftigen Gläubigen in Jerusalem zugut kommen sollten. Über die Sammlungen hatte der Apostel schon im ersten Brief gesprochen (1. Korinther 16,1-4). In Hebräer 13,16 wird das materielle Opfer «Wohltun und Mitteilen» genannt, aber hier und im nächsten Kapitel bezeichnet der Apostel es als Gnade. Ja, es ist ein Vorrecht, das Werk des Herrn finanziell zu unterstützen und der materiellen Not unter den Gläubigen abzuhelfen.
Paulus stellt den Korinthern – und uns – die Versammlungen in Mazedonien als Vorbilder hin. Sie hatten keinen Überfluss, den sie hätten geben können. Doch obwohl sie sehr arm waren, gaben sie «über Vermögen», so dass der Apostel vom «Reichtum ihrer Freigebigkeit» schreiben konnte. Ihre aufopfernde Gesinnung, in der sie ihre Hände öffneten, finden wir in Vers 5: «Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn.» Sie betrachteten sich und alles, was sie besassen, als dem Herrn gehörend.
Die Korinther waren noch längst nicht so weit. Und wir? Titus wurde zu ihnen gesandt, um sie zu ermuntern, ihre Hände zum Geben zu öffnen. Sie waren in Glauben, Wort und Erkenntnis und in allem Fleiss überströmend. Aber bei der Ausübung praktischer Hilfeleistung haperte es bei ihnen. Nun bekamen sie die Gelegenheit, auch darin überströmend zu werden. Doch Paulus wollte sie zu nichts zwingen. Die Liebe sollte ihre Hände öffnen.
Ein Appell an die Korinther
Um die Herzen der Korinther zu erreichen, stellt Paulus ihnen das höchste Beispiel von Opferbereitschaft vor: unseren Herrn Jesus Christus! Er kam vom Himmel, dem Ort unendlicher Reichtümer, um in dieser Welt als armer Mensch zu leben. Schliesslich opferte Er sein Leben, damit wir durch seine tiefste Armut – Er wurde von Gott verlassen – reich würden. Kann man diese Gnade betrachten, ohne selbst gedrängt zu werden, den Notleidenden zu helfen?
Die Korinther hatten schon ein Jahr zuvor einen guten Vorsatz gefasst, ihn aber bis jetzt nicht in die Tat umgesetzt. Dazu wurden sie nun aufgefordert. Die Höhe ihrer Gabe sollte sich nach dem richten, was sie besassen. Der Herr überfordert niemand. Unsere wirtschaftliche Situation soll die Grösse unserer Gabe bestimmen (1. Korinther 16,2). Das Wichtigste aber ist unsere Bereitschaft oder Bereitwilligkeit.
Gott lässt zu, dass es nicht allen Gläubigen gleich gut geht. So haben die Reicheren unter ihnen Gelegenheit, den Bedürftigen zu helfen. Die Gleichheit wird in Römer 15,26.27 noch auf eine andere Art erklärt. Durch die Verbreitung des Evangeliums waren grosse geistliche Segnungen von Jerusalem aus zu den Nationen gekommen. So wurden die Gläubigen aus den Nationen gewissermassen Schuldner gegenüber den Heiligen in Jerusalem. Nun flossen materielle Gaben von den Gläubigen aus den Nationen – sozusagen als Kompensation – zu ihren verarmten Glaubensgeschwistern in Jerusalem zurück.
Titus und zwei weitere Brüder
In diesen Versen finden wir wichtige und bleibende Grundsätze für die Verwaltung der materiellen Gaben, die von den Gläubigen zusammengelegt werden. Es ist ein wichtiger Dienst, bei dem nie einer allein handeln sollte. Hier waren es zwei weitere Brüder, die zusammen mit Titus nach Korinth reisen sollten.
Wenn es um das Verwalten des materiellen Opfers der Gläubigen geht, dürfen die Versammlungen selbst bestimmen, wem sie eine solche Aufgabe übertragen wollen. Wichtig ist, dass diese Brüder das volle Vertrauen der Glaubensgeschwister haben. Hier heisst es von einem, dass er von den Versammlungen für diesen Dienst gewählt worden war (Vers 19; Apostelgeschichte 6,3.5). Vom anderen wird gesagt, dass er oft in vielen Stücken erprobt worden war und sich bewährt hatte. – Bei Brüdern, die einen Dienst zur geistlichen Auferbauung tun, ist es allein der Herr, der beruft (Epheser 4,11; 1. Korinther 12,28; Apostelgeschichte 13,2). Das können nicht die Menschen bestimmen.
Im Weiteren darf die Verwaltung der materiellen Gaben in keiner Weise Anlass zu Kritik von Seiten der Menschen geben. Paulus wollte sorgfältig alles vermeiden, was irgendwelches Misstrauen hätte hervorrufen können. Er wusste, dass es um die Herrlichkeit des Herrn ging. Kein Schatten sollte in dieser Hinsicht auf die Versammlung fallen. – Nachdem Paulus alle praktischen Punkte erwähnt hatte, lag es nun an den Korinthern, den Beweis ihrer Liebe zu erbringen.
Gott liebt fröhliche Geber
Im achten Kapitel nannte der Apostel die materielle Gabe der Gläubigen eine Gnade. Jetzt spricht er von der gleichen Sache und bezeichnet sie als Dienst. Beides trifft zu. Es ist ein Vorrecht – eben eine Gnade –, dass wir dem Herrn neben den Opfern des Lobes auch materielle Opfer bringen dürfen. Wenn wir aber an die Unterstützung der bedürftigen Gläubigen und der Diener des Herrn denken, denen diese materiellen Gaben zukommen sollen, dann sind diese Mittel und ihre Verwaltung ein Dienst.
Die Bereitschaft der Korinther, bedürftige Glaubensgeschwister zu unterstützen, hatte andere angespornt, es ebenso zu tun. Aber nun sorgte sich der Apostel um die Umsetzung ihrer Bereitschaft in die Tat. Er kannte seine geliebten Korinther und wusste, dass sie mit ihrem Mund eifriger waren als mit ihren Händen. Deshalb sandte er die drei Brüder voraus, um die Herzen der Korinther anzusprechen, damit sie ihre Hände öffneten. Trotz dieser Massnahme des Apostels wünschte er, dass es eine Gabe von Herzen und nichts Erzwungenes sei.
In den Versen 6 und 7 gebraucht der Apostel das Bild von Saat und Ernte. Wer sparsam sät, kann keine segensreiche Ernte erwarten. Das gilt nicht nur für die Ewigkeit. Sehr oft belohnt der Herr unsere Freigebigkeit in materieller Hinsicht schon in dieser Zeit mit reichem Segen. Der Herr sieht jedoch auch auf die Herzenseinstellung, mit der wir geben. Lasst uns mit fröhlichem Herzen freigebig sein!
Was das Geben bewirkt
Wenn wir fröhlichen Herzens freigebig sind, werden wir erfahren, dass wir nicht ärmer werden. Gott wird es uns reichlich vergelten, so dass wir «in allem, allezeit alle Genüge haben». Und lasst uns nicht vergessen, dass Er «dem Sämann Samen darreicht», d.h. das, was wir weitergeben dürfen, kommt von Ihm. Zudem gibt Er uns «Brot zur Speise», d.h. alles, was wir für unseren Unterhalt benötigen. Mit David können wir sagen: «Von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben» (1. Chronika 29,14).
Die Verse 11-14 enthüllen uns die weitreichenden Resultate einer materiellen Gabe. Sie dient zunächst zur «Erfüllung des Mangels der Heiligen». Darüber hinaus wird Gott verherrlicht durch viele Danksagungen der Empfänger. In diesem Fall würden sich die Gläubigen in Jerusalem auch dankbar darüber freuen, dass das Evangelium, das von ihnen ausgegangen war, unter den Nationen solches bewirkt hatte. Sozusagen als Gegenleistung für das Empfangene antworten die Beschenkten mit ernster Fürbitte für die Geber. Ja, sie werden sich sogar danach sehnen, die ihnen unbekannten Glaubensgeschwister aus den Nationen kennen zu lernen. So dient eine materielle Gabe zu einer engeren Verbindung unter den Gläubigen.
Das Kapitel schliesst nicht mit unseren Gaben, sondern mit der unaussprechlichen Gabe Gottes an uns. Es ist sein geliebter Sohn, den Er einst für uns auf die Erde und ans Kreuz gegeben hat. In dieser Gabe sind alle anderen Gaben Gottes enthalten (Römer 8,32).
Geistlicher Kampf
In den Kapiteln 10 und 11 muss der Apostel gegen die Männer Stellung nehmen, die ihn verleumdeten und seinen Dienst zu untergraben suchten. Er zeigte den Korinthern, dass die falschen Propheten und Lehrer sie von Christus und vom rechten Weg abziehen wollten. Seine Ermahnung geschah in der Gesinnung des Herrn Jesus, in Sanftmut und Milde. Trotzdem trat er entschieden gegen das Verkehrte auf.
Einer der Angriffe lautete, der Apostel lebe nach der alten Natur. Das war eine Lüge. Er lebte zwar im Fleisch, d.h. in seinem menschlichen Körper. Aber er kämpfte nicht nach dem Fleisch, d.h. nicht nach den Grundsätzen der gefallenen Natur. Seine Waffen waren nicht menschliche Intelligenz und Selbstsicherheit. Seine göttliche Waffe war das Schwert des Geistes – Gottes Wort. Damit war er in der Lage, philosophische Ideengebilde der Menschen sowie Festungen menschlicher Weisheit zu zerstören. Sein Ziel war, die verwirrten Gläubigen wieder unter den Gehorsam gegenüber Christus und seinem Wort zu führen.
In den Versen 7-11 weist er auf seine Briefe hin, in denen er die ihm von Gott verliehene Autorität als Apostel benutzte. Deshalb waren sie «gewichtig und kräftig». Doch er gebrauchte diese Autorität nicht zur Zerstörung, sondern zur Auferbauung der Versammlung. Im Gegensatz zu seinen Briefen stand die Erscheinung seiner Person. Sie sei – sagt man – schwach und seine Rede verächtlich (Vers 10). Wie dem auch war, es änderte nichts an seiner von Gott gegebenen Autorität.
Sich selbst empfehlen?
Paulus und seine Mitarbeiter distanzierten sich von den falschen Arbeitern, die in Korinth auftraten. Diese redeten nur von sich. Sie machten sich selbst zum Vergleichsmassstab und empfahlen sich selbst. Eine solche Einstellung ist unverständig. Und doch trifft man unter den Gläubigen immer wieder solche, die von sich und ihren Qualitäten reden. Wenn jemand sich selbst empfiehlt, wird er vielleicht am Richterstuhl des Christus einmal erkennen müssen, dass der Herr ihn nicht empfohlen hat.
Ab Vers 13 haben wir die Seite Gottes und die Haltung des wahren Dieners des Herrn. Der Gott des Masses hat jedem seiner Knechte einen Wirkungskreis zugeordnet. Er bestimmt den Umfang unseres Dienstes. Kein Arbeiter des Herrn sollte über sein Mass und seinen Bereich hinausgehen.
Der Auftrag des Apostels Paulus war, das Evangelium den Nationen zu predigen, und zwar dort, wo es noch nicht bekannt war. So war er auch nach Korinth gekommen. Nun hoffte er, wenn der Glaube der Korinther wuchs, von ihnen aus weiterzugehen.
Im Gegensatz zu den wahren Dienern des Herrn betätigen sich falsche Arbeiter, die keinen Auftrag von Gott haben, immer auf fremden Arbeitsfeldern und rühmen sich über das, was andere gewirkt haben. Aber der Ruhm gehört nur dem Herrn, von dem alles kommt, was wir zum Dienst nötig haben. Seine Anerkennung – und nicht die der Menschen – ist ausschlaggebend.
Eifer und Bescheidenheit im Dienst
Für Paulus war es eine Torheit, von sich und seinem Dienst zu reden. Doch Gott wollte es und inspirierte ihn zu diesen Worten. Die Echtheit seines Apostelamts mit der dazu gehörenden Autorität musste gegenüber den falschen Aposteln klar ans Licht gestellt werden.
Doch es ging dem inspirierten Schreiber vor allem um die Korinther. Er hatte sie einst mit Christus im Himmel verbunden. Doch nun liefen sie Gefahr, durch Verführung ihre Zuneigungen zu ihrem himmlischen Bräutigam zu verlieren. Sie ertrugen es, vom Herrn Jesus abgezogen zu werden.
Paulus hatte sich im ersten Brief als den geringsten von allen Aposteln bezeichnet (1. Korinther 15,9). Doch er stand den ausgezeichnetsten unter ihnen in nichts nach. Weil er aber keine Unterstützung von den Korinthern annahm, versuchten die falschen Apostel ihn herabzuwürdigen. Um das Evangelium als etwas für die Menschen Kostenloses vorzustellen, nahm er nichts von den Korinthern an. Und sie? Unter dem Einfluss der falschen Apostel legten sie ihm diese Haltung als Mangel an Liebe zu ihnen aus!
Falsche Apostel
In den Versen 12-15 entlarvt der Apostel Paulus die falschen Arbeiter schonungslos. So wie Satan sich verstellen und als Engel des Lichts auftreten kann, so nahmen diese Menschen die Gestalt von Aposteln des Herrn an. Diese Taktik des Feindes ist für die Gläubigen sehr gefährlich. Wie leicht lassen wir uns durch eine gute Erscheinung oder schöne Reden verführen! Aber wird dabei die Lehre des Christus verkündigt?
Man spürt, wie es dem Apostel schwer fiel, von sich und seinem Dienst zu reden. Doch es musste sein, um die Korinther darüber aufzuklären, wie sehr sie von den falschen Arbeitern unterdrückt wurden. Er musste ihnen sagen: «Ihr ertragt es, wenn jemand euch knechtet …» Sie merkten es nicht einmal!
Leiden im Dienst
Diese Verführer hoben zwei Punkte besonders hervor:
- die natürliche Abstammung von Abraham oder die Zugehörigkeit zum irdischen Volk Gottes und
- die Grösse und Wichtigkeit als Diener von Christus.
Was antwortete Paulus darauf? Der Abstammung nach war er genauso ein Israelit wie sie. «Sind sie Hebräer? Ich auch. Sind sie Israeliten? Ich auch. Sind sie Abrahams Nachkommen? Ich auch.»
Als Diener von Christus stellte er nicht das vor, was er mit der Hilfe des Herrn geleistet hatte. Er zählte vielmehr all die vielfältigen Leiden auf, die er wie kein anderer Knecht des Herrn durchgemacht hatte. Wie sehr unterschied er sich von den bösen Arbeitern, die die Korinther betört hatten! Diese Leiden waren die Folge der Treue in seinem Dienst. In sich selbst war er ein schwaches Gefäss. Doch die Kraft des Herrn Jesus befähigte ihn, dies alles zu ertragen.
Auch wenn wir nicht so Vieles und so Schweres durchmachen müssen wie Paulus, sollte doch die Sorge um die Versammlungen – das Wohl unserer Glaubensgeschwister – auch auf unseren Herzen liegen und uns beschäftigen.
Im dritten Himmel
Der Apostel Paulus hatte Gesichte und Offenbarungen gehabt. Durch diese empfing er vom Herrn Mitteilungen, die er anderen weitergab. Auch darin unterschied er sich von den falschen Aposteln. Zudem hatte Gott ihm eine ganz persönliche Erfahrung geschenkt, von der er ab Vers 2 spricht. Durch diese Entrückung in den dritten Himmel, an den Ort des Segens (Paradies), stärkte der Herr seinen Knecht in seinem mühevollen und beschwerlichen Dienst.
Bei der Schilderung dieser Erfahrung redet er nicht direkt von sich, sondern von «einem Menschen in Christus». Er konnte nicht sagen, ob er sich bei dieser Entrückung in seinem Körper befunden hatte oder ausserhalb davon. Jedenfalls war er ohne irgendeine Behinderung durch die alte Natur an jenem Ort gewesen.
Alle diese Erlebnisse – er nennt es das Übermass der Offenbarungen – hätten ihn überheblich machen können. Das wollte Gott verhindern. Deshalb gab Er ihm einen Dorn für das Fleisch, den der Apostel aber als Hindernis für seinen Dienst empfand. Daher flehte er dreimal zum Herrn und bat um Erleichterung. Doch die göttliche Antwort lautete: «Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht.» Paulus beugte sich darunter und nahm es an.
Nun wusste er, dass er alles in seinem Leben und Dienst nur der Kraft des Herrn zu verdanken hatte. Er konnte sagen: «Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.»
Paulus liebt die Korinther
Im Lauf seiner Verantwortung im Blick auf sein Apostelamt und seinen Dienst bezeichnet Paulus sich mehrmals als Tor oder als töricht (2. Korinther 11,1.16.17.21; 12,11). Es war ihm sehr zuwider, von sich zu reden. Statt dass die Korinther, die so viel von ihm empfangen hatten, ihn empfahlen, musste er sich vor ihnen verantworten und sich als Apostel legitimieren. Alles, was ein Apostel auszeichnete, konnte Paulus vorweisen.
Nur in einer Sache waren die Korinther gegenüber den anderen Versammlungen verkürzt worden: Um ihnen nicht zur Last zu fallen, hatte er keine Unterstützung für seinen Lebensunterhalt von ihnen angenommen. Es fällt uns schwer, so etwas als ein Unrecht zu betrachten! Demütig bat er: «Vergebt mir dieses Unrecht.»
Einen früheren Besuch bei den Korinthern hatte Paulus verschieben müssen (2. Korinther 1,15.16.23; 2,1). Jetzt war er das dritte Mal bereit, nach Korinth zu gehen. Wieder wollte er ihnen nicht zur Last fallen. Er erwartete keine Unterstützung von ihnen. Es ging ihm nur um sie selbst. «Ich suche nicht das Eure, sondern euch.» Er war ihr geistlicher Vater, sie waren seine Kinder. Wie Eltern sich für ihre Kinder aufopfern, wollte er sich und alles, was ihm zur Verfügung stand, für die Korinther hingeben. Je weniger sie ihn liebten, umso mehr liebte er sie. Musste eine solche Herzenshaltung nicht ihre Herzen bewegen?
Paulus appelliert an die Korinther
Die Mitarbeiter, die Paulus nach Korinth gesandt hatte, zeigten die gleiche selbstlose Haltung, wie sie beim Apostel sichtbar wurde. Weder er noch seine Abgesandten hatten je versucht, einen materiellen Vorteil von den Korinthern zu haben.
Paulus war genötigt gewesen, sich vor den Korinthern als Apostel zu verantworten. Ungern hatte er es getan. Doch er wusste, dass Gott es so wollte. Ja, es musste sein, um den falschen Aposteln entgegenzutreten. Bei seiner Verantwortung wollte Paulus sich nicht irgendwie rechtfertigen. Es ging ihm nur um den Dienst, den er vom Herrn empfangen hatte, und um die geistliche Auferbauung der Korinther.
Mit Sorge sah der Apostel seinem Besuch in Korinth entgegen. Was ihm zu schaffen machte, war der schlechte Zustand unter den Geschwistern. Er musste von Streit, Neid, Zorn, Zänkereien, Verleumdungen usw. reden. Alle diese ungerichteten Sünden würden für den Apostel Demütigung und Trauer bedeuten, wenn er nach Korinth kam. Aber nicht nur das. Dieses Böse würde ihn zwingen, mit Entschiedenheit dagegen aufzutreten. Die im ersten Brief erwähnten Sünden – Unreinheit, Hurerei, Ausschweifung – gab es in der Versammlung in Korinth immer noch, ohne dass die Fehlbaren darüber Buße taten. Sein Kommen konnte also nicht lauter Freude sein. Wie sehr belastete das sündige und unbußfertige Leben vieler in der Versammlung in Korinth den treuen Apostel!
Paulus will die Korinther besuchen
Zwei Briefe hatte der Apostel an die Versammlung in Korinth geschrieben. Darin hatte er manches Verkehrte unter den dortigen Christen aufzeigen müssen. Er gab ihnen Gelegenheit, das Böse Gott gemäss zu ordnen. Jetzt war er auf dem Weg, persönlich nach Korinth zu kommen. Dann würde er gegen die Fehlbaren, die ihre Sünden nicht einsahen, schonungslos vorgehen.
Die Korinther hatten den Dienst von Paulus in Frage gestellt. Doch ihr Glaube an den Herrn Jesus war der beste Beweis dafür, dass Christus durch den Apostel geredet und gewirkt hatte.
Werdet vollkommen!
Welch eine Selbstverleugnung sehen wir in den Worten der Verse 7-10! Treu folgte der grosse Apostel den Fussstapfen seines Meisters nach.
Die Worte «Vervollkommnung» und «werdet vollkommen» in den Versen 9 und 11 haben den Sinn von Zurechtbringung. Der Apostel wünschte, dass seine geliebten Korinther wieder zurechtgebracht würden und aufs Neue auf einen Weg der Gottesfurcht kämen. Die Ermahnungen, mit denen der Brief schliesst, spornen zu einem gottseligen Leben an, in dem das Fleisch nicht mehr zum Zug kommt, sondern in dem sich Christus und sein Wille entfalten. Der Gott der Liebe und des Friedens will jedem helfen, dies zu verwirklichen.
Der Segen der letzten Verse ist ein Wunsch für jede örtliche Versammlung. Sie soll ein Ort sein, wo Gnade herrscht, Liebe überfliesst und eine heilige Gemeinschaft in göttlichen Dingen gepflegt wird.
Einleitung
In 1. Mose 1 bis 11 werden drei wichtige Ereignisse beschrieben:
- Gott schuf die Welt. Er machte die Erde zum Wohnort der Menschen. Er schuf Adam und Eva. Im Glauben halten wir fest, dass Er der Schöpfer von Himmel und Erde ist (Heb 11,3).
- Der Mensch übertrat das Gebot Gottes und fiel in Sünde. Bis heute muss er die traurigen Folgen davon tragen. Seither steht auch die Schöpfung unter dem Fluch der Sünde (Röm 8,20-23).
- Die Flut kam als Gericht Gottes über die damalige Erde, weil die Bosheit des Menschen gross war. Danach machte Gott mit Noah und seiner Familie einen Neuanfang (Heb 11,7).
Buchtipp: Im Anfang
Licht, Wasser, Erde, Meer
Das erste Buch der Bibel ist das Buch der Anfänge. Wir finden darin alle Anfänge des Handelns Gottes mit der Welt und den Menschen. Es beginnt damit, dass der ewige Gott die Himmel und die Erde schuf. Der in Vers 1 erwähnte Anfang ist der Beginn des Universums. Wann dies war, wissen wir nicht.
Vers 2 deutet auf eine Katastrophe hin, denn Gott hat kein solches Chaos geschaffen (Jesaja 45,18). Der Grund für diese Verwüstung liegt vermutlich im Sturz Satans, der sich als ein Engelfürst über Gott erheben wollte und nach seinem Fall zum Widersacher Gottes wurde (Jesaja 14,12-14; 1. Timotheus 3,6 Fussnote).
Ab Vers 3 sehen wir, wie Gott zur Tat schritt und aus dem Chaos die jetzige Schöpfung machte. Am ersten Tag brachte Er durch ein Wort Licht in die Situation. Dann schied Er das Licht von der Finsternis.
Am zweiten Tag machte Gott eine Ausdehnung und schied damit die Wasser, die sich unterhalb der Ausdehnung befanden, von denen, die oberhalb der Ausdehnung waren. Wir sehen in diesem Handeln Gottes bereits am Anfang der Bibel zwei göttliche Grundsätze: Gott unterscheidet und trennt das Gute vom Bösen. In Übereinstimmung damit sollen die Glaubenden das Gute festhalten und sich von aller Art des Bösen fernhalten (1. Thessalonicher 5,21.22).
Am dritten Tag liess Gott auf der Erdkugel die Meere und das feste Land entstehen – wieder eine Unterscheidung! Dann rief Er durch sein Wort die Pflanzenwelt hervor: Gras, samenbringendes Kraut und fruchttragende Bäume.
Himmelslichter und Tiere
Am vierten Tag machte Gott Sonne, Mond und Sterne. Die inspirierte Mitteilung ist jedoch kein wissenschaftlicher Bericht der Astronomie. Sie beschreibt uns die Tatsachen so, wie ein Mensch sie mit seinen Augen von der Erde aus wahrnimmt. Wir unterscheiden den Tag von der Nacht. Die Sonne beherrscht den Tag, der Mond leuchtet in der Dunkelheit der Nacht. Dann sieht man auch die Sterne. Anhand der jeweiligen Position der Erde zur Sonne bestimmen wir die Jahreszeiten, Tage und Jahre.
Am fünften Schöpfungstag füllte Gott die Wasser mit Leben. Er machte alle im Wasser lebenden Wesen bis zu den grossen Seeungeheuern. Auf der Erde schuf Er alle Vögel, die sich sowohl auf dem Boden als auch in der Luft fortbewegen können. Von allem Anfang an sollte ein grosser Artenreichtum vorhanden sein (Vers 21).
Zu Beginn des sechsten Tages machte Er die Tiere und alle Lebewesen, die sich auf der Erde regen. In den Versen 24 und 25 fällt auf, wie oft der Ausdruck «nach ihrer bzw. seiner Art» vorkommt. Gott hat von Anfang an eine Vielfalt in der Pflanzen- und Tierwelt geschaffen. Die Arten haben sich nicht mit der Zeit entwickelt!
Wenn wir das, was wir bis jetzt gelesen haben, zusammenfassen, können wir sagen: Gott hat in seiner Weisheit einen für den Menschen in jeder Hinsicht geeigneten Wohnort geschaffen. Haben wir Gott schon dafür gedankt, dass wir auf einer so schönen Erde leben dürfen?
Die Erschaffung des Menschen
Als Letztes finden wir am sechsten Tag die Erschaffung des Menschen. Die Formulierung in Vers 26 «Lasst uns Menschen machen …» deutet auf die Dreieinheit der Gottheit hin, die jedoch im Alten Testament noch nicht offenbart war. Im Licht des Neuen Testaments zeigt dieser Vers, dass alle drei Personen der Gottheit (der Vater, der Sohn und der Heilige Geist) an der Erschaffung des Menschen beteiligt waren.
Einen weiteren wichtigen Punkt haben wir in Vers 27: Der Mensch nach Gottes Gedanken besteht aus Mann und Frau. Die Frau ist in Gottes Augen genauso wichtig wie der Mann, auch wenn Er den beiden in seiner Schöpfung nicht die gleiche Stellung gegeben hat.
Nachdem Gott die Menschen geschaffen hatte, segnete Er sie in dreifacher Hinsicht:
- Er machte sie fruchtbar.
- Er gab ihnen die Erde als Lebensraum.
- Er übertrug ihnen die Herrschaft über alle Lebewesen.
Gott sorgte auch für seine Geschöpfe, indem Er sowohl den Menschen als auch den Tieren ihre Nahrung gab. Dieses Wohlwollen Gottes uns gegenüber macht uns verantwortlich. Sind wir treue Verwalter von dem, was Er uns anvertraut hat? Danken wir Ihm regelmässig für alles Gute, das Er uns schenkt?
Schliesslich heisst es, dass alles, was Gott gemacht hatte, sehr gut war. Alles Geschaffene war ohne Makel, auch der Mensch. Aber Gott hatte den Menschen als verantwortliches Wesen geschaffen. Würde er dieser Verantwortung entsprechen?
Gottes Ruhe und der Garten Eden
Nach sechs Tagen war Gottes Schöpfung vollendet und alles war sehr gut. Am siebten Tag ruhte Er von all seinem Werk. Diesem siebten Tag gab Gott eine besondere Bedeutung: Er segnete und heiligte ihn. Der siebte Tag ist das Zeichen der Ruhe Gottes in der ersten Schöpfung (2. Mose 20,11). Diese Ruhe wird sich im Tausendjährigen Reich völlig erfüllen, wenn Gott auf der Grundlage des Erlösungswerks des Herrn Jesus mit seiner ersten Schöpfung zum Ziel kommen wird.
Ab Vers 4 haben wir eine detaillierte Beschreibung der Erschaffung des Menschen, die in 1. Mose 1,27 ohne Einzelheiten erwähnt wird. Dort heisst es: «Gott schuf den Menschen.» Das war ein Akt seiner Schöpfermacht. Jetzt lesen wir in Vers 7: «Gott der Herr bildete den Menschen …» Dieser Bericht zeigt uns, wie weise Er im Einzelnen handelte. Dadurch, dass Gott den Odem des Lebens in die Nase des Menschen hauchte, kam er als einziges Lebewesen in eine Beziehung zu Gott.
In seiner Fürsorge für den Menschen pflanzte Gott selbst einen Garten mit herrlichen Bäumen. Er sorgte auch dafür, dass dieser Ort bewässert wurde (Vers 10). Der Strom, der von Eden ausging, teilte sich in vier Flüsse – ein Bild des vielfältigen Segens Gottes für uns Menschen auf der Erde. An diesem schönen Platz durfte sich der erste Mensch nun aufhalten. Weil Gott sein Geschöpf als ein verantwortliches Wesen gebildet hatte, gab es im Garten Eden nicht nur den Baum des Lebens, sondern auch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
Eine Hilfe für den Menschen
Gott hatte den Menschen in seinem Bild geschaffen (1. Mose 1,27). Deshalb war Adam ein aktives Wesen, dem der Schöpfer eine Aufgabe übertragen konnte. Er bekam den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Als Geschöpf hatte der Mensch auch eine Verantwortung gegenüber seinem Schöpfer: Er sollte die Autorität Gottes über sich anerkennen, indem er das Gebot befolgte und nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ass.
In den Versen 18-20 finden wir eine zweite Art von Tätigkeit, die Gott dem Menschen gab. Er durfte allen Tieren einen Namen geben. Das war im Gegensatz zur körperlichen Arbeit beim Bebauen des Gartens eine geistige Aktivität.
Dann wird berichtet, wie Gott Adam eine Hilfe machte, die ihm entsprach. Er bildete eine Frau. Dazu nahm Er eine von Adams Rippen. So war Eva ein Stück von ihm. Wir sehen aus 1. Mose 1,27, dass Mann und Frau zusammen den Menschen nach Gottes Gedanken bilden.
Als Gott dem ersten Menschen die Frau gab, die sozusagen von ihm war, verband Er die beiden miteinander in der Ehe. Das wird durch Vers 24 bestätigt. Die Verbindung eines Mannes mit seiner Frau in der Ehe ist also eine Gabe Gottes und nicht eine Idee der Menschen. Diese göttliche Einrichtung gilt heute noch. Gott hat nichts daran geändert.
Vers 25 unterstreicht die Tatsache, dass das erste Menschenpaar bis dahin in Unschuld lebte. Sie wussten nichts von Gut und Böse.
Der Sündenfall
Woher die Schlange kam und wer sich hinter diesem sprechenden Tier verbarg, wird an dieser Stelle nicht gesagt. Aber aus ihren Worten wird klar, dass wir es hier mit Satan, dem Widersacher Gottes, zu tun haben. Er wird in Offenbarung 12,9 die alte Schlange genannt. In Vers 1 verbreitete er fragend eine Lüge über Gott und in den Versen 4 und 5 machte er Ihn sogar zum Lügner, was überhaupt nicht stimmte (Johannes 8,44). Was passierte jetzt?
Eva liess sich in eine Diskussion mit der eingedrungenen Schlange ein. Die Folge war, dass in ihr die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens geweckt wurden (1. Johannes 2,16). Dies verleitete sie dazu, von der verbotenen Frucht zu essen. Auch Adam übertrat das einzige Gebot, das Gott gegeben hatte. So fiel der Mensch in Sünde.
«Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan.» Ihr Gewissen regte sich. Sie erkannten, dass sie etwas Böses getan hatten. Da versuchten sie ihre Nacktheit zuzudecken. Aber sie merkten, dass sie vor Gott nackt blieben. Deshalb versteckten sie sich vor Ihm.
Was tat Gott, nachdem sie gegen Ihn gesündigt hatten? Er ging seinem gefallenen Geschöpf nach. Zuerst rief Er: «Wo bist du?» Adam musste die Folge der Sünde bekennen und sagen: «Ich fürchtete mich … und ich versteckte mich.» Sobald der Mann auf seinen Ungehorsam angesprochen wurde, versuchte er die Schuld auf die Frau abzuschieben. Und Eva? Als Gott ihre Tat erwähnte, sagte sie: «Die Schlange betrog mich.»
Traurige Folgen und Gottes Gnade
In seinem gerechten Urteil wendet Gott sich zuerst an die Schlange. Ohne ihr eine Frage zu stellen, sagt Er, dass der Nachkomme der Frau ihr den Kopf zermalmen werde. Diese Worte weisen auf Christus hin, der durch seinen Tod den Teufel besiegt hat (Hebräer 2,14). Das «Zermalmen seiner Ferse» bedeutet, dass der Herr Jesus sterben musste, um diesen Sieg zu erringen.
Die Folgen des Sündenfalls treffen sowohl Adam und Eva als auch alle ihre Nachkommen. Für die Frauen sind Schwangerschaft und Geburt mit Mühsal und Schmerzen verbunden. Auch die Ehe ist betroffen (Vers 16b). Vers 17 zeigt, dass der Mann die Hauptverantwortung trägt. Deshalb sind die Folgen für ihn sehr weitreichend: Der Erdboden ist seinetwegen verflucht.
In Vers 20 sehen wir den Glauben Adams. Obwohl seit dem Sündenfall alle Menschen unter dem Urteil des Todes stehen, nennt er Eva nicht die Mutter aller Sterblichen, sondern bezeichnet sie im Glauben als die Mutter aller Lebenden. In Vers 21 bewundern wir die Gnade Gottes: Er macht Adam und seiner Frau Kleider aus Fell. Dazu müssen Tiere ihr Leben lassen, d.h. es ist ein Opfer nötig. So werden wir schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte auf das Opfer des Herrn Jesus hingewiesen, das erforderlich war, um unser Sündenproblem zu lösen (Epheser 1,7; Hebräer 9,22; Jesaja 61,10).
Dann treibt Gott den Menschen aus dem Garten Eden hinaus. Wie schrecklich wäre es gewesen, wenn Adam als Sünder vom Baum des Lebens gegessen hätte! Er hätte ewig in diesem Zustand leben müssen.
Kain und Abel
Nun bekommen Adam und Eva die ersten Kinder: Kain und Abel. Der Jüngere wird ein Schafhirte, der Ältere ein Ackerbauer. Beide bringen Gott eine Opfergabe dar. Aber welch ein Unterschied zwischen den beiden! Kain bringt Gott das, was er durch seine Anstrengung vom verfluchten Erdboden geerntet hat. Abel tötet von seiner Herde das Beste (Erstlinge) und bringt Gott dieses Opfer. Damit bestätigt er, was er im Glauben aus dem Handeln Gottes mit seinen Eltern (1. Mose 3,21) erfasst hat: Jemand anders muss für mich sterben, damit ich zu Gott kommen kann. Dieses Opfer ist ein schöner Hinweis auf den Herrn Jesus, der für uns und unsere Sünden am Kreuz gestorben ist!
Kain meint, Gott mit dem zufriedenstellen zu können, was er mit seinem Einsatz erwirkt hat. Doch auf der Grundlage eigener Werke wird kein Mensch vor Gott gerechtfertigt (Römer 3,20). Gott kann Kains Opfergabe nicht annehmen. Leider ist dieser nicht bereit, seine Ansicht zu ändern. Vielmehr beginnt er seinen Bruder Abel zu hassen, obwohl dieser ihm nichts zuleide getan hat. Der Hass führt zu einer schlimmen Tat: Kain ermordet seinen Bruder!
Auch als der heilige Gott dem Brudermörder nachgeht und ihn zur Rede stellt, ändert sich dessen Haltung in keiner Weise. Er ist nur betrübt über die Strafe, die Gott über ihn verhängt. Aber wir sehen keine Buße im Herzen. Schliesslich kehrt Kain Gott ganz den Rücken, um im Land «Flucht» ohne Beziehung zu Gott zu leben. Wie traurig!
Die Nachkommen Kains
In den Versen 17-24 wird das Leben Kains und seiner Nachkommen beschrieben. In allem, was sie tun, ist Gott ausgeschaltet. Gleichzeitig unternehmen diese Menschen sehr viel, um das Leben auf der Erde – die durch die Sünde unter dem Fluch liegt – so sicher und so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir finden in diesem Abschnitt alles, was bis heute die Welt kennzeichnet. Mit diesen Mitteln will die menschliche Gesellschaft ohne Gott auskommen und dabei das Leben geniessen.
Einerseits zeigen sich Hochmut, Ungehorsam und Auflehnung gegen Gott: Statt der Einehe wird die Polygamie eingeführt. Anderseits konzentriert sich alles auf das diesseitige Leben. Der irdische Besitz wird sehr wichtig. Es fehlt nicht an Kultur und Unterhaltung. Durch den Fortschritt der Technik gibt es manche Erleichterung bei der mühsamen Arbeit (1. Mose 3,17-19). Doch in dieser gottlosen Atmosphäre herrscht auch Gewalt. Ja, es scheint sogar, als sei sie ein Bestandteil dieser Welt (1. Mose 4,23.24).
Der dritte Sohn von Adam und Eva ist Seth. Sie betrachten ihn als Ersatz für Abel, den Kain ermordet hat. Seth gibt seinem Sohn den Namen Enos (= schwacher Mensch). Unter den Nachkommen Seths herrscht eine andere Einstellung als in der Familie Kains. Diese Menschen sind sich ihrer Schwachheit infolge des Sündenfalls bewusst. Sie suchen im Gebet Hilfe und Unterstützung bei Gott. Wir finden hier Glauben und Gottesfurcht – zwei Kennzeichen, die seit jeher das Merkmal derer sind, die auf Gott vertrauen.
Die Familie des Glaubens
Die Nachkommenschaft Adams über die Linie von Seth zeigt uns im Gegensatz zu Kain und seinen Nachkommen die Familie des Glaubens. Die zwei einleitenden Verse des Kapitels blenden auf den Ursprung zurück: auf die Erschaffung des Menschen durch Gott. Er machte Adam in seinem Gleichnis.
Doch Seth, der Sohn von Adam und Eva, war ein Kind von sündigen Eltern: ein Mensch im Gleichnis und Bild von Adam, nicht mehr von Gott. Seither ist die Sünde zu allen Nachkommen Adams durchgedrungen. Jeder Mensch, der geboren wird, hat die Erbsünde in sich (Römer 5,12). Als Folge davon müssen alle Menschen sterben. Das wird in diesem Kapitel bestätigt, denn es heisst wiederholt: «Und er starb.»
Die göttliche Beschreibung der Linie des Glaubens unterscheidet sich auffallend von der Beschreibung der menschlichen Gesellschaft, die ohne Gott lebt. Von den Glaubenden wird nichts Weltbewegendes berichtet wie z.B. Städtebau, Kunst oder technische Erfindungen. Es wird nur gesagt, dass sie für eine Zeit auf der Erde lebten, Familien hatten und dann starben.
Was hat das uns zu sagen? Diese Menschen sahen Gott nicht, aber sie glaubten an Ihn und beteten zu Ihm (1. Mose 4,26). Das prägte ihr Leben. Sie hatten normale menschliche Bedürfnisse, die sie mit der Erde verbanden. Aber sie wollten getrennt von allem leben, was im Widerspruch zu Gott stand (siehe Vers 22). Sie wussten auch, dass die Zeit ihres Lebens in Gottes Hand war (Psalm 31,16) und Er die Länge ihres Lebens bestimmte.
Henoch wandelte mit Gott
Von Henoch wird uns mehr berichtet als von den übrigen Menschen in diesem Kapitel. Weitere Einzelheiten über diesen gläubigen Mann finden wir in Hebräer 11,5.6 und Judas 14.15. Mit der Geburt von Methusalah gab es im Leben Henochs eine Wende. Denn von diesem Zeitpunkt an wandelte er mit Gott. Es scheint, dass der Geist Gottes damit auf die Bekehrung Henochs hindeutet.
Als Glaubender lebte Henoch nun Tag für Tag mit seinem Gott. Aus der Weissagung Henochs im Judas-Brief können wir entnehmen, dass die Menschen in seiner Umgebung immer gottloser wurden. Der treue Glaubensmann wollte in diesem Umfeld Gott gefallen (Hebräer 11,5). Zudem erkannte er in Gemeinschaft mit dem Herrn, dass der Allmächtige zu seiner Zeit mit Gericht eingreifen würde. Aber Henoch musste dies nicht mehr erleben. Bevor die Sintflut kam, von der wir in den nächsten Kapiteln lesen, entrückte Gott ihn zu sich in den Himmel.
Auch wir leben in einer gottlosen Welt, der das Gericht Gottes angekündigt ist. Doch bevor dieses Strafgericht eintrifft, wird der Herr Jesus alle, die an Ihn glauben, zu sich entrücken. So wird Er uns vor der Stunde der Versuchung bewahren, die über die Erde kommen wird (Offenbarung 3,10; 1. Thessalonicher 4,15-18; 1. Korinther 15,51-57).
Nach der Aussage von Lamech in Vers 29 muss das Leben damals recht schwer gewesen sein. Doch durch die Geburt seines Sohnes Noah wurde er getröstet. Nun hatte er einen Nachkommen, der ihm half, die Felder zu bebauen.
Noah lebt in einer bösen Welt
Die Söhne Gottes in Vers 2 sind Engel, die sich mit Menschen verbanden. Dadurch verliessen sie ihren Platz in der Schöpfungsordnung und sündigten gegen ihren Schöpfer. Das hatte einerseits ernste Konsequenzen für die Engel. Sie kamen in den Abgrund, wo sie gebunden sind und auf das endgültige Gericht warten (2. Petrus 2,4; Judas 6). Anderseits führte es zu äusserlich grossartigen Folgen für die Menschen: Es entstanden Riesen.
Doch wie sah es in den Herzen der Menschen aus, die sich damals stark vermehrten? «Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen gross war auf der Erde, und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.»
Das Überhandnehmen des Bösen betrübte den Schöpfer tief. Darum kündigte Er das Gericht an. In seiner Langmut gab Er dem Menschen eine Frist von 120 Jahren. Dann würde Er alles, was Er geschaffen hatte, vertilgen. Alles?
Nein, nicht alle und nicht alles. Da war einer unter den vielen, der in den Augen des Herrn Gnade fand: Noah, ein gerechter und vollkommener Mann, der im Glauben mit Gott lebte. Vers 18 zeigt, dass auch seine ganze Familie gottesfürchtig war. Diese acht Personen wollte Gott bewahren. Aber das Gericht konnte nicht mehr zurückgehalten werden, denn die Menschheit war gewalttätig und völlig verdorben. Beachte die dreimalige Wiederholung des Wortes «verdorben» in den Versen 11 und 12! Gott musste also Noah und die Seinen durch die Wasserflut hindurch bewahren.
Noah baut die Arche
In Vers 13 sprach Gott mit Noah konkret über das, was Er mit der Erde im Sinn hatte. Er wollte alles Lebende durch eine gewaltige Wasserflut auslöschen: durch das Gericht der Sintflut. Dann gab Er Noah einen klaren Auftrag. Er musste eine 150 Meter lange, 25 Meter breite und 15 Meter hohe Arche bauen: ein dreistöckiges wasserdichtes Schiff, in dem er, seine Familie und mindestens ein Paar von jeder Tierart überleben konnten.
Das Schiff hatte ausser einer Lichtöffnung nach oben keine Fenster. An der Seite der Arche gab es eine Tür. Wer durch diese eintrat, war vor dem Gericht in Sicherheit. Da das Wasser die Erde eine längere Zeit bedecken würde, musste Noah in der Arche genügend Nahrungsvorräte für Menschen und Tiere unterbringen. Weil er mit Gott lebte, befolgte er die Anweisungen, die er bekommen hatte. Alles führte er so aus, wie der Herr es ihm geboten hatte.
Im ersten Buch Mose wird uns nicht mitgeteilt, wie die Mitmenschen Noahs auf den Bau dieses grossen Schiffes auf trockenem Land reagierten. Aber im Neuen Testament lesen wir, dass er ein Prediger der Gerechtigkeit war (2. Petrus 2,5). Bestimmt hatte er seine Mitmenschen vor dem kommenden Gericht gewarnt. Zudem war jeder Hammerschlag an diesem Schiff eine Mahnung an die Leute. Hebräer 11,7 erklärt weiter, dass Noah durch den Bau der Arche und durch seinen Glauben, der in diesem Werk zum Ausdruck kam, die Welt verurteilte. Leider war niemand da, der seine «Predigt» ernst nahm.
Die Wasserflut kommt
Nachdem die Arche fertiggestellt war, forderte Gott Noah auf, zusammen mit seiner Familie und den Tierpaaren von jeder Art in die Arche zu gehen. Sieben Tage später würde das Gericht losbrechen. Ähnlich wie in 1. Mose 6,22 heisst es in Vers 5: «Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte.»
Noah musste die Tiere nicht zusammentreiben. Weil der Schöpfer-Gott in ihnen wirkte, kamen sie von selbst paarweise zu Noah in die Arche. Dann schloss der Herr selbst die Tür zu. Nun begann es zu regnen und die Wasser überfluteten die Erde.
Die Arche ist ein Bild vom Herrn Jesus und die Wasser der Flut reden vom Tod. Er hat das Gericht und den Tod – was wir verdient haben – auf sich genommen und für uns erduldet. Jeder Mensch, der an Ihn als seinen Retter glaubt, tritt sozusagen in die Arche ein. Dadurch ist er für immer vor dem göttlichen Gericht geschützt. Doch die Zeit der Gnade, in der ein Mensch durch den Glauben an den Heiland errettet werden kann, dauert nicht für immer. Der Moment kommt, an dem Gott selbst die Tür schliesst (Vers 16; Matthäus 25,10). Dann ist es für alle, die noch draussen stehen, für immer zu spät!
Prophetisch weisen Noah und seine Familie auf den treuen Überrest aus dem Volk Israel in der Zukunft hin. Im Gegensatz zu den Gläubigen der Gnadenzeit, die wie Henoch vor der kommenden Gerichtszeit entrückt werden, wird dieser Überrest in den Strafgerichten, die über die Erde hereinbrechen werden, bewahrt werden und ins Tausendjährige Reich eingehen.
In der Arche gerettet
Die Flut kam 40 Tage lang über die Erde. Das Wasser stieg siebeneinhalb Meter über die höchsten Berge, so dass alle Lebewesen auf der Erde starben. «Alles starb, in dessen Nase ein Odem von Lebenshauch war, von allem, was auf dem Trockenen war.» Ein totales Gericht!
Die Zahl 40 kommt hier in der Bibel zum ersten Mal vor. Sie ist der Ausdruck der vollkommenen Erprobung des verantwortlichen Menschen. Wir finden diese Zahl auch an anderen Stellen:
- Mose war 40 Tage lang auf dem Berg Sinai.
- Das Volk Israel wanderte 40 Jahre durch die Wüste.
- Jesus wurde in der Wüste 40 Tage vom Teufel versucht.
Doch nur einer – unser Herr Jesus Christus – hat die Erprobung wirklich bestanden. Bei allen Übrigen kam bei der Prüfung das Versagen des verantwortlichen Menschen ans Licht.
«Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war.» So ist es mit uns Gläubigen. Wir haben das Gericht ebenso verdient wie die Ungläubigen. Doch der Herr Jesus, an den wir glauben, hat die ganze Strafe für uns getragen. Wir können frei ausgehen und möchten deshalb nicht mehr sündigen, sondern mit einem guten Gewissen für Gott leben. Das bezeugen wir in der christlichen Taufe, von der wir hier ein Bild haben (1. Petrus 3,20.21). Bei der Taufe werden wir ins Wasser getaucht. Aber wir müssen nicht unter Wasser bleiben und sterben, weil wir «in Christus» (= Arche) ins Wasser gelegt werden. Er hat durch seinen Tod die Strafe für unsere Sünden empfangen. Darum können wir nach dem Untertauchen sofort wieder herauskommen.
Das Wasser geht zurück
Als Noah und die Seinen in die Arche gingen und Gott hinter ihnen zuschloss, wussten sie nicht, wie lange die Flut dauern würde. Fünf Monate schwamm die Arche auf den Wassern, bis sie auf dem Gebirge Ararat strandete. Dann dauerte es nochmals zweieinhalb Monate, bis die Spitzen der Berge sichtbar wurden. Insgesamt verbrachten sie mehr als ein Jahr in der Arche (1. Mose 8,14; 7,10.11). Das war sicher eine lange Zeit, in der das Warten und das Vertrauen auf Gott geprüft wurden. Doch der erste Vers unseres Kapitels macht klar, dass Gott die Arche mit den Menschen und Tieren in ihr nie aus dem Auge verloren hatte.
Als die Wasser zurückgegangen waren, liess Noah zuerst den Raben hinaus, der über den Wassern hin- und herflog. Als er die Taube zum ersten Mal fliegen liess, kehrte sie zurück, weil sie keinen Ruheort gefunden hatte. Beim zweiten Mal brachte sie ein Olivenblatt mit und beim dritten Mal blieb sie endgültig weg. Der Rabe und die Taube stellen die beiden Naturen im erlösten Menschen dar. Der Rabe spricht von der alten Natur, die im Gläubigen nicht mehr die Oberhand haben sollte. Leider können wir aber noch fleischlich handeln. Dann wird der «Rabe» aktiv, der sich in einer schmutzigen und vom Tod geprägten Welt wohlfühlt.
Die Taube entspricht der neuen Natur und ihrer Aktivität. Sie findet auf der Erde und in dem, was vor Gott tot ist, keinen Ruheplatz. Das Olivenblatt im Schnabel der Taube weist auf die Frucht des Geistes hin. Sie entsteht, wenn die neue Natur im Gläubigen aktiv wird.
Noah verlässt die Arche
Als die Erde trocken war, durften alle, die in der Arche überlebt hatten, auf Gottes Anweisung das Schiff verlassen und ihr Leben auf der gereinigten Erde fortsetzen. Als Erstes baute Noah einen Altar. Da von den reinen Tieren und Vögeln je sieben Paare in der Arche überlebt hatten, konnte er nun von ihnen nehmen und dem Herrn Brandopfer opfern. Auf diese Weise brachte Noah Gott gegenüber seine tiefe Dankbarkeit für die wunderbare Rettung zum Ausdruck. Diese Opfertiere weisen auf Jesus Christus hin, der am Kreuz auf Golgatha als das wahre Brandopfer in den Tod gegangen ist. Auf der Grundlage dieses Opfers, durch das Gott völlig befriedigt und verherrlicht worden ist, können nun ehemals sündige Menschen mit Gott ins Reine kommen und Gemeinschaft mit Ihm haben.
Der Herr freute sich über dieses Opfer und nahm es an (Vers 21). Dann erklärte Er, dass Er nie mehr ein solch umfassendes Gericht über die Erde bringen werde. Obwohl sich das natürliche menschliche Herz nicht geändert hatte und sich auch nicht ändern wird, soll nie mehr eine totale Wasserflut die Erde verderben. Solange die erste Schöpfung bestehen bleibt, wird es Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Welch eine Gnade Gottes und welch ein Segen kommen doch in diesen Zusagen zum Ausdruck!
Dass die Sintflut gewaltige klimatische Veränderungen mit sich brachte, erkennt man aus der Tatsache, dass es seither Frost und Hitze, Sommer und Winter gibt. Vor der Flut scheint auf der Erde ein ausgeglichenes Klima geherrscht zu haben (1. Mose 2,6).
Der Regenboben
Nach der Sintflut begann eine neue Zeitperiode des Handelns Gottes mit den Menschen. Aus 1. Mose 1,29.30 wissen wir, dass die Nahrung der Menschen bis zur Flut aus Früchten und Kraut (Gemüse) bestand. Jetzt gab Gott ihnen auch das Fleisch von Tieren zur Speise. Nur das Blut durften sie nicht essen. Die Begründung dafür finden wir z.B. in 3. Mose 17,10-14. Diese Anordnung Gottes gilt auch für die Zeit der Gnade, in der wir leben (Apostelgeschichte 15,19.20.28.29).
Im Weiteren setzte Gott nach der Flut die Regierung des Menschen ein, um das Gute zu belohnen und das Böse einzudämmen und zu bestrafen. Bis heute haben die Regierungsgewalten diese Aufgabe (Römer 13,1-4).
Vers 7 macht klar, dass Noah und seine Söhne nun unter dem Segen Gottes standen, um die gereinigte Erde von neuem zu bevölkern. Gott machte zudem einen Bund mit ihnen und ihren Nachkommen. Doch es war kein Bündnis, das beiden Parteien Verpflichtungen auferlegte, sondern ein einseitiges Versprechen vonseiten Gottes: Nie mehr wird Er ein solches Gericht durch Wasser über die Erde bringen. Als Zeichen dieses Bundes setzte Gott den Regenbogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn wir ihn sehen, können wir uns an diesen Bund Gottes mit uns Menschen erinnern.
Der Apostel Petrus teilt uns mit, dass es noch einmal ein umfassendes Gericht Gottes geben wird, aber dann durch Feuer (2. Petrus 3,7). Es wird das Ende der ersten Schöpfung sein. In der Folge wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen (2. Petrus 3,13; Offenbarung 21,1).
Noah betrinkt sich
Obwohl Noah ein Glaubensmann war und mit Gott lebte, hatte er wie jeder erlöste Mensch noch die böse Begierde in sich, die ihn zum Sündigen verleiten wollte. Wenn wir als Glaubende nicht wachsam sind und das von Gott empfangene neue Leben nicht fördern, kann es vorkommen, dass die alte Natur wieder zum Zug kommt. Dann handeln wir fleischlich und sündigen. Um Sünden in unserem Leben zu vermeiden, werden wir im Wort Gottes aufgefordert, entschieden gegen die Auswüchse der in uns wohnenden Sünde vorzugehen (Kolosser 3,5.8).
Noah liess es an der nötigen Vorsicht fehlen, trank zu viel vom Wein seines Weinbergs und verlor seine Selbstbeherrschung. Ham sah es und erzählte seinen Brüdern unverschämt von der Verfehlung seines Vaters. Sem und Japhet jedoch versuchten ihrem Vater zu helfen, indem sie sein Versagen zudeckten. Als Noah von seinem Rausch erwachte und hörte, was passiert war, segnete er Sem und Japhet, während Ham hören musste: «Verflucht sei Kanaan (ein Sohn Hams)! Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern!»
Interessant ist der Ausdruck in Vers 26, wo der Herr als der Gott Sems bezeichnet wird, während Er nie der Gott Japhets oder der Gott Hams genannt wird. Einen Grund dafür finden wir am Ende von 1. Mose 11 und am Anfang von 1. Mose 12. Dort sehen wir, dass Gott eine Familie hervorhebt, die von Sem abstammt. Es ist Tarah und seine Nachkommen. Mit Abram, einem Sohn Tarahs, wollte Gott sich als der Herr (Jahwe, der Ewigseiende) in besonderer Weise beschäftigen.
Sem, Ham und Japhet (1)
In der Zeit nach der Flut begannen sich die Nachkommen der Söhne Noahs auf der Erde auszubreiten. Die Japhetiten zogen nach Westen und Norden. Sie breiteten sich am stärksten aus.
Unter den Hamiten tritt ein Mann besonders hervor: Nimrod. Zweimal wird von ihm gesagt, dass er ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn war. Einerseits erkennen wir daraus, dass die Menschen noch an Gott dachten. Anderseits legt der Name Nimrod (= sich empören) den Gedanken nahe, dass bei seinen Zügen und Städtebauten sehr viel Eigenwillen und Rebellion gegen Gott im Spiel war. Anstatt den Herrn zu fürchten, lehnte Er sich gegen Ihn auf.
«Der Anfang seines Reiches war Babel.» Der Name Babel oder Babylon zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Zuletzt wird in Offenbarung 18 der endgültige Fall Babylons beschrieben. Babylon ist dort der symbolische Ausdruck für das christliche Bekenntnis, in dem es keine Gläubigen mehr gibt und Christus völlig ausgeschaltet ist. Diese christuslose Christenheit gibt vor, die wahre Kirche zu sein. Doch es ist die falsche Kirche, die dem Herrn Jesus gegenüber höchst untreu geworden ist und schliesslich von Gott gerichtet wird.
Zwei weitere Namen unter den Nachkommen Hams finden wir später in der Bibel wieder: die Philister und die Kanaaniter. Die Philister bewohnten den Gazastreifen im Land Kanaan, das Gott später seinem Eigentumsvolk, den Israeliten, gab. Sie waren erbitterte Feinde Israels, bedrängten sie immer wieder und machten ihnen das Land streitig.
Sem, Ham und Japhet (2)
Sem, der mittlere Sohn Noahs (Vers 21), wird mit seiner Nachkommenschaft zuletzt erwähnt. Das hat seinen Grund. Gott will im weiteren biblischen Bericht vor allem mit den Nachkommen Sems fortfahren. Interessant ist die Bemerkung in Vers 25: «In seinen Tagen wurde die Erde geteilt.» Vielleicht finden wir hier einen Hinweis auf die Entstehung der Kontinente als Folge der Flut.
Obwohl die Sprachenverwirrung erst in Kapitel 11 beschrieben wird, heisst es in Kapitel 10 zusammenfassend, dass sich die Nachkommen der drei Söhne Noahs «nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, nach ihren Nationen» verbreiteten (1. Mose 10,5.20.31). So entstanden mit der Zeit die verschiedenen Völker mit ihren eigenen Mentalitäten.
In der Apostelgeschichte gibt es eine interessante Verbindung zu diesem Kapitel am Anfang der Bibel. Hier heisst es, dass die Erde nach der Flut von den Familien der drei Söhne Noahs wieder bevölkert wurde. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie sich nach dem Kreuzestod des Herrn Jesus das Evangelium nicht nur an die Juden, sondern an alle Völker der Erde richtete (Markus 16,15; Lukas 24,45-47). Die Kapitel 8 bis 10 der Apostelgeschichte berichten uns, wie durch die Verkündigung der guten Botschaft drei verschiedene Männer zum Glauben an den Erlöser Jesus Christus kamen:
- der Kämmerer aus Äthiopien, ein Nachkomme Hams,
- Saulus von Tarsus, ein Nachkomme Sems, und
- der römische Hauptmann Kornelius, ein Nachkomme Japhets.
Wie gross ist Gottes Gnade!
Der Turmbau
Obwohl wir bereits in Kapitel 10 gesehen haben, wie sich die Nachkommen der Söhne Noahs über die Erde verteilten, wird erst jetzt gezeigt, wie es dazu kam. Nach der Flut lebten die Menschen zunächst zusammen. Sie redeten alle eine Sprache. Doch eine Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer, scheinen die meisten von ihnen nicht mehr gehabt zu haben.
Anstatt nach Gottes Anweisung die Erde zu füllen (1. Mose 9,1), wollten sie zusammenbleiben. Davon redet die Stadt, die sie planten. Sie rebellierten damit gegen Gottes Wort. Mit dem Turm, dessen Spitze an den Himmel reichen sollte, demonstrierten jene Menschen ihren Hochmut und ihre Ehrsucht. Heute verfolgen die Menschen andere grossartige Vorhaben. Doch sie beweisen damit nur, dass sie genauso hochmütig und ehrsüchtig sind wie ihre Vorfahren nach der Flut.
Gott antwortete auf die Auflehnung und Überheblichkeit seiner Geschöpfe mit dem Gericht der Sprachenverwirrung. Nun wurden die Menschen durch das Eingreifen Gottes tatsächlich über die ganze Erde zerstreut (1. Mose 11,4.9), so wie Er es von Anfang an gewollt hatte. Die Verständigungsschwierigkeiten zwischen Menschen verschiedener Sprachen sind heute noch Folgen jenes göttlichen Gerichts.
Wir lernen daraus, dass wir Menschen durch unseren Ungehorsam die Absicht Gottes nie durchkreuzen können. Er wird immer zu seinem Ziel kommen, wenn nötig durch Gericht. Dieser Grundsatz gilt auch für unser persönliches Leben.
Die Nachkommen Sems
Ab Vers 10 wird die Linie der Nachkommen von Sem über Peleg (1. Mose 10,25; 11,18) besonders erwähnt. Sie führt zu Tarah, dem Vater von Abraham, der hier noch Abram heisst.
Nach der Flut verfielen die Menschen in Überheblichkeit und Götzendienst. Durch den Bau eines himmelhohen Turmes versuchten sie, so hoch wie Gott zu werden. Anstatt sich Dem zu unterordnen, der ihnen die Herrschaft über die Erde anvertraut hatte, verneigten sie sich vor Götzen (Römer 1,22.23; Josua 24,2).
In seiner grenzenlosen Gnade gab Gott die Menschen jedoch nicht auf, obwohl sie sich von Ihm abgewandt hatten. Er wollte auf eine neue Weise mit ihnen handeln. Dazu ging Er mit einem einzelnen Menschen eine besondere Beziehung ein: Er rief Abram, den Sohn von Tarah, aus dem Götzendienst heraus und offenbarte sich ihm als der Allmächtige. Seine Beziehung zu ihm gründete sich auf göttliche Verheissungen, während Er keine Bedingungen an den Menschen stellte. Mit Abraham begann also die Heilszeit der Verheissungen.
Aus Vers 31 könnte man schliessen, Tarah habe die Initiative ergriffen, um aus Ur in Chaldäa nach Kanaan zu ziehen. Aber aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Gott Abraham bereits in Mesopotamien erschienen war. Dort hatte Er ihm die Anweisung gegeben, sein Land und seine Verwandtschaft zu verlassen, um an einen Ort zu ziehen, den Er ihm zeigen wollte (Apostelgeschichte 7,2-4). Da Abram jedoch mit seiner Verwandtschaft auszog, kam er nur bis Haran.
Einleitung
Johannes zeigt uns, wie der ewige Sohn Gottes als Mensch auf die Erde kam, um Gott als Vater zu offenbaren. Seine Worte und seine Taten waren von Leben, Licht und Liebe geprägt. Doch die Welt lehnte Ihn ab und kreuzigte Ihn. Ist nun alles verloren? Nein! Wer persönlich an den Sohn Gottes glaubt, bekommt ewiges Leben und wird ein Kind Gottes.
Das Evangelium kann wie folgt eingeteilt werden:
- Kapitel 1 – 2: Einführung
- Kapitel 3 – 7: Leben
- Kapitel 8 – 12: Licht
- Kapitel 13 – 17: Liebe
- Kapitel 18 – 20: Tod und Auferstehung
- Kapitel 21: Schluss
Der ewige Sohn Gottes
Die Verse 1-3 gehen in die Ewigkeit zurück – als noch nichts geschaffen war – und stellen uns den Sohn Gottes als das «Wort» vor, d.h. als den Ausdruck dessen, was Gott ist. Er hat eine ewige, göttliche Existenz und unterscheidet sich in seiner Person von Gott, dem Vater, und Gott, dem Heiligen Geist. Ausserdem ist Er der Schöpfer von Himmel und Erde.
Im Gegensatz zu Adam, der sein Leben vom Schöpfer bekommen hat, besitzt der Sohn Gottes Leben in sich selbst. Dieses göttliche Leben offenbarte sich, als Er auf die Erde kam und unter Menschen lebte. Wie ein helles Licht strahlte es in die Dunkelheit der Gottlosigkeit und des moralischen Verderbens hinein.
Jeder, der mit dem Sohn Gottes in Kontakt kam, wurde ins göttliche Licht gestellt (Vers 9). Sein ganzes Leben mit all seinen Sünden wurde offenbar. Ein eindrückliches Beispiel dazu finden wir in Johannes 8,1-11. Dort beleuchtete der Herr Jesus das Leben einiger Schriftgelehrter und Pharisäer. Doch sie wichen dem Licht aus und verliessen Ihn. Obwohl Er von Gott zu ihnen gekommen war, nahmen sie Ihn nicht an. So wie Ihn damals die meisten Juden ablehnten, so wollen auch heute viele Menschen nichts von Ihm wissen.
Durch Gottes Gnade gibt es jedoch Einzelne, die das göttliche Urteil über ihr Leben anerkennen und an den Herrn Jesus glauben. Dadurch werden sie Kinder Gottes. Diesen Platz in der Familie Gottes bekommen sie nicht aufgrund ihrer natürlichen Abstammung oder ihrer eigenen Leistung, sondern durch die Neugeburt, die Gott in ihnen bewirkt.
Der Sohn Gottes wird Mensch
Vor 2000 Jahren wurde der ewige Sohn Gottes Mensch und lebte voller Gnade und Wahrheit unter uns:
- Er offenbarte die göttliche Gnade, die dem Sünder entgegenkommt und ihn retten will.
- Er stellte auch die göttliche Wahrheit vor, die klarmacht, dass wir gesündigt und das göttliche Gericht verdient haben.
Äusserlich war Jesus Christus keine beeindruckende Erscheinung (Jesaja 53,2). Aber der Glaubende sah in Ihm den eingeborenen Sohn des Vaters, wie Er von Ihm geliebt und geschätzt wird.
Johannes der Täufer kündigte das Kommen des Sohnes Gottes an und machte seine Majestät bekannt: Obwohl Jesus in Israel zeitlich nach Johannes auftrat, stand Er doch rangmässig über ihm, denn Er ist in seiner Existenz als Sohn Gottes ewig.
Das Gesetz stellte Forderungen an den Menschen, die keiner erfüllen konnte. Der Herr Jesus hingegen brachte uns die Gnade, aber nicht auf Kosten der Wahrheit. Er gab am Kreuz sein Leben, um allen Ansprüchen Gottes zu genügen und so die Wahrheit aufrechtzuerhalten. Auf dieser gerechten Grundlage kann die Gnade bis heute zu allen Menschen ausfliessen. Jeder, der das für ihn kostenlose Angebot zur Erlösung im Glauben annimmt, bekommt im Herrn Jesus das ganze Mass des göttlichen Segens: Gnade um Gnade (Vers 16).
Weil der Sohn Gottes im Schoss des Vaters ist und Ihn völlig kennt, war Er in der Lage, Gott in seiner Liebe zu offenbaren. Er ist Mensch geworden, damit wir in Ihm den Vater erkennen können (Johannes 14,9).
Eine Stimme in der Wüste
Nach der Einleitung über den Sohn Gottes (Johannes 1,1-18) folgt nun der Bericht über das Zeugnis von Johannes dem Täufer. Als er seinen Dienst begann und die Menschen zur Buße aufrief, fragten sich die Juden von Jerusalem, wer er wohl sei. Darum sandten sie Priester und Leviten zu ihm. Obwohl Johannes nicht gern von sich selbst redete, gab er auf ihre Fragen eine klare Antwort:
- «Wer bist du?» – Er war nicht der Messias, der im Alten Testament angekündigt war und von vielen Juden erwartet wurde.
- «Bist du Elia?» – Nein, Johannes trat nicht als der Prophet Elia auf, der vor dem Tag des Herrn kommen wird (Maleachi 3,23).
- «Bist du der Prophet?» – Nein, dieser Prophet, den Mose angekündigt hatte (5. Mose 18,15), würde der Herr Jesus selbst sein.
Johannes war nur die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Er kam als Bote Gottes, um im Herzen und Leben der Israeliten den Weg für den Sohn Gottes bereit zu machen. Das tat er auf zweierlei Weise:
- Er forderte alle auf, über ihr sündiges Leben Buße zu tun und zu Gott umzukehren (Matthäus 3,2).
- Die Menschen, die ihre Sünden bekannten, taufte er mit Wasser, um sie so von der ungläubigen Masse des Volkes abzusondern.
Das Verhalten von Johannes ist vorbildlich für jeden Diener des Herrn: Er hält nichts von sich selbst und stellt die Grösse und Herrlichkeit des Sohnes Gottes in den Mittelpunkt (Vers 27).
Siehe, das Lamm Gottes!
Dieser Abschnitt enthält das Zeugnis von Johannes über den Herrn Jesus. Zuerst erklärt er seinen Zuhörern: «Siehe, das Lamm Gottes …» Mit dieser Aussage macht er klar, dass Jesus Christus das Opferlamm ist, das Gott selbst gibt, um das Problem der Sünde zu lösen. Darum fährt Johannes fort: «… das die Sünde der Welt wegnimmt.» Der Heiland hat durch seinen Opfertod am Kreuz Gott in Bezug auf die Sünde unendlich und für immer verherrlicht. Als Folge davon wird die Sünde mit all ihren Konsequenzen einmal aus dem Weltall weggetan werden.
Die Worte in Vers 30 decken sich inhaltlich mit Vers 15: Johannes kam als Vorläufer des Herrn zeitlich vor Ihm. Aber Christus steht rangmässig höher als Johannes, denn Er ist der Sohn Gottes. Obwohl das Lamm Gottes für die ganze Welt gekommen war, sollte das Zeugnis über Ihn in Israel abgelegt werden, das bis zu diesem Zeitpunkt im Handeln Gottes eine Vorzugsstellung unter den Völkern einnahm.
Johannes der Täufer war Augenzeuge, als der Geist Gottes wie eine Taube aus dem Himmel herniederkam und auf Jesus Christus blieb. Dieses eindrucksvolle Ereignis nach seiner Taufe bestätigte einerseits seine wahre, aber sündlose Menschheit. Anderseits bewies es, dass Er Gottes Sohn ist. An diese doppelte Tatsache knüpfte Johannes ein weiteres Zeugnis an: Jesus Christus würde mit Heiligem Geist taufen. Das geschah nach seiner Himmelfahrt, als Er an Pfingsten die «Verheissung des Heiligen Geistes vom Vater» empfing und auf die Glaubenden ausgoss (Apostelgeschichte 2,33).
Wo hältst du dich auf?
Diese Verse beschreiben die Wirkung, die das Zeugnis von Johannes am nächsten Tag auf zwei Menschen hatte. Wieder blickte er auf Jesus und sprach: «Siehe, das Lamm Gottes!» Das veranlasste die beiden Jünger, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Sie wollten Den, der Johannes so viel bedeutete, persönlich kennen lernen.
Als Jesus sie nachfolgen sah, prüfte Er sie mit einer Frage: «Was sucht ihr?» Strebten sie nach Ehre und Anerkennung? Oder wollten sie einfach in seiner Nähe sein? Ihre Gegenfrage offenbarte ihre Einstellung: «Lehrer, wo hältst du dich auf?» Sie unterstellten sich seiner Autorität und suchten die Gemeinschaft mit Ihm.
Das gilt auch für uns. Dem Herrn Jesus zu gehorchen und seine Gemeinschaft zu geniessen ist das, was uns in seiner Nachfolge glücklich macht. Deshalb sagt Er uns das Gleiche wie den beiden Jüngern: «Kommt und seht!» Nur durch persönliche Erfahrung im Alltag lernen wir den Segen wirklicher Jüngerschaft kennen.
Für Andreas war dieser Tag mit Jesus Christus so eindrucksvoll, dass er sofort seinen Bruder aufsuchte und ihm erklärte: «Wir haben den Messias gefunden.» Was konnte er Besseres tun, als Simon zum Heiland zu führen? Dieser empfing ihn mit folgenden Worten:
- «Du bist Simon.» Damit erklärte Er diesem spontanen und lebhaften Menschen, dass Er sein ganzes Leben mit allem, was bisher schief gelaufen war, kannte.
- «Du wirst Kephas heissen.» Diese Aussage zeugt von der Macht des Sohnes Gottes, glaubende Menschen zum Guten zu verändern, um sie zu sammeln und reich zu segnen.
Philippus und Nathanael
Wir haben in den Versen 35-42 gesehen, wie der Sohn Gottes zum Sammelpunkt der Glaubenden wird. Jener Abschnitt spricht prophetisch von der Gnadenzeit, in der Menschen gesammelt werden, um Steine am Haus Gottes zu sein. Petrus ist ein deutliches Beispiel davon.
In den Versen 43-51 beginnt der Herr, Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Auch dieser Abschnitt hat eine prophetische Bedeutung: In der Zukunft wird ein glaubender Überrest aus Israel zusammengebracht, der Jesus als Messias anerkennen wird. Nathanael ist ein eindrücklicher Vertreter dieses Überrests.
Jesus spricht zu Philippus: «Folge mir nach!» Damit sondert Er ihn von der Welt ab und führt ihn auf den Glaubensweg, den er mit Ihm gehen kann. Bis heute erfährt jeder Jünger, der diesen Weg in der Nachfolge des Herrn geht, die Schmach der Welt und die Freude in der Gemeinschaft mit Gott.
Philippus möchte auch Nathanael für Jesus Christus gewinnen. Als dieser seine Zweifel äussert, diskutiert er nicht mit ihm, sondern sagt einfach: «Komm und sieh!» Er fordert Nathanael auf, sich selbst Klarheit zu verschaffen. Der Sohn Gottes empfängt ihn mit den Worten: «Wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist.» Damit anerkennt Er seine Gottesfurcht und Aufrichtigkeit. Als Er in Vers 48 seine Allwissenheit offenbart, glaubt Nathanael, dass Jesus der König Israels ist (Psalm 2,6.7). Da teilt ihm der Herr eine grössere Herrlichkeit seiner Person mit: Er ist der Sohn des Menschen, der einmal über das Universum regieren wird (Psalm 8,5-7).
Die Hochzeit in Kana
Mit der Hochzeit von Kana kommt das prophetische Bild zum Höhepunkt: Im Tausendjährigen Reich wird Christus seinem erlösten Volk bleibende Freude schenken.
Die Anwesenheit von Maria, der Mutter Jesu, weist auf das natürliche Verhältnis hin, das der Herr durch Geburt zu seinem irdischen Volk hat. Aber aufgrund dieser Beziehung gibt es für Israel keinen Segen, weil es Ihn als Messias verworfen hat. Darum spricht Er zu seiner Mutter: «Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau?» Dennoch hat dieses Volk eine herrliche Zukunft vor sich: Als Auferstandener wird Christus eine neue Beziehung zu Israel eingehen und es reich segnen.
So wie der Wein während der Feier ausging, geht jede irdische Freude einmal zu Ende. Doch der Herr Jesus will uns dauerhafte Freude geben. Darum fordert Er uns auf: «Füllt die Wasserkrüge mit Wasser!» Das Wasser spricht vom Wort Gottes in seiner reinigenden Kraft (Epheser 5,26). Es macht uns auf Verkehrtes im Leben aufmerksam, damit wir es in Ordnung bringen. Als Folge davon erleben wir echte und bleibende Freude in der Gemeinschaft mit Jesus Christus.
Der erste Wein war von weniger guter Qualität als der zweite (Vers 10). So ist auch die Freude, die wir uns selbst verschaffen, geringer als die Freude, die der Herr Jesus uns schenkt.
Der Sohn Gottes tat dieses Zeichen in Galiläa, wo die einfachen Menschen des Volkes wohnten. Sie waren empfänglicher für seine Gnade als die Juden in Jerusalem. Darum offenbarte Er vor allem ihnen die Herrlichkeit seiner Person.
Die Tempelreinigung
Mit der Tempelreinigung bezeugte der Herr seine Autorität. Als Sohn Gottes hatte Er das Recht, in seinem Haus für Ordnung zu sorgen. Gleichzeitig weist diese Handlung in die Zukunft: Bei seinem Kommen in Herrlichkeit wird Christus den Tempel durch Gericht reinigen (Maleachi 3,1.2).
Die Verkäufer und Wechsler hatten das Haus des Herrn zu einem Ort gemacht, wo man Geld verdienen konnte. Sie nutzten den Bedarf an Opfertieren und Wechselgeld aus, um sich zu bereichern. – Wie traurig, dass es auch heute Menschen gibt, die aus dem christlichen Glauben ein einträgliches Geschäft machen!
Der Herr Jesus entfernte alles, was den Tempel verunreinigte und nicht in die Gegenwart Gottes passte. Mit Eifer setzte Er sich im Haus Gottes für die Aufrechterhaltung seiner Heiligkeit ein. – Genauso sollten wir in der Versammlung (Gemeinde) besorgt sein, dass alles der göttlichen Heiligkeit entspricht.
Mit der Frage in Vers 18 forderten die Juden von Jesus Christus einen Beweis für das Recht der Tempelreinigung. Darauf teilte Er ihnen zweierlei mit:
- Sein menschlicher Körper war der wahre Tempel, in dem Gott wohnte (Kolosser 1,19).
- Nach seinem Kreuzestod würde Er auferstehen und damit beweisen, dass Er Gottes Sohn ist (Römer 1,4).
Die Menschen in Vers 23 glaubten aus verstandesmässiger Überzeugung, dass Jesus durch Wunder mächtig wirkte. Aber die Frage ihrer Sünden und ihrer Beziehung zu Gott blieb unberührt, weil in ihren Herzen kein Werk der Buße und Umkehr stattfand.
Die Neugeburt
Nikodemus war überzeugt, dass die Botschaft, die der Herr Jesus verkündete, ihre Quelle in Gott hatte. Zudem waren in seinem Herzen echte, unbefriedigte Bedürfnisse vorhanden. Deshalb suchte er Ihn auf. Er tat es bei Nacht, weil er spürte, dass er bei diesem Schritt die Welt gegen sich hatte.
Der Herr ging nicht auf seine wohlformulierten Worte ein, sondern sprach direkt das Kernproblem des Menschen an. Er ist in seinem Zustand vor Gott verloren und kann nicht verbessert werden. Darum muss er von neuem geboren werden, um wirklich und bleibend ins Reich Gottes zu kommen (Johannes 3,3.5).
Weil Nikodemus in seinen Überlegungen innerhalb der Grenzen des natürlichen Menschen blieb, schien es ihm unmöglich, dass jemand von neuem geboren werden kann. Da wurde der Sohn Gottes in seiner Belehrung deutlicher: Der Heilige Geist wendet das reinigende Wasser des Wortes Gottes auf den glaubenden Menschen an und schenkt ihm neues, göttliches Leben. Die Neugeburt ist also ein Werk Gottes.
In Vers 6 stellt der Herr zwei Tatsachen vor: Einerseits ist jeder Mensch von seiner Geburt an ein Sünder. Daran kann er nichts ändern. Anderseits besitzt jeder Glaubende durch die Neugeburt eine neue, göttliche Natur. – In Vers 8 benutzt Er das Beispiel des Windes, um das Wirken des Geistes Gottes zu erklären. Wie man den Wind nicht sehen kann, so ist das Werk der Neugeburt in einem Menschen nicht wahrnehmbar. Aber so wie das Sausen des Windes gehört wird, macht sich auch das neue Leben im Glaubenden bemerkbar.
Das ewige Leben
Als Lehrer Israels hätte Nikodemus die Mitteilungen über die Neugeburt verstehen können, denn diese Wahrheit wird schon im Alten Testament erwähnt (Hesekiel 36,24-29) und ist in ihrem Charakter irdisch (Vers 12a).
Ab Vers 11 geht es um eine himmlische Botschaft. Kein Mensch ist in den Himmel hinaufgestiegen und wieder herabgekommen, um auf der Erde von dem zu reden, was im Himmel ist. Nur der Sohn Gottes, der als Mensch auf die Erde gekommen ist, kann uns das Himmlische mitteilen: Es ist das ewige Leben, das Gott in der Zeit der Gnade jedem schenkt, der an seinen Sohn Jesus Christus glaubt. Diese himmlische Wahrheit war im Alten Testament nicht bekannt.
Damit der Mensch das ewige Leben bekommen kann, muss das Problem der Sünde Gott gemäss gelöst werden. Darum spricht der Herr Jesus nun von seinem Tod am Kreuz:
- Die Verse 14 und 15 zeigen die Seite des Menschen: Der heilige und gerechte Gott forderte ein Opfer für die Sünde. Der Mensch Jesus Christus musste am Kreuz das Werk der Erlösung vollbringen, um die Sünde wegzutun.
- Vers 16 stellt uns die Seite Gottes vor: In seiner unergründlichen Liebe zu allen Menschen gab Gott seinen einzigen und einzigartigen Sohn für sündige Menschen in den Tod.
Die Auswirkungen seines Opfers sind gewaltig: Wer an Ihn glaubt, hat kein Strafgericht mehr zu befürchten, sondern kommt in eine glückliche Beziehung zu Gott.
Rettung oder Gericht
Obwohl die Menschen Gott verunehrt und beleidigt hatten, sandte Er seinen Sohn nicht als Richter, sondern als Retter zu ihnen. Warum? Weil Gott Liebe ist. Doch es werden nicht alle automatisch vor dem kommenden Gericht gerettet. Nur die, die an den Herrn Jesus glauben, werden von der Strafe freigesprochen.
Vers 19 zeigt, was Gott den ungläubigen Menschen einmal zur Last legen wird: Der Sohn Gottes ist als das Licht in die Welt gekommen und hat ihnen gezeigt, dass Gott sie liebt und ihnen in Jesus Christus seine rettende Gnade anbietet. Doch sie haben seine Liebe nicht gewollt und ein sündiges Leben im Dunkeln einer geordneten Beziehung zu Ihm vorgezogen.
Die Verse 20 und 21 stellen einen doppelten Grundsatz vor:
- Der Ungläubige, der das Böse tut, fürchtet sich vor der Gegenwart Gottes, weil er nicht will, dass seine Sünden ans Licht kommen.
- Der Gläubige, der ein gutes Gewissen hat, kommt freimütig zu Gott und freut sich, im Licht seiner Gegenwart zu leben.
Ab Vers 22 sehen wir, wie die Aufgabe von Johannes dem Täufer zu Ende ging und der Herr Jesus im Begriff stand, in Israel öffentlich in Erscheinung zu treten. Bis jetzt hatte sein eigentlicher Dienst noch nicht begonnen, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Weil sowohl Jesus als auch Johannes am Jordan tauften, musste nun die Frage geklärt werden, in welcher Beziehung sie zueinander standen. Die Antwort finden wir in den Versen 27-30.
Er muss wachsen, ich aber abnehmen
Die Jünger des Johannes hatten Mühe, dass immer mehr Menschen zu Jesus gingen, um sich von seinen Jüngern taufen zu lassen. Wie ging Johannes der Täufer damit um? Er freute sich darüber, weil er nur von Christus erfüllt war! Seine Worte zeigen einerseits seine Herzensdemut und anderseits den stellungsmässigen Unterschied zwischen dem Herrn und ihm.
Johannes wusste, dass er seinen Dienst als ein Geschenk von Gott bekommen hatte (Vers 27). Das machte ihn demütig. Es war sein Auftrag, als Vorläufer und Wegbereiter des Messias in Israel zu wirken. Als Freund des Bräutigams freute er sich, dass der Herr Jesus im Zentrum stand und die Menschen seiner Verkündigung zuhörten. Johannes war sich zweierlei bewusst:
- Christus musste in seinem Dienst und in seinem Einfluss unter den Menschen zunehmen.
- Sein Vorläufer hingegen musste langsam vom Schauplatz verschwinden und in den Hintergrund treten.
Der Sohn Gottes kam von oben, d.h. aus dem Himmel. Er stand weit über allen und verkündete eine himmlische Botschaft. Johannes der Täufer war ein Mensch von der Erde wie wir. Sein Dienst beschränkte sich auf das Irdische (Buße, Taufe, praktische Gerechtigkeit).
Die Verse 35 und 36 führen eine weitere Wahrheit über den Herrn Jesus ein. Er war nicht nur ein Gesandter vom Himmel mit einer göttlichen Botschaft, sondern der ewige Sohn Gottes, der vom Vater geliebt wird. Weil der Vater alles in seine Hände gegeben hat, kann der Mensch nur durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben bekommen.
Am Brunnen zu Sichar
Der Herr Jesus verliess Judäa, weil Ihn die Eifersucht und Ablehnung der Juden wegtrieb. Auf dem Weg nach Galiläa musste Er durch Samaria ziehen. Das war der göttliche Auftrag, den Er gehorsam und gern ausführte. Die Menschen aus Samaria hatten eine gemischte Lebensführung. Ursprünglich gehörten sie nicht zu Israel, hatten sich aber mit diesem Volk vermischt. So dienten sie zum einen fremden Göttern. Zum anderen standen sie in einer äusseren Beziehung zum lebendigen Gott und beteten Ihn auf dem Berg Gerisim an. Aus diesem Grund verachteten die Juden die Samariter und pflegten im Allgemeinen keinen Umgang mit ihnen.
Am Brunnen ruhte sich Jesus Christus ein wenig aus, während seine Jünger in der Stadt etwas zu essen kauften. Wie empfand Er als wahrer, sündloser Mensch, was es bedeutet, Hunger und Durst zu haben oder müde zu sein! Dennoch war Er jederzeit bereit, den Menschen zu helfen und ihnen die göttliche Gnade vorzustellen.
Als eine Frau zur Quelle kam, um Wasser zu schöpfen, bat Er sie demütig: «Gib mir zu trinken!» Weil Er kein Schöpfgefäss besass, war Er auf ihre Hilfe angewiesen, um seinen Durst zu stillen. Gleichzeitig wollte der Heiland mit dieser Bitte das Herz der sündigen Frau erreichen, um ihr Vertrauen zu gewinnen.
Sie war sehr erstaunt, dass Er sich als Jude herabliess, mit ihr zu reden, obwohl sie eine Samariterin war und einen schlechten Lebenswandel führte. Ihre Verwunderung zeigt, dass sie ihr Herz dem Sohn Gottes nicht verschloss, sondern bereit war, Ihm zuzuhören.
Das lebendige Wasser
Zuerst weckte der Heiland das Interesse der Frau für die göttliche Gnade. Gott hatte ein Geschenk für sie bereit, das Er ihr durch seinen Sohn Jesus Christus geben wollte. Es ist das «lebendige Wasser» – ein Sinnbild des ewigen Lebens, wie es durch die Kraft des Heiligen Geistes genossen wird.
Die Gedanken der Frau gingen nicht über die Mühe des irdischen Lebens hinaus. Immer wieder musste sie zum Brunnen gehen, um Wasser zu schöpfen. Da machte ihr der Herr Jesus klar, dass alles, was die Erde und die Welt dem Menschen bietet, keine echte Befriedigung gibt. Der Durst nach wahrer Lebenserfüllung bleibt bestehen. Aber der Sohn Gottes bietet ein «Wasser» an, das diesen Durst für immer stillt. Er schenkt jedem, der an Ihn glaubt, ewiges Leben, das sich durch den Heiligen Geist entfaltet. Diese Energie des neuen Lebens ist wie ein aufsteigender starker Wasserstrahl, der uns in eine glückliche Gemeinschaft mit Gott bringt. Diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn – die wir jetzt und bald ewig im Vaterhaus geniessen – gibt uns einen echten Lebenssinn und eine tiefe Freude.
Die Frau verlangte nach diesem Wasser, weil sie das alte, sündige Leben mit seinem Elend und seiner Mühe satt hatte. Da sprach der Heiland ihr Gewissen an: «Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher!» Da gab sie zur Antwort: «Ich habe keinen Mann.» Dieses Bekenntnis war aufrichtig, aber nicht vollständig, so dass der Herr es einerseits anerkannte und anderseits ergänzte. Als Er die Wahrheit völlig ans Licht brachte, stand die Frau dazu und bekehrte sich zu Gott.
Wahrhaftige Anbeter
Als die Frau erkennt, dass Jesus ein Prophet Gottes ist, stellt sie Ihm eine Frage, die sie schon lange beschäftigt: Welches ist der richtige Ort der Anbetung? Ist es der Berg Gerisim, wo menschliche Ideen den Gottesdienst prägen? Oder ist es der Tempel in Jerusalem, den Gott als Ort der Anbetung bestimmt hat?
In seiner Antwort macht der Herr Jesus klar, dass durch sein Kommen eine neue Zeit angebrochen ist, in der Gott entsprechend seiner Offenbarung im Sohn als Vater angebetet wird. Wahrhaftige Anbeter sind Menschen, die an Jesus Christus glauben, ewiges Leben besitzen und den Heiligen Geist in sich haben. Aus dieser neuen Stellung heraus können sie den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Christliche Anbetung ist freiwillig (Vers 23), erfordert jedoch Abhängigkeit und Gehorsam (Vers 24), damit dem Wunsch des Vaters in der richtigen Weise entsprochen wird.
Die Frau versteht nicht viel von dem, was der Herr über Anbetung sagt. Aber sie lernt Ihn als den angekündigten Messias kennen. Ab Vers 28 werden die Ergebnisse ihres Glaubens an Jesus Christus sichtbar:
- Sie lässt den Wasserkrug stehen und geht weg in die Stadt. Weil ihre inneren Bedürfnisse bei Christus gestillt worden sind, ist ihr Herz nicht mehr auf das Irdische fixiert.
- Sie erzählt den Leuten vom Herrn Jesus, der alles über ihr Leben weiss. Schlicht und einfach lädt sie ihre Mitmenschen ein, zum Heiland zu kommen. Mit dem Hinweis «Dieser ist doch nicht etwa der Christus?» weckt sie das Interesse für Ihn.
Säen und ernten
In diesen Versen möchte der Herr Jesus die Gedanken der Jünger vom Natürlichen zum Geistlichen lenken.
- Als sie Ihn baten, von dem zu essen, was sie eingekauft hatten, sprach Er von seiner geistlichen Speise. Es war sein tiefes Verlangen, den Willen und das Werk Gottes zu tun. Von der Krippe bis zu seiner Himmelfahrt erfüllte Er mit Freude den Auftrag seines Vaters. Ihm zu gehorchen und unter den Menschen in Gnade zu wirken, das war es, was sein Herz befriedigte und sättigte.
- Die Jünger wussten, dass es noch vier Monate bis zur Getreideernte dauerte. Doch nun sollten sie ihre Augen auf die geistliche Ernte richten. Dieses Getreide war schon reif, denn es gab viele Menschen, die wie die Frau von Sichar ein Verlangen nach Vergebung und ewigem Leben hatten. Sie sollten die Botschaft der göttlichen Gnade hören, um gerettet zu werden.
Die Erntearbeit spricht hier also von der Verkündigung und Verbreitung des Evangeliums, damit Menschen sich bekehren und als Frucht zum ewigen Leben gesammelt werden. Weil diese Aufgabe grossen Einsatz erfordert und auf manche Ablehnung stösst, stellt der Herr einen Lohn in Aussicht.
Die Jünger traten in eine Arbeit ein, die andere schon begonnen hatten. Die Propheten im Alten Testament hatten das Wort gesät und den Messias angekündigt. Auch Johannes der Täufer hatte in Israel gewirkt und die Menschen zur Buße aufgefordert. Auf diese Aussaat folgte nun die Arbeit der Apostel. In der Zeit der Gnade brachten sie eine grosse Ernte für Gott ein.
Der Heiland der Welt
Die Frau, die sich am Brunnen bekehrt hatte, legte ein kraftvolles Zeugnis von Jesus Christus ab. Die Veränderung in ihrem Leben unterstrich ihre Worte, so dass viele in der Stadt an Ihn glaubten. – Genauso möchte der Herr Jesus uns gebrauchen, um Menschen zum rettenden Glauben zu führen.
Die Samariter baten den Heiland, bei ihnen zu bleiben. Weil sie an Ihn glaubten, wünschten sie Ihn in ihrer Nähe zu haben. – Das ist ein Kennzeichen des neuen Lebens: Jungbekehrte haben den Wunsch, den Herrn Jesus in ihr ganzes Leben aufzunehmen und Gemeinschaft mit Ihm zu haben.
Die Menschen aus Sichar hörten die Botschaft des Sohnes Gottes und kamen zur Überzeugung, dass Er der Heiland der Welt ist. – So wichtig es ist, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen, noch wichtiger ist es, dass Gottes Wort ihre Gewissen und Herzen anspricht. Der Glaube soll sich nicht auf menschliche Worte abstützen, sondern seine Grundlage in dem finden, was Gott gesagt hat.
Jesus ist bis heute der Heiland der Welt (1. Johannes 4,14). In seiner unendlichen Gnade will Er alle Menschen erretten. Weil Er am Kreuz sein Leben als Lösegeld für alle gegeben hat, kann jeder zu Ihm kommen und durch den Glauben an Ihn gerettet werden.
Zwei Tage später zog der Herr Jesus nach Galiläa weiter. Die Menschen aus dieser Gegend unterschieden sich von den Samaritern. Sie nahmen den Herrn wegen der Wunder auf, die Er in Jerusalem getan hatte. Tiefer ging ihr Glaube nicht.
Der Sohn des königlichen Beamten
Der Sohn eines königlichen Beamten aus Kapernaum war todkrank. Da scheute der Vater keine Mühe und reiste nach Kana, um beim Heiland Hilfe zu suchen. Weil er glaubte, dass Jesus Christus Wunder tun und Kranke heilen konnte, bat er Ihn, nach Kapernaum zu kommen und seinen Sohn gesund zu machen. Nun wurde sein Glaube zweimal auf die Probe gestellt:
- Zuerst prüfte der Herr die Echtheit des Glaubens (Vers 48). Handelte der Beamte aus einer echten Not heraus oder wollte er in seinem Haus ein sensationelles Wunder erleben? Seine Antwort offenbarte die tiefe Sorge um seinen kranken Sohn und den Glauben an die Person des Herrn Jesus.
- Dann kam die zweite Prüfung: Wie reagierte er, als Jesus Christus erklärte: «Geh hin, dein Sohn lebt!» Glaubte er dem Wort des Sohnes Gottes? Ja, er ging nach Hause, weil er überzeugt war, dass der Heiland sein Wort wahr machen und den Sohn heilen würde.
Auf dem Heimweg kamen ihm seine Knechte mit der guten Nachricht entgegen, dass es dem Knaben besser gehe. In dem Moment, als der Sohn Gottes gesprochen und der Vater geglaubt hatte, hatte das Fieber den Kranken verlassen. So wurde dieser Mann vom Glauben an Zeichen und Wunder zum Glauben an Gottes Wort geführt. Ausserdem wirkte sich diese Erfahrung mit dem Herrn Jesus positiv auf die ganze Familie aus: Sie glaubten alle an Ihn (Vers 53). Folglich erkennen wir hier, wie Gott in dieser Familie durch die erlebte Schwierigkeit den Glauben vertieft und ausdehnt. Auch bei uns verfolgt Er in familiären Nöten das gleiche Ziel.
Der Kranke am Teich Bethesda
Der Sohn Gottes ging nach Jerusalem, um mitten im toten System des Judentums, das seine Feste ohne Gott feierte, seine lebendig machende Kraft zu entfalten.
Die Säulenhallen am Teich Bethesda offenbarten zweierlei:
- Den schlechten geistlichen Zustand des Volkes, denn es gab dort viele kranke Menschen (2. Mose 15,26).
- Die Gnade Gottes, die trotz des Versagens Israels ab und zu durch einen Engel einzelne Kranke heilte.
Jesus traf dort einen Menschen, der schon 38 Jahre krank war. Er konnte selbst nicht schnell genug in den Teich steigen, und es war niemand da, der ihm dabei half. Auf die Frage des Herrn bekannte er sein eigenes Unvermögen und seine falsche Hoffnung auf menschliche Hilfe.
Dieser Mann stellt den natürlichen Menschen in seinem sündigen Zustand dar. Durch die Sünde in ihm ist er unfähig, die Gebote Gottes zu halten. Ausserdem kann er nichts zu seiner Erlösung beitragen. Alles hängt von Gott ab. Sobald der Mensch zu dieser Einsicht kommt, ist er bereit, die Hilfe des Heilands anzunehmen.
«Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher!» In diesen Worten liegt göttliche Macht zur Heilung. So wurde der Kranke augenblicklich gesund. Er besass nun die Kraft, selbst zu gehen. Mühelos trug er das Bett, auf dem er vorher schwach und krank gelegen hatte.
Diese Veränderung findet im übertragenen Sinn auch bei einem Menschen statt, der sich bekehrt. Vorher war es ihm unmöglich, Gott zu gefallen. Nun kann er in der Kraft des Heiligen Geistes für Gott leben.
Die Juden widerstehen Jesus
Die Juden ärgerten sich, dass der Geheilte am Sabbat sein Bett trug. Aus religiöser Pflichterfüllung pochten sie auf die Einhaltung des Sabbatgebots, anstatt sich über die Heilung dieses Mannes zu freuen, der so viele Jahre krank gewesen war. Sofort suchten sie nach dem «Schuldigen», der den Sabbat gebrochen hatte. Wie hart waren doch ihre Herzen!
In Israel war eine Krankheit oft die unmittelbare Konsequenz einer Sünde, da die Juden unter der direkten göttlichen Regierung standen. Nun hatte Jesus Christus in Macht und Gnade den Kranken geheilt und ihm diese Folge weggenommen. Als Er im Tempel wieder mit ihm zusammentraf, forderte Er den Geheilten jedoch auf, nicht mehr zu sündigen.
Sobald die Juden erfuhren, dass Jesus den Kranken am Sabbat gesund gemacht hatte, wollten sie Ihn töten. Warum? Weil der Sabbat das ganze jüdische System repräsentierte. Wer das Sabbatgebot antastete, stellte das ganze Judentum infrage.
Seitdem die Sünde in die Welt gekommen war, konnte Gott bei den Menschen nicht mehr ruhen. Daran änderte auch das Halten des Sabbats nichts. Darum erklärte der Sohn Gottes: «Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke.» Da wegen der Sünde keine Ruhe möglich war, wirkte Gott in Gnade. Mit dieser schönen Antwort reagierte der Herr auf den Angriff der Juden. Sie verstanden sofort, was Er sagte. Doch in ihrem Unglauben wollten sie Ihn nicht als Sohn Gottes anerkennen. Stattdessen bezeichneten sie Ihn als Gotteslästerer und suchten Ihn deswegen zu töten.
Der Sohn macht lebendig
In diesem Kapitel werden uns zwei wichtige Tatsachen über die Person des Herrn Jesus vorgestellt:
- Er ist der Sohn Gottes. Als solcher hat Er die gleiche Ehre und die gleiche Macht wie der Vater. Er steht auf der gleichen Stufe wie der Vater und ist völlig eins mit Ihm (Vers 17).
- Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. In seinem Leben auf der Erde – als Gott und Mensch in einer Person – hat Er eine Stellung der Unterordnung unter den Vater eingenommen (Vers 19).
Deshalb handelte Jesus Christus immer in Abhängigkeit vom Vater und in Übereinstimmung mit Ihm. Gleichzeitig bestand zwischen dem Vater im Himmel und dem Sohn auf der Erde eine vollkommene Beziehung der Liebe.
Im Auftrag des Vaters würde der Sohn nicht nur Kranke heilen, sondern auch glaubenden Menschen ewiges Leben geben. Das zweite Werk ist grösser als das erste, weil es sich auf die Ewigkeit auswirkt.
In den Versen 21 und 22 gibt der Herr zwei Beweise seiner göttlichen Rechte:
- Er gibt Leben, wem Er will, d.h. unabhängig von irgendwelchen Vorzügen, die ein Mensch zu haben meint.
- Der Vater hat dem Sohn das Gericht übergeben, damit Er als Mensch die Ungläubigen richte.
In Vers 24 zeigt Er uns, wie wir zu denen gehören können, die ewiges Leben bekommen und nicht gerichtet werden: Wenn wir seine Worte annehmen und an Gott, den Vater, glauben, der seinen Sohn zu uns gesandt hat, kommen wir aus unserem toten Zustand heraus und beginnen mit Jesus Christus das wirkliche Leben.
Die Stimme des Sohnes Gottes
Die «Stunde» in Vers 25 ist die Stunde der Gnade. Sie umfasst sowohl die Zeit, in der Jesus auf der Erde wirkte, als auch die Zeit, in der Er im Himmel ist und durch den Heiligen Geist auf der Erde ein Werk tut.
In dieser Stunde macht der Sohn lebendig! Er richtet eine Botschaft an die Menschen, die in ihren Sünden tot sind. Wer auf seine Stimme hört und an Ihn glaubt, wird leben, d.h. er bekommt ewiges Leben. Diese Macht, glaubenden Menschen Leben zu geben, hat der Vater dem Mensch gewordenen Sohn übertragen. Die Tatsache, dass Jesus Christus Tote auferweckte, beweist deutlich seine Macht über Leben und Tod.
Der Vater hat dem Sohn, der Mensch geworden ist, auch die Autorität übertragen, Gericht zu halten. Es wird also ein Mensch sein, der die ungläubigen Menschen richten wird (Apostelgeschichte 17,31).
Die «Stunde» in Vers 28 ist die Stunde des Gerichts, in der der Sohn Gottes alle Gestorbenen auferwecken wird. Sie findet in zwei Phasen statt:
- Die Auferstehung des Lebens betrifft alle, die das einzig Gute getan haben, das ein natürlicher Mensch tun kann: Sie haben an den Herrn Jesus geglaubt und werden deshalb nicht gerichtet, sondern zum Leben auferweckt werden.
- Die Auferstehung des Gerichts erstreckt sich auf alle, die das Böse verübt haben. Weil sie nicht an den Sohn Gottes geglaubt und Ihn nicht geehrt haben, werden sie für ihre Sünden eine ewige Strafe erleiden.
Das Gericht, das der Herr Jesus vollstrecken wird, stimmt völlig mit dem Willen des Vaters überein.
Ein vierfaches Zeugnis über Gottes Sohn
In diesem Abschnitt werden uns vier Zeugnisse über Jesus Christus, den Sohn Gottes, vorgestellt:
- Als die Juden ihre Diener zu Johannes dem Täufer sandten, verkündigte er ihnen die Wahrheit über Christus. Deutlich hob er die Würde Dessen hervor, der nach ihm kam. Ausserdem bezeugte er, dass Jesus der Sohn Gottes ist (Johannes 1,27.34). Johannes war eine Lampe, die helles Licht auf den Herrn warf.
- Die Werke, die Jesus Christus im Auftrag seines Vaters tat, offenbarten Gottes Macht und Gnade. Klar bezeugten sie seine Herkunft: Er war der Sohn Gottes, den der Vater in die Welt gesandt hatte.
- Der Vater selbst legte ein Zeugnis über seinen Sohn ab. Nach der Taufe des Herrn Jesus öffnete Er den Himmel und erklärte vor allen: «Dieser ist mein geliebter Sohn» (Matthäus 3,17). Später ertönte nochmals seine Stimme aus dem Himmel, als es um die Verherrlichung seines Vaternamens ging (Johannes 12,28).
- Die Juden erforschten die Schriften des Alten Testaments, um ewiges Leben zu finden. Doch sie lasen das Wort Gottes im Unglauben. Darum erkannten sie nicht, wie es auf den Herrn Jesus hinwies. Wie viele Prophezeiungen über Christus haben sich doch in seinem Leben eindeutig erfüllt!
Dieses vierfache Zeugnis über die Herrlichkeit des Herrn Jesus machte den Unglauben der Juden unentschuldbar. Ganz bewusst weigerten sie sich, zum Sohn Gottes zu kommen, um von Ihm Leben zu empfangen.
Unglaube und Ehre bei Menschen
Der Sohn Gottes ist nicht in die Welt gekommen, um von den Menschen geehrt zu werden, sondern um den Vater zu offenbaren. Alle, die Ihn ablehnten, verschlossen sich der Liebe Gottes, die der Sohn kundtat. Sie verharrten im Unglauben und stellten sich gegen Gott.
Jesus Christus war im Namen des Vaters, d.h. als Vertreter des Vaters zu seinem Volk gekommen. Doch die Juden nahmen Ihn nicht an, weil sie Feinde Gottes waren. Sie wollten den Gesandten des Vaters nicht.
In der Zukunft wird der Antichrist in seinem eigenen Namen zu ihnen kommen und sich selbst als Gott verehren lassen. Ihn werden die Juden aufnehmen, weil ihnen die Ehre und Anerkennung des Menschen wichtig ist.
In Vers 44 stellt der Herr einen Grundsatz vor: Wer nur die Anerkennung von Menschen im Auge hat und sich nicht unter Gottes Autorität beugt, nimmt die Wahrheit nicht im Glauben an, weil er durch sie verurteilt wird. Nur Buße und Beugung vor Gott öffnen dem Menschen die Tür zur glaubensvollen Annahme der Wahrheit (2. Timotheus 2,25).
Mose hatte einen Propheten angekündigt, auf den die Israeliten hören sollten (5. Mose 18,15). Nun war dieser Prophet – Jesus Christus, der Sohn Gottes – da und sprach zu den Juden. Doch sie hörten nicht auf Ihn und glaubten nicht an Ihn. Darum wurden sie von Mose, auf den sie sich so gern beriefen, verurteilt.
In Vers 47 unterstreicht der Herr die Wichtigkeit des geschriebenen Wortes Gottes. Darauf soll sich unser Glaube stützen.
Die Speisung der Fünftausend
In diesem Kapitel befindet sich der Herr Jesus in Galiläa. Viele Menschen suchen aus Neugier seine Nähe, weil sie seine Wunderheilungen miterlebt haben. Als Er die grosse Volksmenge kommen sieht, stellt Er Philippus eine Prüffrage: «Woher sollen wir Brote kaufen, damit diese essen?»
Sowohl die Antwort von Philippus als auch die Bemerkung von Andreas machen klar, dass die Bedürfnisse viel grösser als die menschlichen Möglichkeiten sind: Das Geld reicht bei weitem nicht aus, um genügend Brote zu kaufen! Und wie soll diese zahlreiche Menge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen satt werden?
Nachdem die Jünger ihr Unvermögen eingestanden haben, beginnt der Herr zu handeln:
- «Lasst die Leute sich lagern.» Bevor Er Nahrung austeilt, sollen die Menschen zur Ruhe kommen.
- «Jesus nun nahm die Brote.» Er benutzt das Wenige, das Ihm der Knabe zur Verfügung stellt. Welche Gnade!
- «Als er gedankt hatte …» Jesus dankt für das Essen, denn es kommt von Gott, der ein Erhalter aller Menschen ist.
- «… teilte er sie denen aus, die da lagerten.» Obwohl der Herr die fünf Brote des Knaben gebraucht, ist Er doch der Gebende und Austeilende.
- «Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt.» Der Herr ist grosszügig und gibt so viel, wie sie wollen. Aber Er ist nicht verschwenderisch, darum sollen die Reste eingesammelt werden.
Diese einzelnen Punkte lassen sich gut auf das Austeilen von geistlicher Nahrung übertragen.
Jesus auf dem Berg und auf dem See
Durch die Speisung der Volksmenge offenbart sich der Herr Jesus als der verheissene Messias, der in Psalm 132,15 sagt: «Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen.» In der Folge anerkennt Ihn das Volk als den Propheten und will Ihn zum König machen. Doch Jesus nimmt das Königtum nicht aus der Hand der Menschen an, sondern wartet auf den Zeitpunkt, an dem Gott Ihn als König in Zion einsetzen wird. Darum zieht Er sich auf den Berg zurück – ein Bild davon, dass Er nach seinem Kreuzestod für sein irdisches Volk als Priester im Himmel verborgen ist.
Seine Jünger repräsentieren den gläubigen Überrest Israels, der auf der Erde bedrängt wird, während Christus im Himmel ist:
- Die Dunkelheit auf dem See spricht von der Abwesenheit des Herrn und von der fehlenden Erkenntnis des Volkes Israel.
- Der Wind und die Wellen illustrieren die Drangsal, die der treue Überrest durchmachen wird.
In dieser Bedrängnis werden die gläubigen Juden geläutert, damit sie für ihren Messias bereit sind. Wenn Er am Ende der Drangsalszeit zu ihnen kommt, werden sie sich fürchten, weil sie Ihn zuerst nicht als Den erkennen, der zu ihrer Errettung am Kreuz gestorben ist.
Nachdem der Herr ins Schiff gestiegen ist, kommen sie ans Land. So wird es auch dem Überrest ergehen: Wenn Christus kommt und sich mit diesen Treuen vereint, wird für Israel die Bedrängnis zu Ende sein und eine herrliche Segenszeit anbrechen.
Die wahre Speise
Am nächsten Tag suchen die Menschen den Herrn Jesus. Sie haben die Jünger allein abfahren sehen. Deshalb vermuten sie, dass Er noch dort ist, wo sie von Ihm zu essen bekommen haben. Doch sie finden Ihn nicht. So fahren sie auch auf die andere Seite des Sees und kommen nach Kapernaum.
Es ist gut, die Nähe des Herrn Jesus aufzusuchen. Aber welche Motive leiten uns dabei? Streben wir nach Anerkennung? Suchen wir die Sensation? Oder wünschen wir sein Wort zu hören und seine Gemeinschaft zu geniessen?
Der Herr deckt die Beweggründe dieser Menschen sofort auf: Sie sind zu Ihm gekommen, weil sie ohne Arbeit und Mühe genug zu essen wünschen. Es geht ihnen nur um die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse.
«Wirkt nicht für die Speise, die vergeht.» Wir sollen unsere Energie nicht nur dafür verwenden, genug zu essen und zu trinken zu haben.
«Wirkt für die Speise, die bleibt ins ewige Leben.» Viel besser ist es, sich nach dem auszustrecken, was uns bleibende Befriedigung und ewigen Segen gibt. Beim Herrn Jesus können wir beides finden.
Die Juden wollen gern etwas tun, um Gottes Anerkennung und ewiges Leben zu bekommen. Da gibt ihnen der Herr zu verstehen: Wenn ihr wirklich ein Werk tun möchtet, das Gottes Zustimmung findet, dann glaubt an Mich! Gott verlangt vom Menschen nur eins: Dass er an Jesus Christus glaubt, den Er als Erlöser und Geber des ewigen Lebens in die Welt gesandt hat.
Das Brot aus dem Himmel
Die Juden fordern ein Zeichen, um sehen und glauben zu können. Doch der Herr tut kein Wunder, sondern erklärt ihnen, dass Er selbst das Zeichen der göttlichen Gnade ist. Als das Brot Gottes ist Er aus dem Himmel herabgekommen, um allen Menschen ewiges Leben anzubieten. Bis heute lädt Er jeden persönlich ein:
- «Wer zu mir kommt, wird nicht hungern.» Zu Ihm kommen heisst zu Ihm beten und Ihn glaubensvoll als Den annehmen, der alle unsere Probleme lösen und unsere Bedürfnisse stillen kann.
- «Wer an mich glaubt, wird niemals dürsten.» An Ihn glauben bedeutet, Ihn so ins Herz und Leben aufzunehmen, wie Er uns im Wort Gottes vorgestellt wird. Nur Er kann unseren Durst nach echtem, ewigem Leben stillen.
Der Mensch in seiner Selbstgerechtigkeit schlägt dieses Angebot des Heilands aus (Vers 36). Nur Gott kann diesen Widerstand überwinden. Darum wird in Vers 37 das Wirken des Vaters erwähnt, der die Menschen zu Jesus Christus führt. – In Vers 38 stellt der Herr sein Lebensziel vor: Als demütiger und gehorsamer Knecht wollte Er immer den Willen des Vaters tun. Er dachte nicht an sich, sondern erfüllte treu das, was der Vater Ihm auftrug.
Die Verse 39 und 40 zeigen, was der Wille des Vaters beinhaltet: Einerseits wird keiner, der im Glauben zu Jesus Christus kommt, verloren gehen. Anderseits bekommt jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, ewiges Leben. Beide Aspekte haben eine Wirkung, die über den Tod hinausgeht, deshalb werden beide mit der Auferweckung verbunden.
Nicht murren, sondern glauben
Die Juden haben das, was der Herr Jesus gesagt hat, verstanden, aber sie glauben Ihm nicht. Ihre murrenden Worte zeugen von zweierlei:
- Sie sind beleidigt, dass ein Sohn von armen und unbedeutenden Eltern der von Gott gesandte Christus sein soll.
- Wegen ihres Unglaubens können sie seine himmlische Herkunft und seine irdische Familienbeziehung nicht zusammenbringen.
Ab Vers 43 geht der Herr auf ihren Unglauben ein. Er erklärt ihnen, dass kein Mensch das Angebot der Gnade Gottes in Jesus Christus annimmt, wenn der Vater nicht wirkt und die Herzen zum Heiland zieht. Mit dem Zitat aus Jesaja 54 unterstreicht Er diesen Gedanken und zeigt einen Grundsatz auf: Jede Erkenntnis, die ein Mensch besitzen kann, kommt von Gott. Das wird im Tausendjährigen Reich für alle sichtbar werden. In der Zeit der Gnade lässt der Vater den Menschen das Evangelium über seinen Sohn verkünden. Wer diese Botschaft hört und aufnimmt, kommt zum Herrn Jesus und sieht in Ihm Gott.
Nur der Sohn Gottes, der im Schoss des Vaters ist, hat Ihn gesehen (Vers 46). Doch welche Gnade: Er ist Mensch geworden, um uns den Vater zu offenbaren. So können wir im Sohn den Vater erkennen (Johannes 14,9). Darum hängt alles davon ab, ob wir an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben (Vers 47). Durch den Glauben an Ihn empfangen wir ewiges Leben und kommen in eine glückliche Beziehung zum Vater (Johannes 1,12).
Ewiges Leben und Gemeinschaft
Der Herr Jesus wiederholt die Worte von Vers 35: «Ich bin das Brot des Lebens.» Mit einem Gegensatz macht Er deutlich, was diese Aussage bedeutet:
- Das Manna kam von Gott aus dem Himmel auf die Erde. Obwohl die Israeliten in der Wüste davon assen, starben sie irgendwann, denn das Manna konnte kein ewiges Leben geben.
- Christus ist als das Brot des Lebens auch von Gott aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Wer von diesem Brot isst, indem er Jesus Christus glaubensvoll in sein Herz aufnimmt, bekommt ewiges Leben. Dadurch besitzt er eine Perspektive über den Tod hinaus.
In Vers 51 finden wir zwei wichtige Glaubenstatsachen: Das Herabkommen aus dem Himmel spricht von der Menschwerdung des Sohnes Gottes, und das Fleisch, das er geben wird, vom Opfertod des Herrn Jesus. Weil die Juden den Sinn seiner Worte nicht verstehen, wird Jesus Christus in Vers 53 etwas deutlicher. «Sein Fleisch essen» und «sein Blut trinken» bedeuten nichts anderes, als persönlich daran zu glauben, dass der Tod des Herrn Jesus die Grundlage meiner Errettung ist.
Ab Vers 54 geht es nicht mehr um einen einmaligen Akt des Glaubens, sondern um eine fortdauernde Handlung: Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben besitzen, beschäftigen sich gern mit seinem Opfertod. Dadurch werden sie geistlich genährt und haben Gemeinschaft mit Ihm. So wie der Herr auf der Erde in ständiger Verbindung zum Vater gelebt hat, sollen sie ihre Glaubensbeziehung zu Christus pflegen. Dadurch entfaltet sich ihr neues Leben.
Herr, zu wem sollen wir gehen?
Jetzt sind es nicht die Juden, sondern viele von seinen Jüngern, die sich über die Worte des Herrn Jesus ärgern. Sie sind Ihm wegen der Zeichen nachgefolgt (Johannes 2,23), aber nun offenbaren sie ihren wahren Zustand: Sie glauben nicht wirklich an Jesus Christus.
An ihrem Beispiel wird deutlich, dass der natürliche Mensch, der im Fleisch ist, Gott nicht gefallen und die Worte des Herrn Jesus nicht erfassen kann. In seinem Innern muss ein Werk des Heiligen Geistes geschehen, damit er ewiges Leben bekommt. Aus diesem Grund erklärt der Herr in Vers 63: «Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts.»
Vers 64 stellt die Verantwortung des Menschen vor, an Jesus Christus zu glauben. In Vers 65 ist vom gnädigen Wirken des Vaters die Rede, ohne das kein Mensch zum Heiland kommt. Beides ist hundertprozentig wahr.
Nachdem die Menschen, die nur für eine Zeit an Christus geglaubt haben (Lukas 8,13), weggegangen sind, prüft der Herr die zwölf Jünger: «Wollt ihr etwa auch weggehen?» Petrus, der immer schnell redet, gibt eine herrliche Antwort: «Herr, zu wem sollen wir gehen?» Für ihn gibt es keine Alternative, als Jesus Christus nachzufolgen, denn er hat zweierlei erfahren:
- Das Wort des Herrn verleiht ewiges Leben und ist geistliche Nahrung für den inneren Menschen.
- Die Gemeinschaft mit dem Sohn des lebendigen Gottes erfüllt das Herz der Glaubenden mit bleibender Freude.
Der Herr hat zwölf Jünger erwählt, elf besitzen göttliches Leben, Judas Iskariot jedoch nicht.
Meine Zeit ist noch nicht da
Der Herr Jesus hält sich in Galiläa auf, weil Ihn die Menschen aus Judäa töten wollen. Das bevorstehende Laubhüttenfest wird das «Fest der Juden» genannt, weil es zu einer religiösen Feier ohne Gott verkommen ist.
Der Vorschlag seiner Brüder offenbart ihre weltliche Einstellung. Sie raten Jesus, am Fest öffentlich aufzutreten, um noch bekannter und geehrter zu werden. In ihrem Unglauben verstehen sie nicht, dass es Ihm nur um die Ehre Gottes und die Errettung der Menschen geht. Sie haben auch kein Verständnis für seine demütige und gehorsame Gesinnung.
In seiner Antwort zeigt der Herr den Unterschied zwischen sich und seinen Brüdern auf:
- Seine Zeit, als König verehrt zu werden, ist noch nicht da, weil die Welt Ihn ablehnt. Sie hasst Ihn aufgrund seines Verhaltens und seiner Worte, denn Er lebt getrennt von der Welt und verurteilt ihre Werke.
- Die Zeit der Brüder, zum Fest zu gehen und dort Ehre und Vergnügen zu suchen, ist hingegen da, weil sie zur Welt gehören. Aus diesem Grund müssen sie auch nicht mit dem Hass der Welt rechnen, denn sie liebt das Ihre.
Jesus bleibt solange in Galiläa, bis Gott Ihm aufträgt, im Verborgenen zum Fest hinaufzugehen. Nie lässt Er sich durch weltliche oder egoistische Motive leiten, sondern handelt immer in Abhängigkeit vom Vater.
Das Gemurmel unter den Leuten macht klar, dass es in der Welt verschiedene Meinungen über Jesus Christus gibt. Doch solange kein Glaube vorhanden ist, fehlt es an einer Überzeugung.
Ablehnung seiner Lehre und seiner Werke
Als Jesus im Tempel lehrt, fragen sich die Juden: Wie kann Er so überzeugend predigen, obwohl Er kein Gelehrter ist? In seiner Antwort zeigt der Herr, worin sich seine Lehre von der Unterweisung der Schriftgelehrten unterscheidet:
- Er stellt nicht menschliche Gedanken oder eigene Überlegungen vor, sondern bringt eine Botschaft von Gott, dem Vater, der Ihn gesandt hat (Vers 16).
- Wenn Christus lehrt, sucht Er nicht persönliche Anerkennung, sondern die Ehre seines Vaters (Vers 18). Dieses Motiv weist Ihn als wahr und gerecht aus.
Dazwischen macht Vers 17 klar, dass nicht Intelligenz oder Gelehrsamkeit, sondern Demut und Gehorsam nötig sind, um die Lehre des Herrn zu verstehen und die göttliche Quelle seiner Mitteilung zu erkennen.
In Vers 20 beschimpfen Ihn die Menschen aufs Heftigste, indem sie behaupten: «Du hast einen Dämon.» Doch Jesus geht nicht auf diese Lästerung ein, sondern legt ihnen den Sachverhalt nochmals vor:
- Der Grund für ihre Verwunderung, die bereits in Ablehnung und Hass übergegangen ist, liegt darin, dass Er am Sabbat jemand geheilt hat.
- Obwohl sie selbst am Sabbat eine Beschneidung vollziehen, um das Gesetz zu halten, zürnen sie dem Herrn, wenn Er am Sabbat heilt. Das ist nicht gerecht.
Ab Vers 25 hören wir die Argumente und Überlegungen der Bewohner von Jerusalem. Ihre Worte offenbaren ihren Unglauben und ihre Unwissenheit. Weil ihre Herzen durch die Sünde und die Religiosität hart geworden sind, erkennen sie nicht, dass Jesus der Christus ist.
Ablehnung der Person des Herrn Jesus
Aufgrund der Wunder, die Jesus getan hat, wissen die Juden genau, dass Er von Gott gekommen ist (Johannes 3,2). Er ist nicht eigenmächtig, sondern im Auftrag des Vaters in Israel aufgetreten. Obwohl die Juden religiös sind, haben sie keine Beziehung zum lebendigen und wahren Gott. Darum kennen sie Ihn nicht. Der Herr Jesus hingegen steht als der Sohn des Vaters in einer ewigen Beziehung zu Ihm.
Die Juden offenbaren sich als Feinde Gottes, weil sie seinen Gesandten ablehnen. Doch sie können noch nicht Hand an den Sohn Gottes legen, weil die Stunde seines Kreuzestodes noch nicht gekommen ist. Die Volksmenge ist verwirrt und unwissend. Diese Menschen lehnen Christus nicht ab, sind aber unentschlossen. Einige glauben an Ihn, andere stellen nur Fragen. Als sie sich Jesus Christus zuneigen, will die religiöse Führerschaft eingreifen und Ihn verhaften.
Diese Massnahme nimmt der Herr zum Anlass, um ihnen mitzuteilen, dass Er nicht mehr lange als Gesandter des Vaters und als Zeuge Gottes bei ihnen sein werde. Sobald sein Auftrag auf der Erde beendet ist, wird Er in den Himmel zurückkehren. Weil die Juden Ihn als Messias ablehnen, verlässt Er sie. Damit wird das Judentum auf die Seite gestellt und der verheissene Segen für das Volk Israel und die Erde zeitlich hinausgeschoben.
Der religiöse Stolz und der Widerstand gegen Gott hindern die Juden daran, das zu verstehen, was Jesus sagt. Sie ziehen nur menschliche Vernunftschlüsse, die keine befriedigende Antwort geben.
Der letzte Tag des Festes
Der letzte grosse Tag des Laubhüttenfests ist der achte Tag, der auf einen Neuanfang hinweist (3. Mose 23,36). An diesem Tag kündigt der Herr Jesus den Menschen einen Segen an, der völlig ausserhalb des Judentums liegt.
Wer zu Ihm kommt und an Ihn glaubt, dessen Lebensdurst wird gestillt. Er bekommt ewiges Leben und den Heiligen Geist, der das neue Leben zur Entfaltung bringt. Dadurch kann der Glaubende für andere ein Segen sein. Unter der Wirkung des Geistes fliessen aus seinem Leben Ströme lebendigen Wassers, so dass die Menschen durch ihn mit der Liebe und Gnade Gottes in Berührung kommen.
Vers 39 macht klar, dass nur die Glaubenden den Heiligen Geist bekommen, und zwar erst nachdem der Herr Jesus als Mensch im Himmel verherrlicht ist. Genauso geschah es auch: Zehn Tage nach seiner Himmelfahrt kam der Geist Gottes auf die Erde, um in den Erlösten zu wohnen (Apostelgeschichte 2,1-4).
Die Verse 40-44 beschreiben, welche Reaktion die Worte des Herrn bei den Zuhörern hervorruft. Obwohl kein echter Glaube sichtbar wird, erkennen wir, dass die Herzen ergriffen sind:
- Einige kommen zum Schluss: «Dieser ist wahrhaftig der Prophet.» Damit haben sie recht. Doch sind sie auch bereit, auf Ihn zu hören?
- Andere sagen: «Dieser ist der Christus.» Obwohl ihre Feststellung stimmt, fragt sich, ob sie auch seine Autorität anerkennen.
Fragen und Erörterungen führen zu einer Spaltung in der Volksmenge, aber nicht zum Glauben an Christus.
Niemals hat ein Mensch so geredet
Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellung von drei Personengruppen zu Jesus Christus:
- Die Diener der Hohenpriester sind von den Worten des Herrn Jesus stark ergriffen. Darum können sie Ihn nicht festnehmen. Stattdessen legen sie ein schönes Zeugnis über Ihn ab: «Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch.» Sie haben persönlich erfahren, wie seine Worte voll Gnade und Wahrheit sind.
- Die Hohenpriester und Pharisäer sind die erbitterten Feinde des Herrn. Sie haben kein offenes Ohr für seine Mitteilungen und wollen nicht an Ihn glauben. Um die Wirkung seiner Worte bei den Dienern zu untergraben, betonen sie den Standpunkt der Gelehrten und bezweifeln die Urteilsfähigkeit der einfachen Leute.
- Nikodemus wagt nicht, offen Stellung für Christus zu nehmen. Dennoch legt er ein Wort für Ihn ein. Er weist darauf hin, dass man nach dem Gesetz einen Menschen zuerst anhört und sein Handeln prüft, bevor man ein Urteil über ihn fällt. Schon mit diesem schwachen Einwand zieht er die Verachtung seiner Ratskollegen auf sich.
Die Reaktion der Hohenpriester und Pharisäer offenbart erstens ihren Widerstand gegen alle, die sich auf die Seite von Jesus Christus stellen, zweitens ihre Verachtung für das einfache Volk, das in Galiläa wohnt, und drittens ihre Unwissenheit über die Propheten in Israel, denn Jona war ein Prophet aus dem Gebiet von Galiläa (2. Könige 14,25). So prallen die Mitteilung der Diener und der Einwand von Nikodemus an ihren verhärteten Gewissen ab.
Die Ehebrecherin
Als der Fremde vom Himmel übernachtet Jesus ausserhalb von Jerusalem. Am Morgen kommt Er wieder in den Tempel, um den Menschen seine himmlische Botschaft zu verkünden. Da kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer zu Ihm. Sie benutzen das Gesetz, um eine schuldige Frau zu verurteilen und dem Herrn eine Falle zu stellen. Für sie gibt es nur zwei mögliche Antworten:
- Wenn Jesus die Frau nach dem göttlichen Gebot verurteilt, ist Er nicht der Heiland.
- Wenn Er die Frau gehen lässt, verachtet und verwirft Er das Gesetz.
Zuerst bückt sich der Herr nieder und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Er wartet mit seiner Antwort, um ihnen Zeit zu geben, über ihr böses Vorgehen nachzudenken. Schliesslich erklärt Er ihnen: «Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie.» Damit stellt Er alle Anwesenden ins Licht des Wortes Gottes, das die Herzen erforscht, jede Heuchelei und Bosheit offenbart und allen Menschen klarmacht, dass sie gesündigt haben.
Die Ankläger werden im Gewissen getroffen. Doch sie weichen dem göttlichen Licht aus und verlassen die Gegenwart des Sohnes Gottes, um ihren frommen Schein vor den Menschen zu wahren. Jeder ist nur noch für sich selbst und seine eigene Ehre besorgt. So gehen sie einer nach dem anderen hinaus.
Der Herr Jesus ist der Einzige, der die moralische Voraussetzung hat, die Frau zu verurteilen. Doch Er tut es nicht, weil Er mehr als das Gesetz offenbart: Er zeigt göttliche Gnade und göttliche Wahrheit!
Ich bin das Licht der Welt
Der Mensch gewordene Sohn Gottes ist das Licht der Welt, das alles göttlich beurteilt, so dass keine Frage mehr offen bleibt. Wer sich seinem Urteil stellt, seine Gnade annimmt und Ihm nachfolgt, befindet sich im Licht der Gegenwart Gottes und bekommt ewiges Leben.
In Vers 14 geht der Herr auf den Angriff der Pharisäer von Vers 13 ein: Weil Er der Sohn Gottes ist, kann Er von sich selbst zeugen und sich als das Licht der Welt bezeichnen. Denn es ist völlig klar: Wenn Gott spricht, sagt Er immer die Wahrheit und offenbart etwas von sich selbst.
In den Versen 15 und 16 bezieht sich der Herr auf die Begebenheit mit der Ehebrecherin am Anfang des Kapitels: Die Schriftgelehrten haben nach ihrem eigenen Gutdünken gerichtet und das Gesetz eigenmächtig auf die Situation angewandt. Der Sohn Gottes hingegen ist nicht gekommen, um zu richten. Wenn Er wegen ihres Unglaubens dennoch ein Urteil ausspricht, ist es wahr, d.h. in Übereinstimmung mit den Gedanken des Vaters.
In den Versen 17 und 18 spricht der Herr Jesus nochmals über sein Zeugnis. Weil es durch das Zeugnis seines Vaters bestätigt wird, entspricht es den Anforderungen des Gesetzes und verpflichtet die Juden, es anzunehmen. Doch sie wollen nicht an Ihn glauben. Weil sie innerlich weit von Gott entfernt sind, erkennen sie nicht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, den der Vater als Mensch auf die Erde gesandt hat. Als Folge davon erkennen sie auch den Vater nicht.
Alles ist in der Hand des Sohnes Gottes. Darum können Ihm die ungläubigen Juden noch nichts antun.
Der Sohn und der Vater
Zwischen dem Herrn Jesus und den ungläubigen Juden gibt es keine Gemeinsamkeit und keine Verbindung mehr. Weil sie Ihn als Messias verwerfen, kündigt Er seine Rückkehr zum Vater an. Dorthin können sie Ihm nicht folgen, weil sie weder an Ihn noch an seinen Vater glauben.
Die Juden zeigen in ihrer Gesinnung und in ihrem Verhalten ihre moralische Beziehung zum Teufel (Vers 44) und ihre Zugehörigkeit zur Welt. Im Gegensatz zu ihnen steht Jesus Christus mit dem Himmel in Verbindung und gehört nicht zur gottlosen Welt.
Weil die Juden nicht an Ihn glauben wollen, fragen sie Ihn: «Wer bist du?» Seine Antwort stellt einen wichtigen Grundsatz ans Licht: Seine Person und seine Worte sind völlig übereinstimmend. Er verkündet eine Botschaft von Gott und ist zugleich auch Gott.
Als der Gesandte des Vaters redet Jesus Christus nur das, was Dieser Ihm aufgetragen hat. So vollkommen ist seine Abhängigkeit als Mensch von Gott! Wegen ihres Unglaubens verstehen die Juden nicht, dass Er von Gott, dem Vater, zu ihnen spricht. Erst wenn der Sohn des Menschen durch ihre Bosheit am Kreuz hängen wird, werden sie erkennen (nicht glauben), dass Er wirklich im Auftrag des Vaters gehandelt und gepredigt hat. Doch dann wird es zu spät sein, weil sie Ihn verworfen und gekreuzigt haben.
Wenn diese religiösen Menschen Jesus Christus auch ablehnen, so ist doch sein Vater bei Ihm und anerkennt sein vollkommenes Verhalten. Alles, was der Herr tut, findet die volle Zustimmung des Vaters!
Der Sohn macht frei
In den Versen 31 und 32 geht es um die Wirkung eines echten Glaubens: Der Mensch nimmt das Wort des Sohnes Gottes bereitwillig auf und lässt die Wahrheit auf Herz und Gewissen wirken. Dadurch anerkennt er die Autorität des Herrn. Das hat zwei positive Folgen für ihn:
- Durch die vorbehaltlose Aufnahme des Wortes Gottes und den Wunsch, es zu verwirklichen, bekommt er Verständnis über die göttliche Wahrheit.
- Weil er die Wahrheit über seinen sündigen Zustand akzeptiert und seine Zuflucht zum Heiland nimmt, wird er von der Sklaverei der Sünde befreit.
Darauf behaupten die ungläubigen Juden, sie seien nie jemandes Knechte gewesen. In ihrem religiösen Stolz vergessen sie die traurige Geschichte ihres Volkes und ihre aktuelle politische Situation. Sie leben unter der Herrschaft Roms.
In seiner Antwort geht der Herr sofort zum Kern der Sache: «Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht.» Das ist der Zustand jedes Menschen, der die erlösende Macht des Sohnes Gottes noch nicht erfahren hat. Da hilft auch das Gesetz nichts.
Die Juden sind Knechte im Haus. Sie befinden sich äusserlich nahe bei Gott. Wenn sie jedoch nicht an den Sohn Gottes glauben, der sie von der Sünde und dem Gesetz befreien kann, werden sie nicht im Haus bleiben, sondern fortgeschickt werden. Jesus Christus ist der Sohn, der zum Haus gehört, weil Er als Sohn immer in Gottes Nähe ist. Aufgrund seines Erlösungswerks kann Er Menschen, die Sklaven der Sünde sind, frei machen und sie in eine geordnete Beziehung zu Gott bringen.
Der Teufel – ein Mörder und Lügner
Die Juden sind stolz, dass sie Nachkommen Abrahams sind. Doch sie offenbaren ganz andere Merkmale als ihr Vorfahre. Darum sind sie nicht seine echten Kinder. Abraham hat die Wahrheit im Glauben angenommen. Sie hingegen weisen die göttliche Wahrheit im Herrn Jesus entschieden zurück. Ihre Ablehnung gegen Gott geht so weit, dass sie Christus töten wollen. Ihre Mordabsichten offenbaren, dass der Teufel ihr geistlicher Vater ist. Sie sind von ihm inspiriert.
In ihrem religiösen Stolz verletzt, greifen die Juden den Herrn mit bösen und unwahren Worten an. Sie verlästern das Wunder, dass Er von einer Jungfrau geboren worden ist, und bestehen auf ihrer äusseren Beziehung zu Gott. Weil sie Christus verwerfen, den der Vater zu ihnen gesandt hat, liefern sie einen klaren Beweis, dass sie weder an Gott glauben noch Ihn lieben.
In Vers 44 weist der Herr auf die beiden Hauptmerkmale des Teufels hin: Er ist ein Menschenmörder und ein Lügner. Die ungläubigen Juden offenbaren genau diese beiden Kennzeichen: Sie wollen Jesus Christus töten (Vers 40) und leugnen ihren wahren Zustand (Vers 33). Dadurch zeigen sie klar, dass sie Kinder des Teufels sind. Unter seinem Einfluss entfalten sie seine Begierden und tun seine Werke.
Diese Juden haben keine echte Glaubensbeziehung zu Gott. Darum lehnen sie die Worte Gottes ab, die Jesus Christus zu ihnen redet. Wer jedoch neues Leben besitzt, liest gern in der Bibel und hört bereitwillig der Verkündigung des Wortes zu.
Der Sohn Gottes ist grösser als Abraham
Der Widerstand der Juden gegen die Worte des Herrn nimmt zu. Sie greifen Ihn direkt an und behaupten, Er sei ein Samariter und habe einen Dämon. Damit sprechen sie Ihm seine Volkszugehörigkeit zu Israel und seine himmlische Herkunft ab. Was für eine freche und schreckliche Äusserung!
Jesus weist diese Behauptung mit einem Satz zurück und unterstreicht im weiteren Verlauf des Gesprächs drei wichtige Tatsachen:
- Die Tragweite seiner Worte: Weil Er Gottes Wort redet, ist es für alle entscheidend, ob sie Ihm glauben oder nicht. Wer sein Wort aufnimmt und es im Glauben festhält, bekommt ewiges Leben. Der leibliche Tod ist für ihn nur das Tor zum ewigen Glück (Vers 51).
- Seine Beziehung zum Vater: Als der eingeborene Sohn ist Er im Schoss des Vaters und wird von Ihm geliebt. Diese Beziehung zum Vater und diese Kenntnis vom Vater will der Herr Jesus nicht leugnen, auch wenn Er dadurch von den ungläubigen Juden gehasst wird (Vers 55).
- Sein Vorrang vor Abraham: Gott hat Abraham die Verheissung gegeben, dass in seinem Nachkommen einmal alle Nationen der Erde gesegnet werden (1. Mose 22,18). Das ist eine direkte Voraussage auf Jesus Christus. Abraham hat sich auf den Tag gefreut, an dem Christus diese hohe Stellung auf der Erde einnehmen und allen Menschen Segen bringen wird (Vers 56). Es gibt jedoch eine Herrlichkeit, die den Herrn Jesus über Abraham stellt: Als der ewige Sohn Gottes hatte Er schon existiert, bevor Abraham geboren wurde.
Der Herr heilt den Blindgeborenen
In Kapitel 8 haben die Juden die Worte des Herrn abgelehnt. In Kapitel 9 weisen sie nun seine Werke ab.
Als Jesus mit seinen Jüngern an einem Blindgeborenen vorübergeht, wollen sie wissen, was die Ursache seiner Blindheit ist: «Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde?» Sie sind der Meinung, dass diese schwere Behinderung eine Strafe für Sünden sein muss. Der Herr weist solche falschen Überlegungen – die auch heute tief im Menschen verwurzelt sind – sofort zurück: «Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden.»
Das Elend dieses blinden Mannes widerspiegelt ausnahmslos die Situation aller Menschen. Sie sind geistlich blind und können weder ihren eigenen Zustand noch die Herrlichkeit Gottes erkennen. So nimmt der Sohn Gottes den schlimmen Zustand dieses Blindgeborenen zum Anlass, um durch ein Werk der Gnade zu zeigen, dass Er der Gesandte des Vaters und das Licht der Welt ist. Wer an Ihn glaubt, nimmt das göttliche Licht an, wird sehend und bekommt ewiges Leben.
Bei den Nachbarn löst die Heilung des Blinden eine Diskussion aus. Ist das nicht eine gut bekannte Reaktion der Menschen, die eine Veränderung im Leben von Jungbekehrten feststellen, aber selbst nicht an den Herrn Jesus glauben?
Der Geheilte legt ein schlichtes Zeugnis von dem ab, was der Heiland an ihm getan hat. Er weiss noch nicht viel über Jesus Christus, aber er schreibt Ihm seine Heilung vollständig zu.
Der Widerstand der Pharisäer
Die Nachbarn bringen den Geheilten zu den Pharisäern. Nun steht er als starker Beweis der göttlichen Macht und Gnade, die in Jesus Christus wirken, vor diesen religiösen Menschen. Doch sie wollen dieses Werk nicht anerkennen, weil sie den Herrn Jesus als ihren Messias ablehnen. Darum erklären sie von Ihm: «Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht.» Mit dieser Behauptung kommen sie jedoch nicht weit. Die Heilung eines Blindgeborenen ist ein eindrucksvolles Wunder, das kein sündiger Mensch vollbringen kann.
Als Verwirrung und Zwiespalt unter den Juden entsteht, befragen sie wieder den Geheilten. Sie suchen mit allen Mitteln, das göttliche Wunder auf ein menschliches Niveau herabzuziehen. Es gelingt ihnen nicht. Der Blinde erklärt: «Er ist ein Prophet.» Damit bezeugt er, dass dieses Zeichen einen göttlichen Ursprung hat.
In Vers 18 gehen die Gegner der Wahrheit noch einen Schritt weiter: Sie glauben nicht, dass der Mann wirklich blind geboren worden ist. Diese Meinung hält aber den Tatsachen nicht stand, denn die Eltern müssen bestätigen: «Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde.» Mehr wagen sie nicht zu sagen, denn sie fürchten sich vor den Sanktionen der religiösen Führerschaft.
Wie deutlich treten Hass und Widerstand der Juden gegen Christus zutage! Sie schliessen jeden, der sich zum Herrn Jesus bekennt, aus der Synagoge aus. Damit entlarven sie sich als Werkzeuge des Feindes Gottes.
Das Zeugnis des Blindgeborenen
Mitten im Trommelfeuer der Befragungen leuchtet das schlichte Zeugnis des geheilten Blinden auf. Während er mutig seinen Heiland vor den ungläubigen Juden bezeugt, wächst seine Glaubensüberzeugung ständig.
Zuerst bestätigt er einfach: «Eins weiss ich, dass ich blind war und jetzt sehe.» Unbeirrt hält er an seiner Heilung fest. Später merkt er, dass bei den Juden etwas nicht stimmt. Warum befragen sie ihn mehrmals über die Heilung? Wollen sie etwa auch Jünger des Herrn Jesus werden?
In Vers 30 drückt der Geheilte sein Erstaunen über die Schwierigkeiten der ungläubigen Juden aus. Eigentlich ist doch alles ganz einfach. Für ihn steht zweierlei fest:
- Gott muss die Quelle dieser Heilung sein, denn noch nie hat ein Mensch die Augen eines Blindgeborenen aufgetan.
- Gott wirkt solche Zeichen nur durch Menschen, die gottesfürchtig leben und seinen Willen tun.
Beides trifft auf Jesus Christus zu, der dieses Wunder aus der Gemeinschaft mit Gott gewirkt hat.
Die Juden sind über diese offenen und wahren Worte empört, weil ihr Unglaube dadurch blossgestellt wird. In ihrem Widerstand gegen das göttliche Licht kommen sie genau zu dem verkehrten Schluss, den der Herr am Anfang des Kapitels zurückgewiesen hat: «Du bist ganz in Sünden geboren, und du lehrst uns?» Dann setzen sie dem Gespräch ein Ende und spielen ihre religiöse Macht aus, indem sie den Mann hinauswerfen.
Glaubst du an den Sohn Gottes?
In den Versen 35-38 trifft der Hinausgeworfene (der geheilte Blinde) mit dem Verworfenen (dem Heiland) zusammen. Beide haben wegen ihres mutigen Zeugnisses für Gott den Hass und die Ablehnung der religiösen Welt erfahren.
Ausserhalb des Judentums führt der Hirte sein Schaf in die Gemeinschaft mit sich. Er offenbart sich dem Geheilten als Sohn Gottes und zeigt ihm so seine Grösse und Herrlichkeit:
- Er ist der Anziehungspunkt der Erlösten, die sich gern seiner Autorität unterstellen.
- Er gibt dem Glaubensleben das richtige Ziel und den wirklichen Inhalt.
- Seine Person ist würdig, Ehre und Anbetung zu bekommen.
Der Mann versteht die Tragweite dieser Offenbarung sofort. Er bleibt beim Sohn Gottes und betet Ihn an.
Das Kommen des Herrn Jesus in die Welt bedeutet für die einen Gnade und für die anderen Gericht:
- Die Nichtsehenden sind solche, die demütig ihren verlorenen Zustand anerkennen und an den Sohn Gottes glauben. Ihnen schenkt Er Licht, damit sie seine Herrlichkeit erkennen. Sie empfangen die Gnade, die durch sein Kommen erschienen ist.
- Die Sehenden sind religiöse Menschen, die sich auf ihre Bibelkenntnis etwas einbilden, aber ihre eigene Verdorbenheit nicht wahrnehmen wollen. Wenn sie den Sohn Gottes ablehnen, werden sie noch mehr verblendet. In diesem Sinn hat sein Kommen für sie Gericht zur Folge.
Der Hirte geht durch die Tür ein
Der Herr Jesus spricht hier in einem Gleichnis: Der Hof der Schafe ist der Bereich der jüdischen Nation. Die Mauer spricht von den Verordnungen des Gesetzes, die das Volk Israel von den Nationen unterschieden und trennten. Die Tür zu diesem Schafhof stellt den rechtmässigen Eingang des verheissenen Messias dar. Räuber sind Menschen, die einen unberechtigten Anspruch erhoben, Hirten und Führer in Israel zu sein.
Jesus Christus ging als rechtmässiger Hirte durch die Tür in den Schafhof hinein. Er erfüllte die Voraussagen des Alten Testaments über den Messias und trat nach Gottes Willen durch die Tür zu seinem Volk ein. Die Schafe hörten seine Stimme, als Er in den Städten und Dörfern Israels predigte. Zu den Menschen, die seine Botschaft annahmen und an Ihn glaubten, ging Er eine persönliche Beziehung ein: Er rief sie mit Namen (Jesaja 43,1). Das Volk lehnte Ihn im Allgemeinen ab und kam dadurch unter das Gerichtsurteil Gottes. Als Folge davon führte der Hirte die Glaubenden aus dem Judentum heraus. Diese Tatsache wird in Lukas 24,50 angedeutet, als Er nach seiner Auferstehung die Jünger aus Jerusalem nach Bethanien hinausführte.
Nun geht der Hirte vor seinen Schafen her, um sie auf dem Glaubensweg zu führen und sie vor den Gefahren der Welt zu beschützen. Im tiefen Vertrauen auf seine Liebe und Macht folgen Ihm die Schafe. Weil sie Ihn kennen, wie Er in Gnade und Wahrheit zu ihnen spricht, wenden sie sich von jeder fremden Stimme ab. Je besser sie im Wort Gottes unterrichtet sind, desto klarer können sie ungute Einflüsse erkennen und ablehnen.
Ich bin die Tür! Ich bin der gute Hirte!
Der Sohn Gottes besass die Autorität, glaubende Menschen aus dem Judentum – das einst von Gott gegeben war – herauszuführen. Darum erklärt Er in Vers 7: «Ich bin die Tür der Schafe.» In Vers 9 sagt Jesus Christus nochmals: «Ich bin die Tür.» Hier ist Er das Mittel, um die Glaubenden in den christlichen Bereich einzuführen. Jeder Mensch, der an Ihn glaubt, geht durch diese Tür und bekommt drei Geschenke:
- Die christliche Errettung: Er ist vor der ewigen Strafe in Sicherheit, wird auf seinem Lebensweg bewahrt und erreicht bestimmt das himmlische Ziel.
- Die christliche Freiheit: Der Erlöste lebt nicht unter dem gesetzlichen Joch, sondern in der Freiheit der Gegenwart des Hirten.
- Die christliche Nahrung: Der Glaubende bekommt beim Hirten aus dem Wort Gottes eine reichhaltige Nahrung zum Wachstum und zur Freude.
In den Versen 10 und 11 wird der gute Hirte dem Dieb gegenübergestellt. Der Dieb nimmt, was ihm nicht gehört, um es zu verderben. Der gute Hirte hingegen gibt seinen Schafen, was sie nicht verdient haben, und lässt dafür sein Leben.
Die Verse 12-15 zeigen den Gegensatz zwischen dem guten Hirten und einem Mietling, der für Geld die Schafe hütet. Dem Mietling gehören die Schafe nicht. Darum flieht er, wenn Gefahr droht, und kümmert sich nicht um das Wohl der Herde. Ganz anders der gute Hirte: Ihm gehören die Schafe. Er liebt und kennt sie alle persönlich. Weil Er sein Leben für sie gelassen hat, schützt Er seine Schafe vor Gefahren.
Sein Tod und seine Auferstehung
Die Schafe, die der Hirte aus dem Hof herausführt, sind die Glaubenden aus dem Volk Israel. Doch der Herr besitzt noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind: die Erlösten aus den Nationen, die keinen Bezug zum Judentum haben. Auch diese Menschen folgen dem Ruf des Heilands und werden in den christlichen Segen eingeführt. Sie bilden mit den Glaubenden aus den Juden eine Herde, die Versammlung Gottes. Der Herr Jesus ist der Mittelpunkt der Erlösten. Seine Person hält das himmlische Volk Gottes zusammen.
In den Versen 17 und 18 spricht Er über seinen Tod am Kreuz. Wir erkennen drei Schwerpunkte:
- Jesus Christus gab sein Leben freiwillig in den Tod, um seinen Vater zu ehren und seine Schafe zu erretten. Diese freiwillige Hingabe war für den Vater ein weiterer Grund, Ihn zu lieben.
- Der Sohn Gottes liess sein Leben in eigener Machtvollkommenheit. Weil Er Macht über Leben und Tod besass, ist Er nach drei Tagen selbst aus den Toten auferstanden.
- Sein Tod am Kreuz zeigte seinen vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Vater, der Ihm den Auftrag gegeben hat, das Erlösungswerk zu erfüllen.
Die Verse 19-21 lassen die Verlegenheit der Juden erkennen. Einerseits sagt ihnen die Vernunft: «Diese Reden sind nicht die eines Besessenen; kann etwa ein Dämon der Blinden Augen auftun?» Anderseits sind ihre starken Vorurteile gegen den Herrn Jesus ein zu grosses Hindernis, um seine Botschaft bereitwillig anzunehmen und an Ihn zu glauben.
Meine Schafe
Das Fest der Tempelweihe ist nicht von Gott im Gesetz angeordnet, sondern von den Juden eingeführt worden. An diesem Fest stellen sie den Herrn Jesus zur Rede und wollen endlich wissen, ob Er der Christus ist. Wir erkennen darin ihren hartnäckigen Unglauben. Hat Er ihnen nicht durch seine Worte und seine Werke deutlich gezeigt, dass Er im Auftrag seines Vaters zu ihnen gekommen ist? Weil sie nicht an Ihn glauben wollen, gehören sie nicht zu seinen Schafen.
In Vers 27 stellt der Herr drei Eigenschaften der Glaubenden vor, die im Gegensatz zum Verhalten der ungläubigen Juden stehen:
- «Meine Schafe hören meine Stimme.» Sie nehmen seine Worte bereitwillig auf.
- «Ich kenne sie.» Zwischen dem guten Hirten und seinen Schafen besteht eine persönliche Beziehung.
- «Sie folgen mir.» Die Schafe überlassen dem Herrn die Führung ihres Lebens und gehorchen Ihm.
Vers 28 beschreibt den Segen und die Sicherheit, die alle Erlösten besitzen. Der Herr Jesus gibt ihnen ewiges Leben, damit sie jetzt und in der Zukunft Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben können. Gleichzeitig sichert Er ihnen zu, dass sie für Zeit und Ewigkeit in seiner Hand geborgen sind. – Die Glaubenden können auch mit der Fürsorge des Vaters rechnen. Er ist grösser und mächtiger als alles. Darum gibt es niemand, der die Schafe des guten Hirten aus der Hand des Vaters rauben kann. Ausserdem besteht zwischen dem Vater und dem Sohn sowohl im Denken als auch im Handeln eine vollkommene Übereinstimmung.
Ich bin Gottes Sohn
Aus Vers 30 erkennen die Zuhörer sofort, dass sich Jesus Christus auf die gleiche Stufe mit Gott, dem Vater, stellt. Doch die Juden wollen Ihn nicht als Sohn Gottes anerkennen. Darum legen sie seine Worte als Lästerung aus und heben Steine auf, um Ihn zu töten.
Der Herr hat viele gute Werke getan. Sie zeigen nicht nur seine Güte und sein Erbarmen gegenüber Menschen, die unter den Folgen der Sünde leiden. Sie beweisen auch, dass Er der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Die Juden übergehen jedoch bewusst diesen deutlichen Beweis seiner Gottheit und beschuldigen Ihn der Lästerung.
Trotz ihrer Feindschaft nimmt der Herr nochmals das Gespräch mit ihnen auf. Er zeigt ihnen aus dem Alten Testament, dass in der Bibel Männer mit einer besonderen Stellung im Volk Israel «Götter» genannt werden. Wie viel mehr hat Er das Recht, als Sohn Gottes anerkannt zu werden, da Er in der Ewigkeit vom Vater dazu bestimmt worden ist, in die Welt zu kommen! Seine Sendung besiegelt also, dass Er der ewige Sohn Gottes ist. Zudem zeugen seine Werke, die nur einen göttlichen Ursprung haben können, von der ewigen Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn.
Als sie Jesus verhaften wollen, entfernt Er sich auf die andere Seite des Jordan. Die Menschen, die Ihn dort aufsuchen, bezeugen, dass Johannes der Täufer die Wahrheit über Christus gesagt hat. Damit wird seine Gottessohnschaft nochmals bestätigt (Johannes 1,34). Obwohl Ihn die religiöse Führungsschicht in Israel ablehnt, glauben viele an Ihn (Johannes 7,31; 8,30).
Lazarus wird krank und stirbt
Die Krankheit von Lazarus ist für ihn und seine Schwestern eine schwere Prüfung. Wie gut, dass sie mit ihrer Not zu Jesus Christus gehen! Die Botschaft, die sie Ihm in Vers 3 ausrichten lassen, zeugt von ihrem Glauben an seine Liebe und Macht.
Die Verse 4-6 beschreiben eine dreifache Reaktion des Herrn Jesus:
- Er weist auf das Ziel dieser Prüfung hin: Es ist nicht der Tod, sondern die Verherrlichung Gottes.
- Weil Er alle drei Geschwister von Bethanien liebt, bewegt Ihn die Not, die sie getroffen hat.
- Dennoch geht Er nicht sofort zu ihnen, denn Er handelt nur, wenn der Vater Ihm einen Auftrag gibt.
Als Jesus sich nach zwei Tagen aufmacht, um nach Bethanien zu gehen, wollen Ihn die Jünger aus Furcht vor den Juden davon abhalten. Doch Er erklärt ihnen: Wer den Willen Gottes tut, der geht seinen Lebensweg am hellen Tag. Er lebt im Licht Gottes und braucht sich vor den Gefahren nicht zu fürchten.
In Vers 11 betrachtet der Herr den Tod von Lazarus aus göttlicher Sicht. In seinen Augen ist der Gestorbene nur eingeschlafen oder entschlafen. Als die Jünger seine Aussage falsch verstehen, stellt Er ihnen die menschliche Sicht vor: «Lazarus ist gestorben.»
Die Auferweckung von Lazarus hat auch im Blick auf die Jünger ein Ziel. Sie sollen erkennen und glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Macht über den geistlichen und leiblichen Tod hat. Thomas zeigt trotz seiner Furcht vor den Feinden des Herrn, dass er Ihn liebt und Ihm folgen will.
Ich bin die Auferstehung und das Leben!
Als Jesus nach Bethanien kommt, liegt Lazarus schon vier Tage in der Gruft. Damit ist sein Tod völlig bestätigt. Die vielen Juden, die zu Martha und Maria gekommen sind, sollen Zeugen der Auferstehungsmacht des Sohnes Gottes sein. Martha geht sofort zum Herrn. Ihre Worte in Vers 21 offenbaren ihren Glauben an seine Macht zur Heilung von Kranken und vielleicht einen leisen Vorwurf, warum Er nicht früher gekommen ist. Sie erkennt in Jesus den Messias, dem Gott alle Bitten erfüllt. Sie glaubt auch an eine allgemeine Auferstehung in der Zukunft (Daniel 12,13). Doch vor ihr steht der Sohn Gottes, der von sich sagen kann:
- «Ich bin die Auferstehung.» Er kann Menschen, die moralisch tot sind, aber an Ihn glauben, geistlich auferwecken. Er versetzt sie von der Stellung der Sünder in die Stellung der Erlösten (Epheser 2,6). Ausserdem besitzt Er die Macht, die entschlafenen Glaubenden bei der Entrückung aus dem Tod aufzuerwecken (1. Thessalonicher 4,16).
- «Ich bin das Leben.» Der Sohn Gottes kann Menschen, die an Ihn glauben, durch die Neugeburt geistlich lebendig machen (Epheser 2,5). Zudem wird Er den Körper der Glaubenden, die bei seinem Kommen zur Entrückung auf der Erde leben, mit göttlicher Macht verwandeln, so dass sie nie mehr sterben können (1. Korinther 15,52.53).
Martha kann die Worte des Herrn nicht fassen, dennoch hält sie im Glauben an Ihm fest. Sie spürt, dass ihre Schwester den Herrn Jesus besser verstehen wird. Darum erklärt sie ihr: «Der Lehrer ist da und ruft dich.»
Jesus vergoss Tränen
Maria steht schnell auf und geht zu ihrem Herrn. Ihr Herz zieht sie zu Ihm, denn die Trauer lastet schwer auf ihrer Seele. Sie fällt Ihm zu Füssen und unterordnet sich so seinem Handeln, ohne es zu verstehen. Wie ihre Schwester leidet sie unter der Last des Todes und kennt die Hoffnung der Auferstehung nicht. Darum ist sie in ihrer Not völlig ratlos. Aber sie nimmt demütig den Platz zu den Füssen des Herrn Jesus ein und schüttet Ihm vertrauensvoll ihr Herz aus: «Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben.»
Als Jesus sieht, welches Leid der Tod in diese Familie gebracht hat, seufzt Er tief im Geist. Er sieht das Elend, das die Sünde und der Tod unter diesen Menschen angerichtet hat. Seine Tränen bezeugen sein tiefes Mitgefühl für die geprüften und trauernden Schwestern.
Christus lebt jetzt im Himmel. Doch sein Herz hat sich nicht verändert. Auch heute empfindet Er mit, wenn Glaubende am Grab eines geliebten Angehörigen dem Tod als Folge der Sünde gegenüberstehen. Wie bewegt es Ihn, dass Menschen, die Ihm angehören, krank werden und sterben!
Die Reaktion der Juden in Vers 37 macht Folgendes deutlich: Die Menschen glaubten damals, dass Jesus durch die Heilung der Krankheit vor der Macht des Todes retten konnte. Aber sie wussten nicht, dass es Ihm auch möglich war, durch die Auferweckung eines Gestorbenen aus der Macht des Todes zu retten.
Lazarus, komm heraus!
Als Jesus zur Gruft kommt, sagt Er: «Nehmt den Stein weg!» Damit will Er klarmachen, dass Er für diese Not eine Lösung hat. Nun kann Martha ihren Unglauben nicht verbergen. Der Tod ist wirklich eingetreten und die Verwesung hat bereits begonnen. Wer kann jetzt noch helfen? Die Antwort des Herrn in Vers 40 geht sehr weit: Der Glaube sieht in der menschlichen Unmöglichkeit eine besondere Gelegenheit zur Entfaltung der Herrlichkeit Gottes!
Als abhängiger Mensch hebt Jesus seine Augen empor und betet zum Vater. Er kann im Voraus für die Erhörung danken, denn seine Bitte entspricht vollkommen dem Willen Gottes und hat nur die Verherrlichung des Vaters zum Ziel. Dann offenbart der Sohn Gottes seine Macht über den Tod. Mit Autorität ruft Er: «Lazarus, komm heraus!» Da wird der Verstorbene lebendig und verlässt die Gruft.
Wir erkennen hier die klare Illustration einer geistlichen Wahrheit: Menschen, die geistlich tot sind, bekommen durch die Neugeburt ewiges Leben. Das ist ein Werk göttlicher Macht an allen, die an den Herrn Jesus glauben. Der Mensch kann nichts dazu beitragen.
Die Aufforderung «Macht ihn los und lasst ihn gehen!» hat auch eine geistliche Bedeutung. Der Herr möchte, dass wir jungbekehrten Menschen helfen, die schlechten Gewohnheiten des alten Lebens abzulegen und in der Kraft des Geistes zur Ehre Gottes zu leben. Wie wichtig ist da eine einfache Unterweisung im Wort Gottes, damit Christen, die am Anfang des Glaubensweges stehen, geistliche Fortschritte machen können.
Warum Jesus sterben muss
Nachdem die Nachricht von der Auferweckung des Lazarus die Ohren der Pharisäer erreicht hat, versammelt sich das Synedrium zur Beratung. Obwohl ein klarer Beweis von der göttlichen Macht des Herrn Jesus vorliegt, bleiben ihre Herzen und Gewissen unberührt. Sie verharren in ihrer Feindschaft und denken nur an ihre nationale Wichtigkeit. Sie fürchten, dass die Demonstration einer solchen Macht die Römer auf den Plan rufen wird.
Der Hohepriester Kajaphas ist der Meinung, dass der Tod Jesu das Problem einer Bedrohung von Seiten der römischen Besatzungsmacht lösen wird. Er will den Herrn, der durch seine Zeichen die Gunst des Volkes auf sich zieht, mit allen Mitteln beseitigen. Seine Worte, die eine Prophezeiung darstellen, haben jedoch aus göttlicher Sicht eine andere Bedeutung: Der Mensch Jesus Christus muss für das Volk Israel sterben, damit diese Nation nicht völlig vernichtet wird, sondern in einem gläubigen Überrest eine herrliche Zukunft hat.
Der Evangelist Johannes fügt hinzu, dass der Tod des Herrn Jesus noch eine andere Wirkung hat: Auf der Grundlage seines Erlösungswerks sind die Kinder Gottes an Pfingsten in eins versammelt worden. Seither bilden sie gemeinsam die Versammlung des lebendigen Gottes.
Weil die jüdische Führerschaft die feste Absicht hat, Jesus zu töten, kann Er nicht mehr öffentlich auftreten. Er zieht sich zurück, bis seine Stunde kommt, an der Er am Kreuz als das wahre Passahlamm sein Leben lässt. Inzwischen reisen viele Juden für das Passahfest nach Jerusalem.
Maria salbt den Sohn Gottes
Der Herr kam sechs Tage vor dem Passah nach Bethanien. Das Abendessen, das Ihm dort bereitet wurde, spricht bildlich vom Zusammenkommen als Versammlung. Die Geschwister zeigen drei Merkmale, die die Glaubenden prägen sollen, wenn sie im Namen des Herrn versammelt sind:
- Bei Lazarus, der mit Jesus zu Tisch liegt, finden wir das Bewusstsein der Gemeinschaft.
- Martha ist in ihrer dienenden Gesinnung für die Anwesenden besorgt.
- Als Maria die Füsse des Sohnes Gottes salbt, offenbart sie den Geist der Anbetung.
Weil Maria dem Wort des Herrn zugehört hat, handelt sie jetzt mit bemerkenswerter Einsicht und voller Hingabe an Ihn. Sie nimmt ein sehr kostbares Salböl und salbt die Füsse Jesu rechtzeitig zu seinem Begräbnis.
Wir erkennen ausserdem einen grossen Kontrast: In dem Mass, wie sich der Hass der Juden steigert, nimmt die Liebe von Maria zu ihrem Herrn zu. Als die Feindschaft immer deutlicher zutage tritt, zeigt sie Ihm ihre Zuneigung mit dieser Salbung.
Judas Iskariot, der seine habsüchtige Einstellung kaum verbergen kann, spricht von Verschwendung. Doch das ist nicht wahr! Bedenken wir: Nichts, was für den Herrn Jesus getan wird, ist Vergeudung!
Weil sich eine grosse Volksmenge für die Auferweckung des Lazarus interessiert, wollen die Hohenpriester auch ihn töten, um den Beweis der göttlichen Allmacht des Herrn aus dem Weg zu schaffen.
Der Herr zieht in Jerusalem ein
Das grosse Wunder der Auferweckung von Lazarus beschäftigt die Leute immer noch. Als sie hören, dass Jesus nach Jerusalem komme, gehen sie Ihm entgegen, um Ihn als König von Israel zu begrüssen.
In den ersten drei Evangelien wird vor allem beschrieben, was die Jünger bei seinem Einzug in Jerusalem tun. Bei Johannes hingegen steht mehr die Volksmenge im Vordergrund, die dem Herrn zuruft: «Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels!» Trotz der Verwerfung seines Sohnes sorgt Gott dafür, dass Er unter zwei Titeln öffentlich bestätigt wird:
- Die Auferweckung des Lazarus hat Ihn klar als Sohn Gottes bezeugt. Dieses Zeugnis wird von der Volksmenge verbreitet (Vers 17).
- Durch den königlichen Einzug in Jerusalem soll Er als Sohn Davids anerkannt werden. Wieder ist es die Volksmenge, die Ihm diese Ehre gibt (Johannes 12,12.13).
Es erfüllt sich die Prophezeiung aus Sacharja 9,9, wobei die Aussage über die Rettung Israels weggelassen wird. Diese Befreiung kann zu diesem Zeitpunkt nicht Wirklichkeit werden, weil der Retter abgelehnt wird.
Damals fehlte den Jüngern das Verständnis, die Voraussage des Propheten mit dem aktuellen Ereignis in Verbindung zu bringen. Erst als Christus im Himmel verherrlicht war und der Geist Gottes in den Glaubenden auf der Erde wohnte, erkannten sie den Zusammenhang. Ist dies nicht ein deutliches Beispiel dafür, dass sie den Heiligen Geist brauchten, um das Wort Gottes zu verstehen (Johannes 14,26; 16,13)?
Wir möchten Jesus sehen
Einige Griechen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen sind, wenden sich mit der Bitte an Philippus: «Herr, wir möchten Jesus sehen.» Nun ist es seine Aufgabe, diese Menschen zum Herrn zu führen. Doch er tut es nicht allein, sondern schaltet seinen Mitjünger Andreas ein, der bereits Erfahrungen in diesem Dienst gemacht hat (Johannes 1,42). Gemeinsam bringen sie die Griechen zum Herrn Jesus.
Die Griechen möchten die Herrlichkeit des Messias sehen, der gerade als bejubelter König in Jerusalem eingezogen ist. Doch Jesus stellt sich ihnen in der Herrlichkeit als Sohn des Menschen vor. Das hat zwei Gründe:
- Erstens wird Er bald als König Israels definitiv verworfen und gekreuzigt werden.
- Zweitens haben die Griechen kein Anrecht auf die Verheissungen des Volkes Israel.
Der Herr spricht von seinem Tod, der die Grundlage einer neuen Ordnung ist. Er muss als das Weizenkorn in die Erde fallen und sterben, damit Er nicht allein bleibt, sondern sich mit erlösten Menschen verbinden kann. Nach seiner Auferstehung nennt Er die Glaubenden seine Brüder. Sie werden in der Zukunft als Miterben an seiner Herrlichkeit teilhaben.
Ein Jünger, der dem Herrn Jesus nachfolgen will, muss bereit sein, sein irdisches Leben für Christus und für eine herrliche Zukunft mit Ihm aufzugeben (Vers 25). Als Ansporn sichert ihm der Herr einen Platz im Haus des Vaters zu: «Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein» (siehe Johannes 14,3).
Glaubt an das Licht!
In Vers 27 hat der Herr Jesus die schweren Leiden seines Sühnungstodes gedanklich vor sich. Seine Seele ist erschüttert, wenn Er an das göttliche Gericht denkt, das Ihn treffen wird. Obwohl Er diese Leiden im Voraus tief empfindet, ist Er bereit, sein Leben zu opfern. Sein höchster Beweggrund, der Ihn auch jetzt leitet, ist die Verherrlichung des Vaters.
Der Vater hat seinen Namen verherrlicht, als der Sohn Gottes Lazarus auferweckt hat. Bei der Auferweckung des Herrn Jesus wird der Vater nochmals seine Herrlichkeit entfalten (Römer 6,4).
Die Stimme des Vaters aus dem Himmel ist für die Menschen, die den Herrn Jesus umgeben, ein fassbares Zeichen der Gnade Gottes. Dadurch können sie erkennen, dass Christus der Gesandte des Vaters ist. – Ab Vers 31 spricht Er über seinen Kreuzestod:
- Weil die Welt mit seiner Verwerfung Gott und seine Gnade ablehnte, wurde sie endgültig verurteilt. Seither steht sie unter dem göttlichen Gerichtsurteil.
- Am Kreuz wurde der Teufel besiegt. Seine Macht ist nun gebrochen. Bald wird er gerichtet werden.
- Der gekreuzigte Heiland ist für alle Menschen, die gerettet werden möchten, der Anziehungspunkt. Bei Ihm finden sie Vergebung der Sünden.
Als seine Zuhörer meinen, der Messias werde für immer auf der Erde bleiben, warnt der Herr sie: Noch eine kleine Zeit bin Ich als das Licht bei euch. Das ist für sie die Gelegenheit, an Ihn zu glauben. Wenn sie Ihn ablehnen, wird es in ihrem Leben dunkel.
Die Juden verhärten sich
Dieser Abschnitt ist wie eine Zusammenfassung der Situation in Israel kurz vor der Kreuzigung des Herrn Jesus.
Die meisten Menschen glaubten nicht an Ihn, obwohl Er durch viele Wunderwerke bezeugt hatte, dass Er der Messias und der Sohn Gottes ist. Es erfüllte sich die Prophezeiung von Jesaja, der einst zwei Fragen stellte:
- «Wer hat unserer Verkündigung geglaubt?» Im Allgemeinen nahmen die Menschen in Israel das Wort des Herrn Jesus nicht an.
- «Wem ist der Arm des Herrn offenbart worden?» Die Masse des Volkes lehnte auch seine Werke ab, die ein Beweis seiner göttlichen Macht waren.
Weil sie die göttliche Gnade in Jesus Christus von Anfang an verwarfen, kam der Moment, wo sie nicht mehr glauben konnten. Diese Verblendung und Verhärtung war ein Gericht Gottes, das Jesaja ebenfalls angekündigt hatte. – Genauso ist es auch heute: Wenn Menschen das Evangelium immer wieder bewusst ablehnen, verhärtet sich ihr Herz zunehmend gegenüber der Botschaft der Gnade.
Es gab zwar einige in Israel, die an den Herrn Jesus glaubten. Doch sie waren nicht bereit, die Schmach der religiösen Welt auf sich zu nehmen. Deshalb bekannten sie sich nicht zu Ihm. Sie wollten lieber von den Menschen geehrt werden, als Gottes Anerkennung zu besitzen. – Wie steht es da mit uns? Bekennen wir uns im Alltag zu unserem Herrn oder sind wir aus Furcht vor dem Spott der Menschen nur verborgene Jünger?
Am Sohn Gottes entscheidet sich alles
In diesen Versen richtet der Herr Jesus einen letzten öffentlichen Appell an die Menschen. Zuerst zeigt Er ihnen nochmals klar das Verhältnis, das zwischen Ihm und dem Vater besteht:
- Wer an Jesus Christus, den Sohn Gottes glaubt, glaubt auch an Gott, den Vater, der Ihn gesandt hat.
- Wer Jesus Christus sieht, sieht auch Gott, den Vater, den der Sohn Gottes offenbart hat.
Beides ist nur möglich, weil zwischen dem Vater und dem Sohn eine ewige Beziehung und eine vollkommene Übereinstimmung besteht.
Der Herr Jesus ist als das Licht in die Welt gekommen, um alle, die an Ihn glauben, aus der moralischen Finsternis eines Lebens ohne Gott in das wunderbare Licht der göttlichen Gegenwart zu bringen (1. Petrus 2,9). Obwohl dieses Licht in die Herzen leuchtet und alles offenbart, ist der Heiland nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu erretten (Joh 3,17). Das Licht soll die Menschen von ihrer Schuld überführen, damit sie bereit sind, Jesus Christus als Erlöser anzunehmen.
Ab Vers 48 macht der Herr deutlich, wie ernst es ist, wenn Menschen Ihm bewusst den Rücken kehren:
- Das Wort, das sie vom Heiland gehört haben, wird sie einmal verurteilen. Weil sie in ihrem Leben das Evangelium der rettenden Gnade bewusst ablehnen, wird diese Botschaft gegen sie zeugen.
- Wer Jesus Christus verwirft, lehnt auch Gott, den Vater, ab, der Ihn zu den Menschen gesandt hat. Ohne den Heiland gibt es keinen Weg zum Vaterherzen Gottes.
Buchtipp: Abschiedsworte des Herrn Jesus
Einleitung
Das Buch Daniel zeigt, dass mit dem babylonischen Weltreich die Zeiten der Nationen begonnen haben (Lukas 21,24). Es hat zwei Teile:
Daniel 1 – 6: Diese geschichtlichen Kapitel beschreiben das Leben Daniels und seiner drei Freunde im babylonischen Exil. Sie stellen uns die Herrschaft der Nationen in ihrer moralischen Entwicklung vor Augen.
Daniel 7 – 12: In diesen prophetischen Kapiteln empfängt Daniel Mitteilungen über die Machthaber der Nationen. Er erfährt, wie sie politisch vorgehen und ihre Herrschaft ausüben. Es wird ihm auch gezeigt, wie sich diese Regenten gegenüber denen verhalten, die Gott dienen.
In Babel auf die Probe gestellt
Der Prophet Daniel befasst sich in seinem Buch mit den Zeiten der Nationen (Lukas 21,24). Sie begannen, nachdem Gott seine Beziehung zu seinem irdischen Volk Israel abgebrochen und dieses aufgehört hatte, eine selbstständige Nation zu sein. Bis zum Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, um seine Regierung hier anzutreten, hat Gott die Herrschaft über die Erde in die Hand der Nationen gelegt. In den Visionen des Propheten Daniel geht es um die vier Weltreiche: Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. In den geschichtlichen Kapiteln 2 – 6 haben wir den Charakter dieser Weltreiche, und die Kapitel 7 – 12 zeigen uns ihre prophetische Geschichte.
Die ersten zwei Verse deuten das göttliche Gericht an, das durch Nebukadnezar, den König von Babel, über das von Gott abgefallene Zwei-Stämme-Reich Juda gekommen war. Als Folge der Eroberung Jerusalems kamen viele junge Menschen aus der Oberschicht Judas in die Gefangenschaft nach Babel. Der heidnische König wollte von der Elite der von ihm besiegten Völker für sein Reich profitieren. Darum kamen auch viele junge begabte Männer aus den vornehmen Familien Israels zur Ausbildung an den Hof des babylonischen Königs. Unter ihnen befanden sich vier gottesfürchtige Jünglinge, deren Namen Gott in seinem Wort festgehalten hat. Der Chef der Hofbeamten gab ihnen neue Namen: Beltsazar, Sadrach, Mesach und Abednego. In ihnen kam der Name des wahren Gottes (Elohim, Jahwe) nicht mehr vor, wie in ihren ursprünglichen hebräischen Namen (Daniel, Hananja, Misael, Asarja).
Ein Entschluss des Glaubens
Auch wenn die Welt die Namen dieser vier jungen Männer aus Juda änderte und den Namen Gottes daraus verbannte, konnte sie ihnen doch die Gottesfurcht nicht aus dem Herzen nehmen. Daniel erkannte die Gefahr der Welt. Die Tafelkost des Königs enthielt auch Fleisch von Tieren, die Gott in seinem Wort für Israel als unrein bezeichnet hatte, und Götzenopferfleisch. Sie hätten gegen Gottes Wort gehandelt und sich verunreinigt, wenn sie davon gegessen hätten. Doch Daniel wollte seinem Gott treu bleiben und sich von aller Art des Bösen, das ihn umgab und mit dem er konfrontiert wurde, absondern.
In aller Demut legte er sein Problem dem Obersten der Hofbeamten vor und bat ihn, ihn vom Zwang, sich verunreinigen zu müssen, zu befreien. Gott bekannte sich zu dieser Treue. Doch der Chefbeamte hatte Bedenken und wollte seinen Kopf nicht riskieren. Nun versuchten die vier einen neuen Anlauf. Dieses Mal sprachen sie mit ihrem direkten Vorgesetzten. Wieder fragten sie in aller Demut. Im Vorschlag, den sie ihm machten, zeigte sich ihr Gottvertrauen. Sie glaubten, dass Gott ihnen beistehen würde. Nach dem zehntägigen Test war Gottes Antwort mehr als deutlich: Die vier sahen besser aus als die anderen.
Die Merkmale dieser vier gottesfürchtigen jungen Männer waren:
- Gehorsam gegenüber dem geschriebenen Wort Gottes;
- Vertrauen auf Gott und
- entschiedene Absonderung vom Bösen.
Sind sie nicht ein anspornendes Beispiel für uns alle?
Gott bekennt sich zur Treue
Wie Gott diesen vier treuen Gläubigen half, eine chaldäische Ausbildung zu durchlaufen, ohne innerlich Schaden zu nehmen, verschweigt die Bibel. Doch Vers 17 ist richtungsweisend, wenn es dort heisst: «Ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit.» Auf diese Weise ehrte Er die, die Ihn ehrten (1. Samuel 2,30).
Die Frage der Verunreinigung in der Welt und als Folge davon die Absonderung vom Bösen war nicht eine einmalige Sache. Die Verse 8-16 beschreiben vielmehr die Gesinnung, in der die vier jungen Männer ihren Weg mit Gott gingen, auch in der Verbannung und am Hof Nebukadnezars. Niemals hätte es sonst nach dreijähriger Ausbildungszeit ein solches Resultat, wie es in Vers 20 beschrieben ist, geben können. Gott bekannte sich ganz offensichtlich zu ihnen.
Und was will Vers 21 aussagen? Zur Zeit des persischen Königs Kores, der die Juden nach 70-jähriger Gefangenschaft in ihr Land zurückkehren liess (Esra 1), musste Daniel etwa 90 Jahre alt gewesen sein. Er ist ein Gläubiger, der seinem Gott von seiner Jugend an bis ins hohe Alter treu geblieben und treu nachgefolgt ist. Welch ein Mut machendes Beispiel!
Die Geschichte des Lebens Daniels zeigt, dass Gott für die Seinen in dieser Welt in jedem Fall einen gangbaren Weg hat. Prüfungen werden nicht ausbleiben, aber Gott wird durchhelfen und Gnade für unsere Schwachheit und Barmherzigkeit in jeder Situation schenken.
Der Traum Nebukadnezars
Während den Zeiten der Nationen, die damals begannen, aber bis heute noch andauern, hat Gott sich sozusagen in den Himmel zurückgezogen. Er greift in dieser Zeit nicht direkt ins Geschehen der Völker ein. Er hat die Herrschaft der Verantwortung der Menschen übergeben und handelt nur indirekt durch seine Vorsehung.
In unserem Kapitel tut Er es durch Träume. Er will König Nebukadnezar etwas zeigen. Doch der heidnische Herrscher ruft zuerst seine Wahrsager, Sterndeuter und Magier zusammen und versucht, von ihnen eine Antwort zu bekommen.
In jener Zeit umgaben sich die Weltherrscher oft mit einem Heer von Beratern, die Verbindung zur unsichtbaren Geisterwelt hatten. Der Okkultismus war ein Mittel, durch das sie herauszufinden suchten, was die nächste Zukunft bringen würde, um dann entsprechende Entscheidungen zu treffen. Dass diese Herrscher aber den Leuten nicht immer trauten, wird aus diesem Kapitel ersichtlich. Um zu mehr Sicherheit zu kommen, verlangte der König von seinen Beratern menschlich Unmögliches: Sie sollten ihm sagen, was er geträumt hatte, und den Traum deuten.
Interessant ist die Aussage von Vers 11. Die Wahrsagepriester, Sterndeuter und Chaldäer mussten dem König sagen: «Was du verlangst, können nur die Götter anzeigen, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist.» Auch wenn diese Heiden nicht an den wahren Gott glaubten, wurde durch ihre Feststellung doch klar, dass, wenn es eine Antwort geben sollte, sie nur von göttlicher Seite her kommen konnte.
Gott antwortet auf das Gebet
In seinem Zorn befahl der König, die Weisen von Babel, die seine Forderung nicht erfüllen konnten, umzubringen. Auch Daniel und seine Genossen hätten sterben müssen. Wie reagierte er darauf?
Zunächst sehen wir, dass er völlig ruhig blieb und nach dem Grund des strengen Befehls fragte. Ja, wer auf den Herrn vertraut, wird nicht ängstlich eilen (Jesaja 28,16). Nachdem Daniel den ganzen Sachverhalt vernommen hatte, bat er um eine Frist, und sein Glaube fügte hinzu: «um dem König die Deutung anzuzeigen.» Welch ein Vertrauen hatte er in seinen Gott! Das Dritte, was wir bei Daniel und seinen Genossen finden, ist das ernsthafte Gebet zum Gott des Himmels. Gemeinsam brachten sie das Problem vor Ihn und erbaten seine Barmherzigkeit für die schwierige Situation. Damit drückten sie ihre Abhängigkeit von Gott aus. Sie erwarteten alles nur von Ihm.
Als Gott auf ihr Flehen antwortete, dankte und lobpries Daniel zuerst aus ganzem Herzen. Weisheit gab es bei den Weisen Babels, Macht beim König, aber Weisheit und Macht liegen allein bei Gott. Die weiteren Worte Daniels zeigen, dass Gott ihm nicht nur den Traum gezeigt, sondern auch die Deutung gegeben hatte. Er hatte Daniel kundgetan, was die vier Männer zusammen von Gott erbeten hatten.
Vers 21 macht deutlich, dass Gott, obwohl Er jetzt der Gott des Himmels genannt wird, alle Geschicke der Erde in seiner Hand hat. Nichts läuft Ihm aus dem Ruder. Welch ein Trost für uns Glaubende!
Daniel teilt den Traum mit
Nachdem Daniel seinen Gott für die gnädige Antwort auf das Flehen der vier Männer gepriesen hatte, teilte er Arioch mit, er sei bereit, dem König den Traum und die Deutung anzuzeigen. Nun handelte der Beamte schnell – es ging ja um Leben und Tod der Weisen von Babel – und führte Daniel vor Nebukadnezar.
Welch schöne Antwort gab der Mann Gottes auf die Frage des Königs! Er stellte zunächst klar, dass dieser etwas menschlich Unmögliches verlangt hatte. Dann gab er Gott im Himmel, dem einzig wahren Gott, alle Ehre und begann als Sprachrohr dieses Gottes zu reden. Die Haltung Daniels bezeugt, dass wahre Erkenntnis in den Wegen Gottes immer von echter Demut begleitet ist.
Was der König träumte, folgte auf seine Gedanken im Blick auf die Zukunft. Wie sollte es nach ihm weitergehen? Nun zeigte Gott durch das Standbild in seinem Traum, was nach ihm bis in die ferne Zukunft geschehen würde: Er gab ihm ein umfassendes Bild der «Zeiten der Nationen».
Das Standbild setzte sich aus fünf Teilen zusammen, wobei der fünfte Teil mit dem vierten zusammenhing, indem das Eisen sowohl in den Schenkeln als auch in den Füssen vorkam.
- Teil 1: das Haupt von Gold;
- Teil 2: die Brust und die Arme aus Silber;
- Teil 3: der Bauch und die Lenden aus Kupfer;
- Teil 4: die Schenkel aus Eisen;
- Teil 5: die Füsse teils aus Eisen und teils aus Ton.
Das Ganze wurde schliesslich von einem Stein, der sich ohne direkte Einwirkung losgerissen hatte, völlig zerstört. Der Stein selbst aber wurde zu einem grossen Berg, der die Erde füllte.
Daniel deutet den Traum
Aus der Deutung des Traums wird klar, dass es sich bei den Teilen des Bildes um aufeinanderfolgende Weltreiche handelt. Nebukadnezar stellte als das Haupt von Gold das babylonische Reich dar. Er hatte seine Macht und Autorität direkt vom Gott des Himmels bekommen.
Die Brust und die Arme von Silber wiesen auf das medisch-persische Weltreich hin, das auf das babylonische folgte. Das zweite Reich fand sein Ende, als es dem griechischen Reich unter Alexander dem Grossen Platz machen musste. Die Schenkel aus Eisen repräsentieren das Römische Reich. Weil Babylon die von Gott eingesetzte Macht war, wird sie durch Gold dargestellt. Das Eisen hingegen deutet auf die kriegsgewohnten römischen Legionen hin, die jeden Widerstand überwanden und bei der Eroberung der damaligen Welt von Sieg zu Sieg eilten. Die Füsse, die teils aus Eisen und teils aus Ton waren, beziehen sich ebenfalls auf das vierte Reich. Im Römischen Reich zeigte sich mit der Zeit ein schwächendes Element. Es ist der demokratische Einfluss, der sich aber mit der absoluten Monarchie nicht vereinbaren lässt.
Das von Gott aufgerichtete Reich (Vers 44) ist das tausendjährige Friedensreich des Herrn Jesus Christus. Er wurde in der Zeit des Römischen Reiches geboren (Lukas 2). Bald wird Er in Macht und Herrlichkeit als König der Könige wiederkommen und jede menschliche Macht beseitigen, selbst aber ewig bestehen.
Überwältigt von der göttlichen Mitteilung durch Daniel, beförderte der König ihn und seine drei Freunde zu hohen Posten im Reich.
Das Standbild
In Daniel 2,47 hatte Nebukadnezar vom Gott Daniels, dem wahren Gott, gesagt: «In Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige.» Nun machte er ein 30 Meter hohes goldenes Standbild und verlangte von allen seinen hohen Beamten in seinem ganzen Reich, dass sie vor seinem Bild niederfielen und es anbeteten. Ein goldenes Götzenbild statt Gott im Himmel anzubeten: Welch eine Glaubensprüfung für die gottesfürchtigen jüdischen Männer unter diesen Beamten! Würden sie ihrem Gott treu bleiben?
Mit der Aufrichtung dieses goldenen Bildes und der verlangten Anbetung verfolgte Nebukadnezar ein wichtiges Ziel. Er wollte die politische Einheit seines Reiches durch eine Einheitsreligion sichern. Diese war denkbar einfach und für die Menschen aller Sprachen verständlich. Ein grossartiges Bild, beeindruckend für die Augen; Musik, die dem Ohr gefiel, und ein einziger Akt des Niederfallens: Eine solche Religion stellte keine Ansprüche. Sie verlangte kein Geld und erhob keine Fragen über Sünden, die das Gewissen beunruhigten. Zudem übte die angedrohte Strafe genügend Druck aus, sodass keiner sich weigerte, diese Einheitsreligion anzunehmen. «Darum … fielen alle Völker, Völkerschaften und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an.»
In der Zukunft wird sich etwas Ähnliches abspielen. Der Antichrist wird bei Todesstrafe von den Menschen verlangen, das Götzenbild, das den Herrscher des Römischen Reiches darstellen wird, anzubeten (Offenbarung 13,12-17).
Die Freunde Daniels bleiben Gott treu
Interessanterweise wird Daniel in diesem Kapitel nicht erwähnt. In den Kapiteln 1 und 2 sahen wir einerseits, wie die vier zu Beginn des Buches erwähnten gottesfürchtigen Männer aus Juda in ihrer Gesinnung und in ihrem Verhalten die gleiche Treue zeigten. Anderseits aber scheint Daniel der Anführer der vier gewesen zu sein. Oft redete er im Namen aller. In diesem Kapitel zeigt sich, dass die Genossen von Daniel ebenso mutig und treu auf Gott vertrauten wie er. In Vers 28 preist Nebukadnezar sogar den «Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos».
Mit seinem Befehl überschritt der Absolutherrscher seine Kompetenz. Er griff in die Rechte ein, die Gott allein zustehen. Anbetung gehört nur Gott und sonst niemand. «Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen» (Lukas 4,8). Für Sadrach, Mesach und Abednego war jetzt der Moment gekommen, wo sie, obwohl sie die königliche Autorität Nebukadnezars anerkannten und sich ihr unterwarfen, Gott mehr gehorchen mussten als Menschen (Apostelgeschichte 5,29).
Sie wurden umgehend angezeigt und vor den König gestellt. Dieser war entschlossen, jede Rebellion im Keim zu ersticken und meinte dabei, er könnte es mit jedem Gott aufnehmen. Bekamen es die Männer nun mit der Angst zu tun? Überhaupt nicht! Furchtlos bekannten sie sich zu ihrem Gott, der sie in jedem Fall aus der Hand Nebukadnezars retten würde. Sie wussten zwar noch nicht wie, aber sie waren in jedem Fall nicht gewillt, das goldene Bild anzubeten.
Gott bewahrt sie vor dem Tod
Nebukadnezar war ein Absolutherrscher. Menschlich gesehen ist daher sein Grimm über die drei Männer verständlich, die es wagten, ihm zu widerstehen. Doch er hatte seine Kompetenz überschritten und musste die entsprechenden Erfahrungen machen: Die stärksten Männer seines Heeres starben, als sie die drei gottesfürchtigen Freunde gebunden in den überheissen Ofen warfen!
Und jene drei? Sie hatten sich nicht vor denen gefürchtet, die nur den Körper töten, aber nichts Weiteres tun können (Lukas 12,4). Nun durften sie als Antwort auf ihr Gottvertrauen die Gemeinschaft des Herrn mitten im Feuer geniessen (Jesaja 43,2). Es wurde wahr, was in Hebräer 11,33.34 steht: «Die durch Glauben … des Feuers Kraft auslöschten.» Der Herr bewahrte sie nicht vor der angedrohten Strafe, aber Er war bei ihnen im Feuerofen und schränkte die Kraft des Feuers derart ein, dass nur ihre Fesseln verbrannten.
Schnell änderte sich die Wut des Königs in Erschrecken, als er sah, dass die Männer nicht verbrannten und sich ein vierter, der einem Sohn der Götter glich, zu ihnen gesellt hatte. In der Folge schlug die Treue dieser Männer zur Ehre Gottes aus. Zunächst anerkannte der König ihre wahre Stellung: Knechte des höchsten Gottes. Dann mussten alle, die vorher vor dem goldenen Standbild niedergefallen waren, die Allmacht dieses Gottes bezeugen (Vers 27). Schliesslich wurde der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos gepriesen. Niemand durfte sich in Zukunft gegen Ihn äussern.
Nebukadnezar hat wieder einen Traum
Es schien, als hätten die wunderbaren Wege Gottes das stolze Herz Nebukadnezars erreicht und gebrochen (Daniel 3,29). Doch es war nicht so. Schon bald zeigte sich wieder die Überhebung des Menschen. Alles, was Gott ihm gegeben hatte, nährte nur seinen Stolz. Nun musste der Allmächtige persönlich mit ihm reden. Von seinen Erfahrungen berichtete der König Nebukadnezar im Nachhinein.
Gott sandte ihm einen zweiten Traum, den niemand deuten konnte, obwohl er ihn den Weisen Babels mitteilte. Wieder wurde Daniel vor den König gebracht. Würde er eine befriedigende Antwort geben können?
Obwohl Nebukadnezar in heidnischer Weise redet, anerkennt er doch die besondere Beziehung, die Daniel zu Gott hat. Dann erzählt der König den Traum, indem er zuerst die Vision des Baumes beschreibt, dann vom Beschluss des Himmels, ihn umzuhauen, spricht und zuletzt die Ursache für das Umhauen erwähnt.
Das Thema dieses Traums und die Erfüllung seiner Deutung behandelt ein wichtiges Merkmal der Zeiten der Nationen: die Selbstüberhebung des Menschen. Durch das, was Gott ihm verliehen hat, erhöht er sich nur und befriedigt seinen Stolz. Er vergisst, dass Gott die Oberherrschaft hat, und schaltet Ihn sogar aus seinem Denken aus. Doch dadurch wird der Mensch wie ein Tier, das kein Verständnis für Gott hat und ohne bewusste Beziehung zu Ihm lebt.
Der Traum erfüllt sich
Das Entsetzen Daniels ist begreiflich, denn er erkannte in diesem Traum, was Nebukadnezar bevorstand. In der Bibel wird der Baum oft als Symbol für eine irdische Macht gebraucht (z.B. Hesekiel 31,3; Assyrien = eine Zeder; Matthäus 13,32, was die bekennende Christenheit in der Welt geworden ist: ein Baum). Dieser im Traum beschriebene Baum war der grosse und mächtige König Nebukadnezar (Vers 19).
Der Himmel hatte über ihn ein zeitlich begrenztes Gericht angeordnet, um ihn zur Einsicht zu bringen. Er sollte erkennen, dass es einen Höheren über ihm gab und dass er unter der Herrschaft des Himmels stand. Das Gericht bestand im Verlust der Vernunft. Der König würde sich nicht mehr wie ein Mensch, sondern wie ein Tier benehmen. Von den Menschen ausgestossen, würde er bei den Tieren des Feldes wohnen und deren Nahrung teilen.
Die persönliche Warnung Daniels an den König hat auch eine prophetische Bedeutung. In den Zeiten der Nationen wird zwar die Mehrheit der Menschen wie Tiere stets zur Erde blicken, d.h. in ihrem Verhalten nicht auf die Stimme des Gewissens hören und keine bewusste Beziehung zu Gott kennen. Aber Gott wird sich auch in dieser Periode ein treues Zeugnis durch gottesfürchtige Menschen aufrechterhalten. Sie werden sich durch Abhängigkeit von Ihm und Weisheit vor den Menschen (Daniel 2), durch Hingabe an Gott (Daniel 3) und als treue Zeugen für Ihn (Daniel 4) auszeichnen. – Sehen die Menschen, dass wir als Glaubende zu ihnen gehören?
Belsazar verhöhnt den lebendigen Gott
Dieses Kapitel berichtet uns über ein grosses Festmahl, das wohl kurz vor der Eroberung Babels durch die Meder stattgefunden hat (Daniel 5,30). König Belsazar, ein Nachkomme Nebukadnezars, liess sich während des Festes dazu hinreissen, die aus dem Tempel Gottes in Jerusalem erbeuteten goldenen und silbernen Gefässe holen zu lassen. Dann tranken der König und alle Geladenen daraus und rühmten ihre Götter. Das war offenbare Gottlosigkeit – ein weiteres Merkmal der Zeiten der Nationen.
Da griff Gott auf der Stelle ein – nicht durch ein unmittelbares Gericht, sondern mit einer überaus ernsten Botschaft, die die Finger einer Menschenhand an die Wand des Festsaals schrieben. Auch wenn der König den Sinn dieser Worte nicht verstand, erkannte er doch sofort, dass sie eine Botschaft des Gottes waren, den er herausgefordert und verhöhnt hatte. Schlagartig war aus dem stolzen König ein zitternder Sünder geworden. Seine Angst erhöhte sich noch, als die herbeigerufenen Weisen die Schrift weder lesen noch deuten konnten. Da nützte auch das verlockendste Angebot nichts (Vers 7).
Die Königin-Mutter hörte von der panischen Angst und der Bestürzung, die sich im Haus des Gelages breitgemacht hatten. Sie erinnerte Belsazar an Daniel, der zur Zeit Nebukadnezars verschiedene unlösbare Fragen und Probleme gelöst hatte. Sie war überzeugt, dass er auch diese geheimnisvolle Schrift deuten konnte. Doch Belsazar hatte sich bis dahin so wenig um Daniel gekümmert wie um den höchsten Gott.
Belsazar muss sterben
Nun trat Daniel als ein dem König unbekannter Mann vor Belsazar. Das Angebot des Königs lautete: grosse Ehrungen, wenn er die Schrift deuten könne. Wie reagierte Daniel darauf? Dieser gottesfürchtige Mann war sich bewusst, dass er jetzt, anders als früher bei Nebukadnezar, vor einem übermütigen, trotzigen Feind Gottes stand. Entschieden wies er die angebotenen Geschenke zurück, erinnerte aber den König, wie Gott den stolzen Nebukadnezar gestürzt und gedemütigt hatte. Er sollte erkennen, wer der Höchste war. Belsazar war über das alles hinweggegangen und hatte sich über den Herrn des Himmels erhoben. Wie gross war seine Verantwortung!
Die Botschaft, die Gott diesem gottlosen König gesandt hatte, lautete: Gezählt, gezählt, gewogen und zerteilt. Die Tage Belsazars und die seines Königtums waren gezählt. Er selbst war auf der göttlichen Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Das babylonische Reich würde zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden.
Diese Worte waren die letzte feierliche Warnung Gottes vor dem Gericht, eine Warnung aber, die das Gericht ankündigte und keine Zeit mehr zur Busse liess. Belsazar hatte die ernste Warnung aus der Geschichte Nebukadnezars unbeachtet gelassen. So blieb kein Heilmittel für ihn übrig. Seine Stunde war gekommen (Vers 30). Das Gericht über Babel wurde vollzogen.
Das Verbot des Königs
Im ersten Kapitel sahen wir die Gefahren der Welt, denen Daniel als gottesfürchtiger junger Mann ausgesetzt war. In diesem Kapitel liegt die Betonung auf der Feindschaft der Welt, die der treue Gläubige zu spüren bekommt. – Als Darius, der Meder, regierte, war Daniel nicht mehr der jüngste. Aber obwohl er ein erfahrener alter Mann war, übte er seine beruflichen Aufgaben nicht in eigener Kraft, gestützt auf seine menschlichen Fähigkeiten, aus, sondern in der Kraft Gottes. Die Welt schätzte seine Arbeit und beförderte ihn. So nahm er auch im medisch-persischen Reich eine hohe Position in der Verwaltung ein. Doch da regte sich der Neid der anderen. Diese wollten den treuen, gottesfürchtigen Mann zu Fall bringen. Aber sie fanden keinen Anklagegrund auf beruflicher Ebene. Welch ein Zeugnis vor den Ungläubigen!
Nun diente ihnen sein Gehorsam gegenüber Gott dazu, ihre bösen Absichten auszuführen. Damit stellten sie ihm ein weiteres gutes Zeugnis aus. Der junge Mann, der sich damals im Herzen vorgenommen hatte, Gott treu zu bleiben, besass als alter Mann die gleiche Gesinnung. Er trug die gleiche Furcht Gottes im Herzen.
Wie gingen die bösen Neider gegen Daniel vor? Sie erwirkten einen Erlass, an den auch der König, der ihn unterzeichnete, gebunden war. Dieser Erlass war
- gottlos, indem ein Mensch an Gottes Stelle gesetzt wurde;
- böse, indem ein treuer Mann aufgrund seines Gehorsams zu Gott beseitigt werden sollte, und
- schmeichlerisch gegenüber Darius.
Daniel bleibt treu
Nach dem Erlass des Königs änderte Daniel seine Gewohnheit, dreimal täglich vor offenem Fenster zu beten, nicht. Warum unternahm er nichts? Alle seine Bemühungen – entweder rechtlich gegen seine Feinde vorzugehen oder den Bedrohungen auf irgendeine Weise auszuweichen – hätten ihm den inneren Frieden geraubt. So stützte er sich mit einer Gottesfurcht, die stärker war als die Angst vor dem Tod, im vollen Vertrauen auf Gott und betete wie bis dahin. Sein Gebet stützte sich auf die Verheissung in 1. Könige 8,46-53.
Die Rechnung seiner Feinde ging auf. Nun hatten sie einen legalen Anklagegrund gegen Daniel vor dem König. Da wurde Darius klar, in welche Falle er getappt war. Doch es gab kein Zurück mehr. Sehen wir hier nicht etwas von der Unerbittlichkeit der Sünde? Wer sie tut, ist ihr Sklave (Johannes 8,34).
Darius ist nicht der Einzige, der eine Tat oder eine Aussage bedauerte, ja, bereute, als er die Folgen erkannte (Herodes: Markus 6,26; Judas Iskariot: Matthäus 27,1-5). Doch ein Zurück gibt es nie. Die Folgen der Sünde bleiben. Darius musste schliesslich den Befehl geben, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Er war dem Gesetz verpflichtet. Rettung konnte es nur noch vonseiten des Gottes geben, dem Daniel diente.
Erinnert uns dies nicht an das Wirken von Gottes Gnade für uns? Nach seinen gerechten Forderungen hätte Gott uns alle verdammen müssen (Römer 3,20). Aber weil ein anderer – unser Herr Jesus Christus – allen Forderungen Gottes entsprochen und unsere Schuld bezahlt hat, konnte Er uns Gnade erweisen.
Daniel wird bewahrt
Wohl wegen seines belasteten Gewissens konnte König Darius in jener Nacht nicht schlafen. Morgens früh eilte er zur Löwengrube und rief mit trauriger Stimme nach Daniel, den er Knecht des lebendigen Gottes nannte. Sein Chefbeamter war tatsächlich noch am Leben!
Daniel sagte, die Löwen hätten ihn nicht verletzt, weil er sich keiner Schuld vor Gott und vor dem König bewusst war. Vers 24 gibt als Grund für seine Unversehrtheit sein Gottvertrauen an. Auch wenn Gott nicht immer so spektakulär eingreift, wie Er es hier und z.B. in Apostelgeschichte 12 tat – jeweils zu Beginn einer neuen Zeitperiode –, gilt der Grundsatz: Wer Gott fürchtet, Ihm die erste Priorität gibt und auf Ihn vertraut, den lässt Er nicht im Stich.
Beachten wir, wie Daniel dem König ohne Groll antwortete. Zuerst gab er Gott die Ehre und redete von dem, was Er gewirkt hatte. Erst dann sprach er von seiner Unschuld. – Die Feinde Daniels aber und damit auch die Feinde des allmächtigen Gottes wurden vom Gericht ereilt. Sie stürzten in die Grube, die sie für Daniel «gegraben» hatten. Siehe Psalm 9,16.17!
Schliesslich gab Darius Befehl, dass man «sich vor dem Gott Daniels fürchte; denn er ist der lebendige Gott und besteht ewig, und sein Reich wird nie zerstört werden, und …» Die durch das Gericht hervorgebrachte Wirkung erstreckt sich hier viel weiter als in den früheren Ereignissen (siehe z.B. Daniel 3,28.29; 4,34). Zugleich sehen wir, dass Darius sowohl Daniels Frömmigkeit achtete als auch seinen Gott ehrte, denn er nennt den lebendigen Gott den Gott Daniels.
Vier Weltreiche
Nach dem geschichtlichen Teil, in dem wir etwas vom Charakter der Weltreiche während den «Zeiten der Nationen» sahen, kommen wir zum prophetischen Teil des Buches. Anhand verschiedener Visionen wird nun die Geschichte der Weltreiche gezeigt.
Im ersten Traumgesicht sah Daniel vier Tiere aus dem grossen Meer (ein Bild des Völkermeers) aufsteigen. Nach der Erklärung in Vers 17 stellen diese vier Tiere vier Weltreiche dar. Der Löwe mit den Adlerflügeln weist auf das babylonische Reich unter Nebukadnezar hin. Der Bär spricht vom medisch-persischen Reich. Der Leopard ist ein Bild des griechischen Reiches unter Alexander dem Grossen. Das vierte Tier war ein besonderes. Es bildet das Römische Reich vor. Die vier Tiere entsprechen den vier bzw. fünf Teilen des Standbildes im Traum Nebukadnezars (Daniel 2).
Vergleicht man die Beschreibung des vierten Tieres mit der des Tieres aus dem Meer in Offenbarung 13,1-8 und Offenbarung 17,7.8, erkennt man Ähnlichkeiten. Das Römische Reich hat also nicht nur historische Bedeutung wie die ersten drei erwähnten Reiche, sondern auch eine zukünftige Seite. Diese steht in der Prophetie der Bibel im Vordergrund.
Die Verse 9-12 reden vom göttlichen Gericht, das über dieses letzte Reich kommen wird. Davon berichtet uns die Offenbarung. In Offenbarung 1 wird der Herr Jesus als der Richter beschrieben. Symbole wie weisses Haar und Feuerflamme finden wir dort und hier. Offenbarung 19 berichtet uns von seinem Kommen im Gericht, um jede Rebellion gegen Ihn auszumerzen.
Buchtipp: Jesus Christus kommt wieder!
Der Sohn des Menschen
Die Verse 13 und 14 reden vom heute noch zukünftigen Reich unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Sohn des Menschen, der mit den Wolken des Himmels kommen wird, um seine Herrschaft im Tausendjährigen Reich anzutreten, sobald das Gericht über das vierte Reich ausgeführt ist. Der Inhalt dieser Verse entspricht den Aussagen von Daniel 2,44.
Ab Vers 15 bekommt Daniel auf seine Bitte hin eine göttliche Erklärung seiner Visionen. Die vier Tiere weisen auf die vier grossen Weltreiche hin. Aber es geht Gott bei der Prophetie immer um die Seinen, um sein Volk und das schliessliche Friedensreich unter der Herrschaft seines Christus.
Auf die Bitte Daniels wird ihm das vierte Weltreich – es ist das Römische – näher erklärt. Die Beschreibung der Grausamkeit und Härte, mit der die römischen Heere die damalige Welt eroberten, trifft auf das geschichtliche Römische Reich zu. Sobald von zehn Hörnern oder Königen die Rede ist und von dem einen besonderen Horn, geht es um die Zukunft, vor allem um den zukünftigen Herrscher des wiedererstehenden Römischen Reiches. Die Abschnitte in Offenbarung 13,1-8 und Offenbarung 17,7-14 sollte man zu den vorliegenden Versen in Daniel 7 lesen. Dann wird man die Übereinstimmung erkennen. Der andere König entspricht jenem zukünftigen Herrscher. Er wird
- Worte gegen den Höchsten reden (Offenbarung 13,6);
- die Gläubigen jener Zeit verfolgen (Offenbarung 13,7);
- Zeiten und Gesetze (der Juden) ändern und
- während dreieinhalb Jahren die Oberhand haben (Offenbarung 13,5).
Der Widder und der Ziegenbock
Im dritten Jahr der Regierung Belsazars hatte der Prophet Daniel eine weitere Vision. Wieder sah er Tiere, aber dieses Mal keine Raubtiere, sondern zuerst einen Schafbock, dann einen Ziegenbock. Wieder sind wir nicht auf menschliche Fantasie oder Überlegungen angewiesen. Wir haben in den Versen 20 und 21 die göttliche Erklärung für diese beiden Tiere.
Der Widder mit den beiden Hörnern sind die Könige von Medien und Persien. Das höhere Horn, das zuletzt emporstieg, sind die Perser, die schliesslich die Führung übernahmen. – Der Ziegenbock, der von Westen her kam und den Widder überrannte, ist Alexander der Grosse, der König von Griechenland. In den Versen 5-7 werden uns die Merkmale dieses Feldherrn und seines Siegeszuges beschrieben: Schnelligkeit und vollständiger Sieg über die Perser.
Als Daniel diese Gesichte sah, bestand das babylonische Reich noch. Doch Gott zeigte ihm, was darauf folgen würde. Wir können diese Prophetie lesen und dürfen staunen, wie genau sie sich erfüllt hat, sowohl im Blick auf das persische als auch auf das griechische Weltreich. Das stärkt unser Vertrauen in alles, was Gott sonst noch vorausgesagt hat. Es wird sich ebenso genau erfüllen. Welch eine Sicherheit!
Bemerkenswert ist, dass im Urtext ab Kapitel 8 wieder die hebräische Sprache verwendet wird, während von Daniel 2,4 – 7,28 das Aramäische verwendet wurde (Fussnote zu Daniel 2,4). Der Geist gebraucht das Hebräische, weil sich die Gesichte und Offenbarungen ab Kapitel 8 speziell auf das Volk Israel beziehen.
Das grosse Horn zerbricht
Als der Ziegenbock stark geworden war, zerbrach das grosse Horn. Alexander der Grosse starb ganz plötzlich auf der Höhe seiner Macht. Seine vier Generäle teilten sein Reich unter sich auf. Sie werden in Vers 8 durch vier ansehnliche, aber doch kleinere Hörner dargestellt.
Unter Seleukos, einem dieser vier Generäle, entstand das Königreich der Seleukiden im Norden Israels. Darin profilierte sich ein besonderer König, den die Bibel als ein «kleines Horn» bezeichnet. Dieses Horn fand eine erste Erfüllung in der geschichtlichen Figur von Antiochus IV. Epiphanes, unter dem die Juden schwer zu leiden hatten. Sie werden hier das «Heer des Himmels» genannt, weil die Juden damals das einzige Volk auf der Erde waren, das in Verbindung mit Gott stand und für das Er sich interessierte.
Obwohl die Verse 10-14 in Antiochus eine Erfüllung fanden, weisen die Aussagen darin vor allem auf eine heute noch zukünftige Zeit hin. Dann wird dieses kleine Horn in Form des Königs des Nordens, wie er in anderen Schriftstellen genannt wird, auftreten. Diese Person erhebt sich gegen Christus, den «Fürsten des Heeres». Sie unterbindet den jüdischen Gottesdienst und zerstört das Heiligtum Gottes. Der Herr wird dies «um des Frevels willen» zulassen, d.h. weil sein Volk von Ihm abgefallen ist (Vers 12). Aber diese Züchtigung wird nur eine gewisse, von Gott bestimmte Zeit dauern. Auf die Frage über die Länge jenes Gerichts lautet die göttliche Antwort: 2300 Tage (ungefähr sechs Jahre). «Dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden.»
Die Deutung der Vision
Daniel wurde vom Anblick des Engelfürsten Gabriel überwältigt. Betäubt sank er auf sein Angesicht. Doch der Engel war gekommen, um ihm die Vision zu erklären, und zwar mit dem Ziel, ihm mitzuteilen, was in der letzten Zeit des Zorns geschehen würde, «denn es geht auf die bestimmte Zeit des Endes».
Zunächst spricht der Engel von dem, was unmittelbar auf das babylonische Reich folgte: das medisch-persische und das griechische unter Alexander dem Grossen. Dann werden der frühe Tod Alexanders des Grossen und die Vierteilung seines Reiches angekündigt. Wie bereits früher erwähnt, weist der König frechen Angesichts auf Antiochus IV. Epiphanes hin, der schlimm gegen die Juden vorging. Dies alles ist Geschichte.
Damit ist die Bedeutung der Verse aber nicht erschöpft. Vers 23 spricht vom Ende, «wenn die Frevler (oder Abtrünnigen) das Mass voll gemacht haben». In einer heute noch zukünftigen Zeit werden die Juden unter der Führung des Antichristen in ärgsten Götzendienst verfallen. Dann wird Gott einen Feind von aussen gegen sie erwecken. Dieser König in Vers 23 – an anderer Stelle als König des Nordens oder als Assyrer bezeichnet – wird das Volk der Heiligen verderben. Er wird sich sogar gegen Christus – den Fürsten der Fürsten – auflehnen. Doch sein Gericht wird ohne Menschenhand direkt vom Himmel aus erfolgen. – Als Daniel diese Mitteilung bekam, lag alles noch in ferner Zukunft. Heute stehen wir kurz vor dieser Endzeit. Darum sollte Johannes im Gegensatz zu Daniel seine Weissagungen nicht verschliessen (Vers 26; Offenbarung 22,10).
Daniel demütigt sich vor Gott
Daniel war ein Mann, dem das Schicksal des Volkes Israel sehr am Herzen lag. Das erkennen wir schon daran, wie sehr ihn die göttlichen Mitteilungen über die Zukunft und besonders über die Zukunft Israels beschäftigten. In diesem Kapitel finden wir ihn wegen all den Sünden seines Volkes und ihren Folgen in ernstem Gebet vor Gott.
Sein Interesse am irdischen Volk Gottes liess ihn auch die Schriften erforschen. Da fand er im Propheten Jeremia, dass Gott die Zeit der Gefangenschaft der Juden auf 70 Jahre begrenzt hatte. Dann wollte Er eine Wiederherstellung schenken. Diese Zeit war nun beinahe verstrichen.
Durch das intensive Lesen der damals vorhandenen Schriften des Alten Testaments erkannte Daniel auch, wie sehr das Volk Israel seinen Gott verunehrt und wie schwer es sich gegen Ihn versündigt hatte. Das beugte ihn tief nieder. Darum wandte er sich im Gebet mit einem rückhaltlosen Bekenntnis der Schuld an Gott. Dabei schloss er sich keineswegs aus, obwohl er zu den Wenigen gehörte, die sogar in der Gefangenschaft Gott treu geblieben waren. Er betete: «Wir haben gesündigt und verkehrt und gottlos gehandelt.» Dabei beschönigte oder rechtfertigte er nichts. Aber er klammerte sich an die Erbarmungen und Vergebung Gottes.
Wie viel können wir von Daniel lernen! Um uns her sehen wir viel Versagen im christlichen Zeugnis für den Herrn. Beugen wir uns in echter, tief empfundener Mitschuld darunter?
Daniel bittet um Gnade
Daniel erkannte aus den Schriften, wie gerecht Gott gegenüber seinem Volk gehandelt hatte. Im Gesetz Moses war angekündigt, was die Folgen des Abweichens von Ihm und des Ungehorsams gegenüber seinen Anweisungen sein würden. Gott war seinem Wort treu geblieben. Israel hatte es nicht anders verdient.
Nach dem schonungslosen Bekenntnis der Sünden und Fehltritte des Volkes Gottes – wobei er sich völlig einschloss – appellierte Daniel an die Liebe und Barmherzigkeit des Herrn. Er erinnerte Ihn an sein mächtiges Wirken, als Er Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Wie sehr wurde da sein Name geehrt! Aber jetzt waren Jerusalem und das Volk allen zum Hohn geworden. Warum? «Wegen unseren Sünden und den Ungerechtigkeiten unserer Väter», sagte der Prophet.
Dann fuhr er fort, den Herrn um Erbarmen anzuflehen. Dabei verfolgte er überhaupt keine persönlichen Interessen. Es ging ihm nur um Gott und seine Sache, um die Stadt Jerusalem, den heiligen Berg, das verwüstete Heiligtum und das Volk Gottes. Alles brachte er in Beziehung zu Gott selbst. Er erinnerte Ihn an die Ehre seines Namens, die auf dem Spiel stand. Er bat Gott «um des Herrn willen», aber auch «um deiner vielen Erbarmungen willen». Auf dieser Grundlage, und nicht auf der Basis irgendwelcher Vorzüge oder Gerechtigkeiten, flehte er: «Herr, höre! Herr, vergib! Herr, merke auf und handle; zögere nicht!»
Die 70 Jahrwochen
Daniel hatte sein Gebet noch nicht beendet, als Gott schon seinen Engel zu ihm sandte. Ja, Er versteht die Seinen, bevor sie ihre Anliegen in Worte vor Ihm ausdrücken. Und niemals wird Gott das Flehen von einem seiner Treuen und Vielgeliebten unbeantwortet lassen.
Der Prophet hatte das Wort Gottes untersucht. Nun wollte Gott ihm Verständnis darüber geben. Doch es geht Ihm nicht um die Rückkehr der Juden aus Babel, sondern um die endgültige Befreiung seines Volkes am Ende der Zeit und die Einführung des Friedensreiches unter der Herrschaft des Messias.
Der Zeitablauf wird wie folgt dargestellt: 69 Jahrwochen (1 Jahrwoche = 7 Jahre; vergleiche 3. Mose 25,8) werden vom Wiederaufbau Jerusalems unter Nehemia bis zum Kommen des Messias vergehen. Doch Dieser wird weggetan und nichts haben, d.h. Christus wurde gekreuzigt. Da Israel seinen Messias verworfen hat, wurde die Erfüllung der 70. Jahrwoche hinausgeschoben. Gott unterbrach den Zeitablauf mit seinem irdischen Volk durch die Einschaltung der heute noch dauernden Zeit der Gnade. Darüber wird im Propheten Daniel nichts gesagt.
Die Verse 26b und 27 handeln von den Ereignissen der 70. Jahrwoche. Diese wird erst nach der Entrückung der Versammlung anbrechen. In jener Endzeit wird es einen Bund zwischen den Juden unter der Herrschaft des Antichristen mit dem Herrscher des wiedererstehenden Römischen Reiches geben. Von diesem «Miteinander» ist auch in Offenbarung 13 die Rede, wo es eine Verbindung zwischen den beiden «Tieren» gibt.
Die Vision am Tigris
Die letzten drei Kapitel bilden einen in sich abgeschlossenen Teil des Buches Daniel. Wir finden darin die prophetische Sicht über die Geschichte der Juden, besonders die des gottesfürchtigen Überrests. Die Mitteilung beginnt mit der Zeit der Perserkönige und reicht bis zur endgültigen Befreiung unter der Herrschaft von Jesus Christus, was heute noch zukünftig ist. Das Ganze würde «eine grosse Mühsal» für sein Volk sein. Daniel wusste, dass Gott die Menschen aus Israel wegen ihren Sünden heimsuchen musste, und das demütigte ihn tief. Darüber trauerte er.
Nach drei Wochen hatte er eine Vision. Er sah einen furchterregenden Mann, den die Begleiter Daniels zwar nicht sahen, dessen Gegenwart sie aber spürten, so dass ein grosser Schrecken auf sie fiel. War es ein Engel oder der Herr der Herrlichkeit selbst? Die ganze Beschreibung scheint darauf hinzudeuten, dass es der Herr war, der mit seinem treuen Diener verkehren wollte.
Daniel war damals ein alter Mann. Er war sein ganzes Leben lang treu auf den Wegen Gottes geblieben. Aber als er so mit der Nähe des Herrn der Herrlichkeit konfrontiert wurde und seine Majestät sah, da verliessen ihn seine Kräfte. In diesem Zustand war er wirklich nicht in der Lage, göttliche Mitteilungen aufzunehmen. Doch der Herr war zugegen, um ihn aufzurichten und zu stärken. Er durfte sogar die Berührung einer gnädigen Hand erfahren (Vers 10; vergleiche Offenbarung 1,17).
Ein Engel stärkt Daniel
Gestärkt durch die Hand, die ihn liebevoll angerührt hatte – und getröstet durch die ermunternden Worte, die er vernommen hatte –, erhob sich Daniel. Nun durfte er hören, dass Gott ihn am Tag der Demütigung erhört hatte. Warum dauerte es drei Wochen, bis die Antwort Gottes den Propheten erreichte?
Wenn wir in den Versen 5 und 6 eine Beschreibung des Herrn selbst erkannt haben, dann spricht jetzt ab Vers 10 eine andere Person. Es ist ein von Gott zu Daniel gesandter Engel (Vers 11). Diesem widerstand der Fürst des Königreichs Persien drei Wochen lang und hinderte ihn, Daniel die Antwort Gottes sofort zu übermitteln.
Diese Verse lassen uns einen Blick hinter die Kulissen werfen. Sie zeigen uns, dass Konflikte auf der Erde, die wir verfolgen können, eigentlich die Folgen von dem sind, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht. In diesem Fall haben Engelfürsten mit den bösen Mächten gekämpft, die den weltlichen Herrscher Persiens zu beeinflussen suchten. Die Werkzeuge des Feindes suchen die Boten Gottes aufzuhalten. Aber Gott ist mächtiger als Satan. Das ist unser Trost.
Wie schön sind die Bemühungen der Engel, Daniel aufzurichten und zu stärken, damit er in der Lage ist, Gottes Mitteilung über die Zukunft Israels aufzunehmen. Zum Verständnis der Gedanken Gottes und um Fortschritte in der Erkenntnis seines Wortes zu machen, genügt es nicht, errettet zu sein und das Leben zu haben. Das Herz muss wirklich den Frieden Gottes geniessen und vertrauensvoll in Jesus ruhen.
Vom persischen zum griechische Reich
In Kapitel 11 fährt der gleiche Engel weiter, der schon in Kapitel 10 mit Daniel geredet hatte. Zunächst geht es kurz um den Niedergang des persischen Weltreiches. Der vierte König in Vers 2 ist in der Geschichte als Xerxes I. bekannt. Sein Feldzug gegen Griechenland endete mit einer Niederlage.
Der tapfere König in Vers 3 ist Alexander der Grosse, der die Perser besiegte und das griechische Weltreich aufbaute. Durch seinen frühen Tod wurde es aber unter seine Generäle in vier Teilreiche aufgeteilt. Da es Gott in der Bibel nicht um Geschichtsschreibung, sondern um sein irdisches Volk Israel geht, werden ab Vers 5 nur die zwei Teilreiche weiterverfolgt, die nördlich und südlich des Landes Israel lagen (der König des Nordens und der König des Südens).
Der erste König des Südens war Ptolemäus. Er herrschte über Ägypten. Der erste König des Nordens hiess Seleukos I. Das Hauptland seines Reiches war Syrien. Die Verse 5-9 beschreiben die Machtkämpfe zwischen diesen beiden Königreichen. Das Land Israel, wo die aus Babel zurückgekehrten Juden wohnten, lag zwischen diesen Machtblöcken. Die Auseinandersetzungen zwischen den Ptolemäern (Süden) und den Seleukiden (Norden) brachten dem jüdischen Volk unsägliche Leiden und Nöte.
Die in diesen Versen erwähnten Einzelheiten erfüllten sich wörtlich. Die menschlichen Geschichtsbücher bestätigen dies.
Ägypten und Syrien
Jede Niederlage des einen oder anderen Machthabers führte nur zu einem neuen Krieg unter dem nächsten Herrscher. Aber alle diese Konflikte konnten keine stabilen Verhältnisse herbeiführen. Das «Land der Zierde» (Vers 16) wurde daher immer wieder von fremden Heeren durchzogen und überschwemmt. Welch eine Not für seine Bewohner!
In Vers 14 heisst es sogar, dass sich Juden (Gewalttätige deines Volkes) in die Auseinandersetzung einmischten. Sie schlossen sich denen an, die gegen den König des Südens vorgingen, und meinten damit, das Gesicht (die Voraussagen) erfüllen zu können. Doch sie täuschten sich und kamen zu Fall. Gott wollte nicht, dass sich sein Volk mit den Nationen verbündete.
Die Menschen versuchten ihre ehrgeizigen, politischen Ziele nicht nur durch Kriege, sondern auch durch das Knüpfen verwandtschaftlicher Verbindungen zu erreichen (Daniel 11,6.17).
Die Verse 18-20 beschreiben den Niedergang des Reichs des Königs des Nordens, als die Römer immer mehr nach Osten vorrückten. Der Feldherr in Vers 18 ist der Anführer der siegreichen römischen Armee. Er besiegte den Seleukidenkönig und machte dessen Land zu einer römischen Provinz. Der nachfolgende Herrscher in jenem Gebiet (Syrien) war kein selbstständiger König mehr, sondern nur noch ein «Eintreiber der Abgaben» für Rom.
Antiochus IV. Epiphanes
Nach dem Tod des «Eintreibers der Abgaben» würde ein «Verachteter» aufstehen. Obwohl dieser Mann in der weltlichen Geschichtsschreibung nicht sehr bekannt ist, beschreibt ihn der Heilige Geist in unseren Versen ausführlich. Es ist Antiochus IV. Epiphanes, der sich nicht nur mit Gewalt, sondern mit Schmeicheleien des Königtums bemächtigte. Die Geschichte dieses Regenten wird uns hier deshalb so genau mitgeteilt, weil sie eng mit dem Volk Israel verbunden ist.
In Vers 22 wird ein «Fürst des Bundes» – also ein Jude – erwähnt. Doch Antiochus handelte mit Trug gegen die Juden, die sich früher mit denen verbunden hatten, die gegen den König des Südens zogen (Vers 14). Er bedrückte und quälte sie auf schlimmste Art und Weise.
Nach der Einnahme des Landes Israel zog er in einen neuen Krieg gegen den König des Südens (Ägypten). Die Pläne reden von den betrügerischen Anschlägen, mit denen jeder den anderen zu überlisten suchte (Daniel 11,25.27). Der König des Nordens kehrte mit grosser Beute in sein Land zurück. Aber in seinem Herzen hatte er sich vorgenommen, weder die Abmachung mit dem König des Südens noch den Bund mit den Juden zu halten.
Alle diese prophezeiten Ereignisse haben sich tatsächlich abgespielt. Man kann sie in den Geschichtsbüchern nachlesen. Für uns ist dies ein weiterer Beweis für die Genauigkeit der Bibel. Es ermuntert uns, dem Wort Gottes unser völliges Vertrauen zu schenken.
Ein verlorener Feldzug
Die Schiffe von Kittim stellen die römische Flotte dar. Durch ihre Ankunft wurde der letzte geplante Angriff des Königs des Nordens gegen Süden verhindert. Zur Rückkehr gezwungen, liess Antiochus seine Wut über die durchkreuzten Pläne an den Juden aus.
Die Verse 31-35 beschreiben vor allem das, was die Juden in jener Zeit durchmachen mussten. Die Bücher der Makkabäer schildern die Gräuel jener schrecklichen Zeit. Jeder Gottesdienst wurde im Land abgeschafft. Bei Todesstrafe war es verboten, dem wahren Gott zu opfern oder den Sabbat zu feiern. Im Tempel wurde ein Götzenbild aufgestellt, wobei die Juden gezwungen wurden, es anzubeten.
Jene schreckliche Zeit weist vorbildlich auf die noch zukünftige Drangsalszeit hin. Die Juden werden dann unter der Führung des Antichristen ebenfalls zum Götzendienst verleitet werden.
In jener vergangenen Zeit gab es unter dem Volk solche, «die ihren Gott kennen». Sie unterwiesen viele über die Gedanken und Wege Gottes. Doch sie wurden verfolgt und erlitten den Märtyrertod.
Auch in der kommenden Drangsalszeit wird es einen gottesfürchtigen Überrest der Juden geben. Sie werden an Gott und seinen Gedanken festhalten und dem Antichristen nicht folgen. Viele werden als Märtyrer sterben. Aber in der höchsten Not wird der Herr Jesus in Herrlichkeit erscheinen und die Treuen befreien.
Der Antichrist und der König des Nordens
Die Schlussworte in Vers 35 deuten an, dass ab Vers 36 über Ereignisse berichtet wird, die heute noch zukünftig sind. Das wird auch durch die Ausdrücke «bis der Zorn vollendet ist» und «zur Zeit des Endes» ersichtlich (Daniel 11,36.40).
Der «König» in den Versen 36-39 ist eine Persönlichkeit, die vom König des Südens und dem König des Nordens unterschieden wird. Es ist der im Neuen Testament beschriebene Antichrist – ein Jude, der sich aber über alles erhebt und sich selbst als Gott verehren lässt (vergleiche 2. Thessalonicher 2,3-10).
Neben dem Antichristen, dem inneren Feind Gottes und des treuen Überrests der Juden, reden die Verse 40-45 von den äusseren Feinden Israels. Vor allem wird der mächtige König des Nordens Israel angreifen, nachdem es bereits in seinem Land wohnen wird. Aber mitten in seinen Erfolgen wird er durch Gerüchte von Osten und Norden erschreckt und auf seiner Rückkehr von Ägypten im «Land der Zierde» direkt von Gott gerichtet werden. Eine ausführliche Beschreibung dieses Gerichts finden wir in Hesekiel 39,1-7.
Die Aussagen der Verse 36-45 zeigen deutlich, was das irdische Volk Gottes in der Zukunft zu erwarten hat. Das Volk der Juden hat den wahren Messias verworfen und gekreuzigt. In der Zukunft wird die Mehrzahl von ihnen den annehmen, der in seinem eigenen Namen kommen wird (Johannes 5,43).
Die Endzeit
Die in ihrer Schrecklichkeit und Schwere einmalige Zeit der Drangsal ist jene Periode, die dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit unmittelbar vorausgeht. Sie wird dreieinhalb Jahre dauern. Aber mit ihrem Abschluss werden die Nöte der Juden und ihre Zerstreuung in alle Welt als Folge der züchtigenden Wege Gottes mit seinem irdischen Volk ihr Ende
finden.
Wieder wird der Engelfürst Michael erwähnt. Er steht in einer besonders engen Beziehung zum irdischen Volk Gottes. Welch eine Ermunterung für die dann lebenden gottesfürchtigen Juden, die den treuen Überrest bilden! Sie dürfen wissen, dass einer hinter der Szene steht, «der für die Kinder seines Volkes steht» (Offenbarung 12,7-17).
In Vers 2 wird das Bild der Auferstehung gebraucht, um den nationalen Wiederaufbau Israels als selbstständiges Volk zu beschreiben. Die Masse des Volkes wird aber im Unglauben verharren. Doch die wahrhaft gläubigen Juden werden leuchten und in der Drangsalszeit ein Zeugnis für Gott und Christus sein, dem viele folgen werden.
Daniel musste zu seiner Zeit die Prophetie versiegeln, während für uns Christen die Worte der Weissagung nicht mehr verschlossen sind (Offenbarung 22,10.16). Durch den Heiligen Geist haben wir das volle Licht der Prophetie, das uns in dieser dunklen Welt den Weg weist (2. Petrus 1,19). An uns aber liegt es, diese Teile der Bibel unter Gebet zu durchforschen, um Gottes Gedanken besser kennenzulernen.
Die Wiederherstellung Israels
Nun ist nochmals von dem in Leinen gekleideten Mann die Rede, den Daniel schon in Daniel 10,5 sah, und der auf den Herrn der Herrlichkeit hinweist. Ihm wird die Frage über die Länge des Zeitabschnitts des Endes gestellt. Die Antwort ist klar: Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, was dreieinhalb Jahren entspricht. Diese Zeitangabe findet sich in der Offenbarung wieder und gibt die Dauer der grossen Drangsalszeit an (Offenbarung 12,14.6). Nach ihrem Ablauf wird Gott mit seinem irdischen Volk zum Ziel gekommen sein.
Auf die Frage: «Was wird das Ende (oder der Ausgang) davon sein?», bekommt Daniel keine konkrete Antwort. Wir wissen, dass diese Gerichtszeit zur Herrlichkeit und zum Segen des Tausendjährigen Reiches führen wird. Daniels Aufgabe aber war, nur über die Gerichte zu weissagen. Darum wird ihm nichts über die Herrlichkeit der Herrschaft des Herrn Jesus offenbart und mitgeteilt. Aber eines darf er wissen: Er wird auferstehen und seinen Platz im himmlischen Teil jenes Reiches haben (Vers 13).
Die Zahlen 1290 und 1335 Tage gehen über die Zeit von dreieinhalb Jahren (1260 Tage) hinaus. Sie deuten vielleicht an, dass nach dem Gericht über den Antichristen (nach 1260 Tagen) noch eine gewisse Zeit verstreichen wird, bis ganz Israel gesammelt sein wird. Erst nach einer zusätzlichen Frist wird dem Volk Gottes der volle Segen des Tausendjährigen Reiches zuteil werden.
Einleitung
Der Herr Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passah. Danach geht Er an den Ölberg, um zu beten. Dort wird Er verhaftet.
Am nächsten Morgen steht Jesus vor Pilatus, der zwar seine Unschuld bezeugt, Ihn aber trotzdem zum Kreuzestod verurteilt. Am Kreuz bittet der Heiland für seine Feinde und rettet den reumütigen Verbrecher. Nach den drei Stunden der Finsternis lässt Er sein Leben.
Doch Jesus Christus bleibt nicht im Grab. Am dritten Tag aufersteht Er und begegnet den beiden traurigen Jüngern, die nach Emmaus gehen. Nachdem Er sich den Seinen mehrere Male als Auferstandener gezeigt hat, verlässt Er die Erde. Er wird in den Himmel hinaufgetragen.
Vorbereitungen
Nun waren es nur noch wenige Tage bis zum Passahfest, an dem der Herr Jesus als das wahre Passahlamm am Kreuz sterben sollte.
Judas, der so lange in der Nähe des Heilands gelebt, aber nie wirklich an Ihn geglaubt hatte wie die anderen (Johannes 6,67-71), wurde nun zum Verräter seines Meisters. Was war das Motiv für diese niederträchtige Tat? Habsucht! Anmerkung: Weil Judas sein Herz gegenüber dem Herrn Jesus verschloss, es aber der Liebe zum Geld öffnete, war es für Satan leicht, ihn für seine Zwecke zu benutzen. Der Teufel fuhr aber erst beim Passahmahl wirklich in ihn (Johannes 13,27).
Obwohl der Herr wusste, was Ihm in Kürze bevorstand, blieb Er ruhig und voll Frieden. Er sandte zwei Jünger voraus, damit sie alles für das letzte Passah vorbereiteten. Noch einmal zeigt sich seine göttliche Majestät, obwohl Er der verworfene Erlöser war, der nichts besass. Die Jünger mussten jenem Hausherrn nur sagen: «Der Lehrer sagt dir: Wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passah essen kann?»
Sicher hatte dieser Mann eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus. Er musste einer der Gottesfürchtigen in Jerusalem gewesen sein, die bereit waren, dem Herrn mit dem, was er hatte, zu dienen (vergleiche Lukas 8,3). So durfte er Dem ein Gastzimmer zur Verfügung stellen, der auf dieser Erde keinen Ruhort hatte, «wo er sein Haupt hinlegen konnte» (Lukas 9,58).
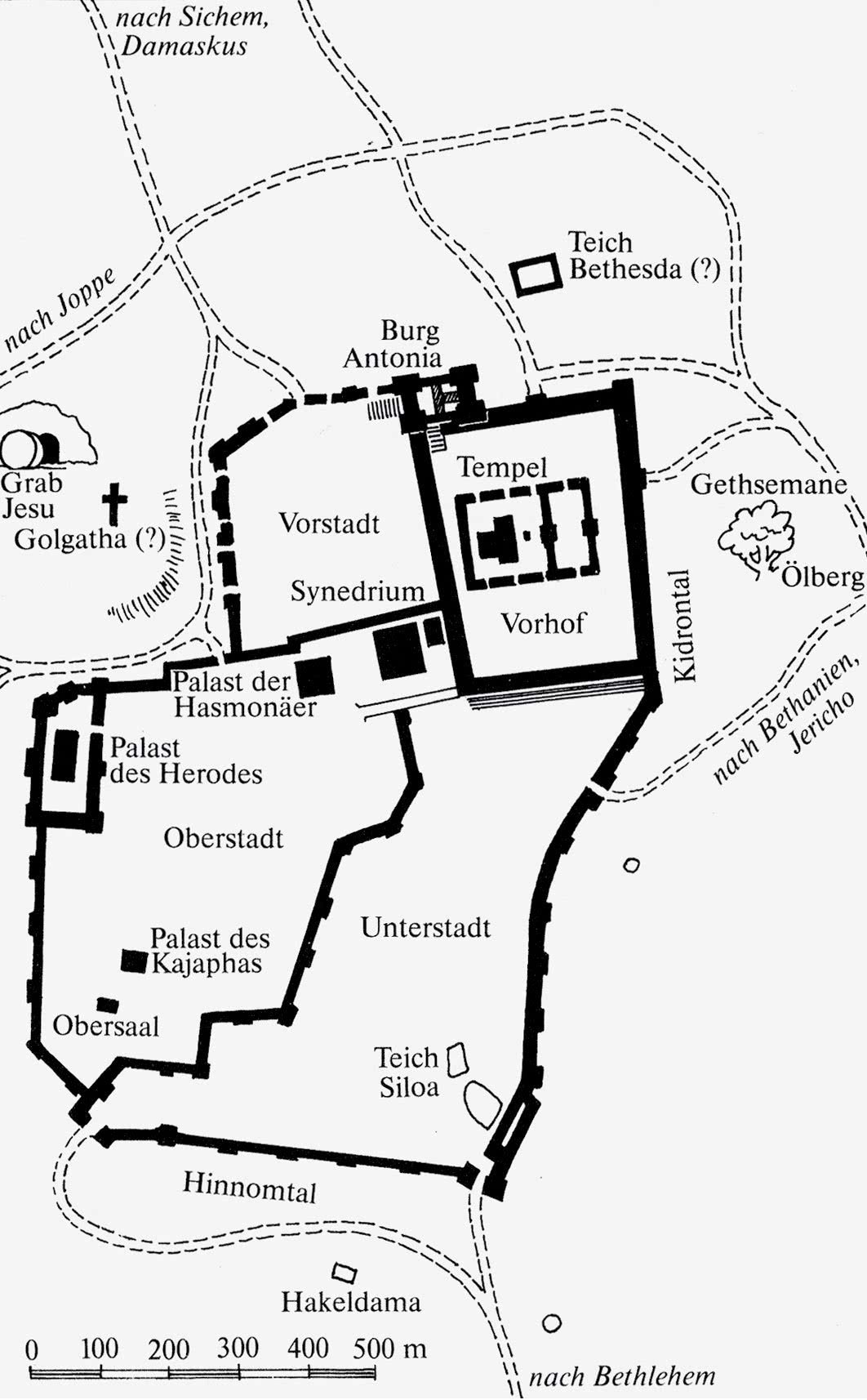
Jerusalem zur Zeit des Neuen Testaments
Passah und Brotbrechen
Nun war die Stunde des Passahmahls gekommen. Der Herr sprach wie jemand, der von seiner Familie Abschied nehmen wollte, bevor Er sie verliess. Welch eine Zuneigung kommt in seinen Worten zu seinen Jüngern zum Ausdruck! Vers 16 macht aber deutlich, dass mit diesem Passah die menschlichen Beziehungen zwischen Christus und seinem irdischen Volk endeten. Durch seine Leiden und sein Sterben erfüllte sich das, wovon das Passah ein Vorbild war. Mit dem Kelch des Passahs, aus dem Er selbst nicht trank, zeigte Er, dass sein Tag der Freude mit Israel noch in der Zukunft lag. Zuerst musste Er sterben und damit die Grundlage für eine neue Beziehung zu Israel legen.
In diesem Evangelium erkennt man klar den Unterschied zwischen dem Passah und dem Mahl des Herrn, das Er in den Versen 19 und 20 einsetzte. Es ist sein Gedächtnismahl, das uns jedes Mal an das erinnert, was unser Erlöser für uns getan hat. Ja, Er hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben (Epheser 5,2). Möchten wir Ihm eine Antwort auf seine grosse Liebe geben und seinem Wunsch nachkommen: «Dies tut zu meinem Gedächtnis.»
Was für ein Schmerz für Ihn, dass Er nun den Verräter blossstellen und dessen schreckliches Ende ankündigen musste! Wie sehr erschraken die Jünger! Ängstlich fragten sie sich, wer es wohl sei. Einer unter ihnen wusste es, doch er schwieg. Für ihn gab es kein Zurück mehr!
Ermahnungen und Warnungen
Der Meister war auf dem Weg zum Platz tiefster Erniedrigung: zum Kreuz. Wie beschwert muss sein Herz gewesen sein, wenn Er einerseits an den Verräter dachte und anderseits an all das Schwere, das Ihn erwartete. Und die Jünger? Sie stritten sich in diesen Augenblicken darüber, wer unter ihnen für den Grössten zu halten sei. Und wieder zeigt sich die Gnade des Herrn. Er dachte nicht an sich und seine Not, sondern versuchte sie von ihren törichten Gedanken abzubringen, indem Er ihnen zeigte, was wahre Grösse vor Gott ist. Dabei stellte Er sich selbst als leuchtendes Vorbild echter Demut vor.
Anstatt ihnen einen Vorwurf zu machen und ihre schreckliche Selbstsucht anzuprangern, versuchte Er sie in seiner Gnade zurechtzubringen. Er sagte ihnen: «Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben.» Dafür verhiess Er ihnen einen besonderen Segen. Wie viel können wir von unserem Herrn lernen, wenn es darum geht, anderen in Gnade zu begegnen.
Aber dann hatte der Herr noch eine Warnung an Petrus. Er sollte aus Erfahrung lernen, dass das Fleisch nichts nützt. Wir haben in uns keine Kraft, ein gottesfürchtiges Leben zu führen und in den Versuchungen standhaft zu bleiben. Wenn wir dies nicht mit Gott lernen, müssen wir es im Verkehr mit dem Feind lernen.
Der Herr betete für Petrus, damit er im Glauben nicht Schiffbruch erlitt. Aber die bitteren Erfahrungen mit seiner eigenen Natur konnte Er ihm nicht ersparen. Denn Petrus war nicht bereit, sich warnen zu lassen. Zu sehr war er von seiner Liebe zum Herrn überzeugt.
Im Garten Gethsemane
Bis dahin hatte der Herr als Messias für die Seinen gesorgt. Nun zeigten sich völlig veränderte Umstände. Mit der Kreuzigung würde seine Verwerfung ihren Höhepunkt erreichen. Jetzt galt es, einem verworfenen und von der Erde abwesenden Herrn nachzufolgen. Dazu brauchte es Glauben. Doch die Jünger scheinen die Worte des Herrn nicht erfasst zu haben.
In Lukas 4,13 lasen wir, dass der Teufel für eine Zeit vom Herrn wich. Hier im Garten Gethsemane, als Christus im Gebet vor seinem Vater war, tauchte der Widersacher wieder auf. Die ganze Schwere des Kelches des Zornes Gottes über die Sünde stand hier vor der Seele des Heilands. Da versuchte Satan Ihn in eine Angst zu treiben, in der Er unterliegen sollte. Und der Herr? Als der Heilige und Sündlose konnte Er niemals wünschen, zur Sünde gemacht zu werden. Wenn es aber keinen anderen Weg gab, als zum Sündenträger und für uns zur Sünde gemacht zu werden, dann war Er dazu bereit. In seinem Gehorsam und in seiner Hingabe an seinen Gott und Vater wollte Er nichts anderes als dessen Willen erfüllen.
Dieses Evangelium betont die Menschheit unseres Erlösers. Darum wird der Engel, der vom Himmel kam und Ihn stärkte, nur hier erwähnt. Wie schwer dieser Kampf war, den der Mensch Jesus Christus im Gebet ausfocht, zeigen auch die Worte: «Sein Schweiss wurde wie grosse Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen.» Doch Er stand als Sieger auf, um den Weg nach Golgatha zu gehen.
Judas verrät seinen Meister
Zweimal hatte der Herr seine elf Jünger aufgefordert: «Betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt.» Dadurch wären sie bereit gewesen, in der nun plötzlich eintretenden Prüfung standhaft zu bleiben.
Welch ein Gegensatz zwischen dem Herrn und seinem Jünger Petrus! Der Heiland war in ringendem Kampf vor Gott gewesen. Nun stand Er ruhig und gefasst vor den Menschen, die Ihn verhaften wollten. Die Jünger aber wurden unruhig und verwirrt. Ohne eine Antwort auf die Frage: «Sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?» abzuwarten, schlug Petrus den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Das war nutzloser, fleischlicher Eifer für seinen Herrn. Dieser aber heilte in seiner Gnade den Verwundeten.
Doch die Stunde seines Dienstes in Gnade und Liebe gegenüber seinem Volk war vorüber. Jetzt folgte eine andere Stunde. Es war die Stunde seiner Feinde, die Ihn tödlich hassten, und die Gewalt der Finsternis. Hinter den Menschen, die gegen Ihn gekommen waren, stand Satan.
Bevor die Menge Ihn festnahm, hatte der Herr noch ein Wort an ihre Herzen und Gewissen. War Er ein gefährlicher Räuber, dass sie mit einer solchen Bewaffnung gegen Ihn antraten? Täglich hatte Er vor ihren Augen im Tempel gelehrt und gewirkt. Ihn vor den Augen des Volkes gefangen zu nehmen, hatten sie sich nicht getraut. Anderseits hätten sie nicht Hand an Ihn legen können, bevor seine Stunde gekommen war (Johannes 7,30; 8,20).
Petrus verleugnet seinen Herrn
Nachdem der Herr Jesus als Verhafteter weggeführt worden war, galt es für Petrus ernst. Hatte er nicht erklärt: «Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen.»? Er folgte seinem Herrn von weitem. Im Garten Gethsemane hatte er geschlafen statt gebetet. Jetzt versuchte er aus eigener Kraft, dem Herrn zu folgen und Ihm seine Liebe zu beweisen. Das musste schief gehen.
Im Hof des hohenpriesterlichen Hauses hatten sie ein Feuer angezündet, und Petrus setzte sich mitten unter die Feinde seines Meisters. Dann erfolgte der Angriff Satans. Zuerst erklärte die Magd, dann die beiden Diener, dass sie ihn als Anhänger des Nazareners erkannten. Derart in die Enge getrieben und wohl aus Angst um sein eigenes Leben verleugnete er seinen Herrn mit zunehmendem Nachdruck. Beim Krähen des Hahns wandte der Herr sich um und blickte Petrus an. Da wurde dem armen Jünger die ganze Schrecklichkeit seiner Sünde bewusst. Er war tief gefallen, wie Jesus es ihm vorausgesagt hatte. Mit Tränen bitterer Reue verliess er diesen gefährlichen Ort.
Sind wir besser als Petrus? Nein. Unser Fleisch ist genauso trügerisch wie das von Petrus. Deshalb müssen wir die Orte meiden, wo wir kein Zeugnis für unseren Heiland sein können (vergleiche Psalm 1,1). Sich am Kohlenfeuer der Welt zu wärmen, kann für jeden von uns gefährlich werden. Und vergessen wir nicht: Gott hat uns nicht versprochen, uns auf einem eigenwilligen Weg zu bewahren.
Jesus vor dem Synedrium
Die Führerschaft der Juden liess sich bis zum Morgen Zeit, um ihren Gefangenen vor die höchste jüdische Instanz, das Synedrium, zu führen. In der Zwischenzeit überliessen sie Ihn ihren Untergebenen, die Ihn nach ihrem Gutdünken verspotteten und verschmähten.
Der Herr Jesus wusste, dass seine Verurteilung beschlossene Sache war – noch bevor die Gerichtsverhandlung begann. Darum gab Er ihnen auf ihre Frage, ob Er der Christus sei, keine direkte Antwort. Hatte Er sich ihnen nicht genügend oft als Messias (Christus) vorgestellt? Doch sie hatten Ihn klar verworfen. Nun zeigte Er sich ihnen als Sohn des Menschen, dem der Ehrenplatz zur Rechten der Macht Gottes gehört. Aus seinen Worten zogen die Richter den Schluss: «Du bist also der Sohn Gottes?» Er bejahte es.
Vers 71 deckt die grosse Sünde jener verantwortlichen Führer auf. Im Unglauben lehnten sie Ihn als Den ab, der Er war. Sie meinten, genügend Grund zu haben, Ihn zu verurteilen. Für sie war Er ein Gotteslästerer. Welch eine Schuld luden sie auf sich, als sie Ihn wegen seines Bekenntnisses, der Christus, der Sohn des Menschen und der Sohn Gottes zu sein, zum Tod verurteilten!
Unzählige Male hatte Er ihnen die Wahrheit seiner Worte bewiesen. Zuletzt im Garten Gethsemane, wo Er das Ohr des Knechtes geheilt hatte. Doch ihre Herzen und Gewissen waren völlig verhärtet.
Jesus vor Pilatus und Herodes
Da die Juden unter römischer Besatzung lebten, war es ihnen nicht erlaubt, ein endgültiges Gerichtsurteil zu fällen. Darum führten sie Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter und obersten Richter.
Die Juden formulierten ihre Anklage so, dass sie den Argwohn des Römers wecken musste. Sie sprachen von Verführung einer Nation, was zu einem Aufruhr im Römischen Reich hätte führen können. Sie unterschoben dem Herrn, was Er gerade nicht gesagt hatte: dem Kaiser keine Steuern zu zahlen. Das wäre offene Rebellion gegen die bestehende Ordnung gewesen. Schliesslich erwähnten sie, Er sei König. Das wäre ja eine Konkurrenz zum Kaiser gewesen. Doch Pilatus fand keine Schuld an diesem Menschen.
Als er hörte, dass Jesus aus Galiläa war, sandte er Ihn zu Herodes, der damals gerade in Jerusalem weilte. Dieser hätte Ihn schon seit langem gern gesehen. Doch der Herr Jesus hat nie die Neugier der Menschen befriedigt. Es ging Ihm immer um ihre Herzen und Gewissen.
Als Herodes sein Ziel nicht erreichte, überschüttete er den Gefangenen mit Hohn und Spott und sandte Ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, obwohl sonst neidisch aufeinander und in Feindschaft gegeneinander, wurden Freunde, als es darum ging, Christus zu verwerfen. Was ist das für eine trübe Freundschaft, die zwei Menschen in der Ablehnung und Verachtung des Sohnes Gottes verbindet! – Die treibende Kraft des bösen Willens aber lag bei den Juden. Sie waren überall mit ihren Anklagen zugegen (Lukas 23,2.5.10).
Jesus wird zum Kreuzestod verurteilt
Nun lag der Fall wieder bei Pilatus. Als Richter versuchte er der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Sein Urteil und das von Herodes lauteten übereinstimmend: schuldlos, nichts, das ein Todesurteil gerechtfertigt hätte. Um dem Volk ein Stück weit entgegenzukommen, wollte er den Angeklagten züchtigen – obwohl kein Grund dafür vorlag – und Ihn dann freilassen. Nun machte ihm eine bestehende Tradition, der er entsprechen musste, einen Strich durch die Rechnung: die Freilassung eines Gefangenen zum jüdischen Passahfest. Die ganze Menge forderte den Tod von Jesus Christus, aber die Freilassung des gefangenen Mörders und Aufrührers Barabbas.
Pilatus gab nicht so schnell auf. Ein zweites und ein drittes Mal versuchte er die Leute von der Unschuld Jesu zu überzeugen und von seinem Willen, Ihn freizulassen. Doch er hatte keine Chance. Hinter den schreienden Menschen stand Satan, der den Sohn Gottes zu beseitigen suchte.
Schliesslich gab der Richter nach. Er liess den Aufrührer und Mörder Barabbas frei und übergab Jesus dem Willen des Volkes. So machte sich der verantwortliche Richter, der gleichzeitig der Vertreter der Nationen darstellt, am Tod von Jesus Christus schuldig. Er hatte den Gerechten nicht beschützt und ein ungerechtes Urteil über Ihn ausgesprochen. Doch der Mensch ohne Gott hat in der Gegenwart des Bösen keine Kraft, das Gute zu tun. Das ist auch heute noch so.
Jesus wird gekreuzigt
Warum richtete der Herr so ernste Worte an die wehklagenden Frauen, die Ihn auf dem Weg zur Richtstätte begleiteten? Er sah, dass es natürliche Gefühle waren, kein echter Glaube an Ihn, die diese Frauen zu Tränen rührten. Er musste ihnen zeigen, dass man von Mitleid gerührt sein kann und doch unter das Gericht als Folge seiner Verwerfung und seines Todes fallen kann. Das grüne Holz war Er, der seine ganze Kraft für Gott einsetzte. Er wurde von den Menschen verworfen. Das dürre Holz stellt das ungläubige Volk dar, das ohne Leben und Frucht für Gott war und schliesslich von Ihm verworfen wurde.
Die Menschen kreuzigten den Herrn Jesus zwischen zwei Übeltätern, als ob Er der schlimmste gewesen wäre. Er aber bat für die, die Ihn so grausam behandelten. Gott erhörte diese Bitte seines Sohnes und gab dem Volk noch eine Gnadenfrist. In seiner Predigt in Apostelgeschichte 3 sagte Petrus zu den Juden: «Jetzt, Brüder, ich weiss, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt … So tut nun Buße und bekehrt euch.»
Ein Verbrecher wird gerettet
Kaum war der Heiland gekreuzigt, meinten seine Feinde, ihr Ziel sicher erreicht zu haben. Nun ergoss sich ihr Spott und ihre Verachtung über den «Mann der Schmerzen». Wie sehr haben sie mit ihren bösen Worten seine heilige Seele verletzt! Doch Er war der Christus, der Auserwählte Gottes und der König der Juden. Die ganze Welt konnte es lesen, auch wenn sie es nicht glaubten.
Nicht nur die Zuschauer verspotteten den Heiland, auch einer der gehängten Übeltäter lästerte Ihn. In jedem nicht erneuerten Herzen gibt es einen instinktiven Widerstand gegen Jesus Christus (Römer 3,10-12).
Der andere Verbrecher, der kurz zuvor selbst gespottet hatte (Markus 15,32), sah die Sache plötzlich ganz anders. Er erkannte sich und den in der Mitte Gekreuzigten im Licht Gottes. Er selbst hing zu Recht am Kreuz. Das war die Strafe für seine bösen Taten. Aber «Dieser» war sündlos. Das Einzige, was dieser gehängte Mann tun konnte, tat er: Er bekannte, dass Jesus Christus Herr ist, und glaubte im Herzen an Ihn (vergleiche Römer 10,9). Dann setzte er sein Vertrauen auf den Erlöser und empfing mehr, als er zu bitten wagte. Noch am gleichen Tag, wenn sowohl der Herr als auch er gestorben sein würden – nicht erst wenn Christus in Herrlichkeit wiederkommt –, durfte er mit Ihm vereint im Paradies sein.
Jesus stirbt
Lukas betont die Ergebnisse des Erlösungswerks. Das Werk selbst fand im Dunkeln statt. Aber dann leuchtete das Licht der Gnade durch die Finsternis. Der Vorhang zum Allerheiligsten riss mitten entzwei und der Weg zu Gott war offen. Alles war vollbracht. Darum übergab Jesus seinen Geist in die Hände des Vaters.
So etwas hatte dieser römische Hauptmann noch nie erlebt. Er verherrlichte Gott und anerkannte: «Wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht!» Was dachten die Menschen, die sich an die Brust schlugen? Sie ahnten wohl nichts Gutes. Jene aber, deren Herz für den Herrn schlug, standen voll Furcht von fern.
Ein würdiges Begräbnis
Nach dem Tod seines Sohnes liess Gott nicht zu, dass irgendein Ungläubiger Hand an Ihn legte. Auch wenn die Feinde des Herrn sein Grab bei Gottlosen bestimmten, sorgte Gott dafür, dass Er in seinem Tod bei einem Reichen war (Jesaja 53,9). Dieser Reiche war Joseph von Arimathia, ein Ratsherr, der sich gegen die Verurteilung des Herrn Jesus eingesetzt hatte. Seine soziale Stellung erlaubte es ihm, bei Pilatus vorzusprechen und um den Leib Jesu zu bitten. Seiner Bitte wurde entsprochen. Und so konnte er den Erlöser würdig begraben, und zwar in einer Felsengruft, in der noch nie ein Toter gelegen hatte.
Das erfolgte am Freitagabend. Dann brach der Sabbat an. Die Frauen, die dem Herrn Jesus von Galiläa nachgefolgt waren (Lukas 8,2), und beim Kreuz von fern zugesehen hatten, nahmen an der Grablegung ihres Heilands teil. Sie sahen alles und wollten nach dem Sabbat zurückkommen, um seinen Leib zum Begräbnis zu salben. – Wo waren die Jünger? Wir finden sie weder beim Kreuz – ausser Johannes (Johannes 19,26) – noch bei der Grablegung. Aber welch eine Hingabe offenbaren diese Frauen!
Mit dem Tod des Herrn Jesus ging die Phase der Erprobung des Menschen durch Gott zu Ende. Der Mensch hatte sich als ein hoffnungslos verlorener Sünder erwiesen. Hoffnung gibt es für ihn nur aufgrund des Todes und der Auferstehung des Sohnes Gottes. Das Angebot der Gnade lautet nicht: «Tu dies oder das», sondern: «Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden.»
Der Herr Jesus ist auferstanden
Das Herz dieser Frauen brannte wirklich für ihren Herrn. Wie sehr Gott diese Hingabe wertschätzte, zeigt sich darin, dass Er die Namen dieser Frauen in seinem ewigen Wort festgehalten hat (Vers 10). Und so liefen sie, sobald der Sabbat vorbei war, ganz in der Frühe des ersten Tages der Woche, zur Gruft. Doch das Grab war leer! Ihre Verlegenheit in Vers 4 zeigt, dass sie sich in keiner Weise an die Worte Jesu erinnerten. Mehr als einmal hatte Er zu ihnen von seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung gesprochen (Lukas 9,22.44; 18,32.33).
Zwei Engel als dienstbare Geister für die Glaubenden halfen ihnen weiter. Sie fragten: «Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten?» Er war auferstanden, gemäss dem Wort, das Er ihnen früher mitgeteilt hatte. Nun erinnerten sich die Frauen wieder daran.
Unverzüglich kehrten sie mit der Botschaft über seine Auferstehung zu den Elfen zurück. Doch sie lösten damit keine Freude aus. Die Reaktion der Jünger war: «Sie glaubten ihnen nicht.» Waren sie wirklich so träge im Begreifen?
Petrus wollte sich selbst vom Tatbestand überzeugen. Er fand es so, wie die Frauen gesagt hatten. Doch die Verwunderung blieb. Er kam in seinen Gedanken nicht weiter. Kurz darauf aber erschien ihm der Herr persönlich (Vers 34). Er liebte seinen Jünger trotz allem Vorgefallenen und wollte ihn wieder zurechtbringen.
Auf dem Weg nach Emmaus
Diese Geschichte gibt uns nochmals ein sehr schönes Bild von der Gnade des Herrn, wie sie sich besonders in diesem Evangelium zeigt. Zwei niedergeschlagene Jünger verlassen Jerusalem, den Ort des Segens, weil alle ihre Hoffnungen zerstört sind. Sie haben viel miteinander zu reden. Da nähert sich ein Unbekannter und fragt sie nach ihrem Gesprächsthema.
Nun bleiben sie stehen und beginnen zu erzählen. Und der Herr? Er hört zu, ohne die zwei zu unterbrechen. Ihre Worte zeigen, dass ihre Hoffnungen rein irdischer Natur waren. Es ging ihnen in erster Linie um ihr Volk, und erst in zweiter Linie um Ihn, den Erlöser. Ihre Worte offenbaren aber auch Unglauben. Obwohl Er ihnen seine Auferstehung vorausgesagt hatte, glaubten sie nicht recht daran.
Dann beginnt Er, der den beiden immer noch unbekannt ist, zu reden. Er kann ihnen einen Vorwurf des Unverstands, der Trägheit ihrer Herzen und des Unglaubens an die alttestamentlichen Prophezeiungen nicht ersparen. Aber dann – welch grosse Gnade – beginnt Er ihnen die Schriften zu öffnen. Und wer ist ein Lehrer wie Er? (Hiob 36,22). Er zeigte ihnen auch all jene Stellen, die von den Leiden des Christus reden, und erklärte ihnen, dass der Weg zur Herrlichkeit, auf die ihre ganze Hoffnung gerichtet war, durch Leiden führte. Das Kreuz war ein Muss auf dem Weg unseres Heilands. – Welch eine herrliche Stunde, als der Herr ihnen das Alte Testament erklärte und sie auf all die Stellen hinwies, die Ihn betrafen! Das war die beste Medizin für ihre beschwerten Herzen.
Die Augen werden aufgetan
Auch wenn die beiden Jünger zunächst stehen blieben, als der Unbekannte sich nach ihrem Problem erkundigte (Lukas 24,17), scheinen sie doch zusammen weitergegangen zu sein. Jedenfalls erreichten sie, während sie dem Fremden zuhörten, wie Er ihnen die Stellen über den Messias im Alten Testament erklärte, ihr Ziel. Als der Fremde weiterziehen wollte, nötigten sie Ihn, bei ihnen zu bleiben. Der Herr drängt sich niemand auf. Aber wenn wir Ihn einladen, in unser Herz, in unser Leben und in unser Haus einzukehren, wird Er bleiben. Aber beachten wir Vers 30. Wenn wir Ihn in unser Leben einladen, wird Er die Führung übernehmen. Und das ist gut so.
Bei der gemeinsamen Mahlzeit, als Er die Rolle des Hausherrn übernahm, erkannten sie Ihn am Brechen des Brotes. Vermutlich sahen sie dabei die Wundmale von den Nägeln des Kreuzes in seinen Händen. Dann verschwand Er vor ihnen. Nun begriffen sie, warum ihnen auf dem Weg das Herz warm geworden war, als sie mehr und mehr Verständnis über viele Stellen des Alten Testaments bekamen. Sofort machten sie sich auf den Weg nach Jerusalem zurück zu den anderen Jüngern. Oh, sie hatten ihnen ganz Wichtiges mitzuteilen. Bei den Elfen angekommen, hörten sie zuerst, was diese erlebt hatten: Der auferstandene Herr war seinem gefallenen Jünger Petrus persönlich erschienen. Bei jener höchst privaten Unterredung kam er innerlich wieder in Ordnung mit seinem Meister, den er verleugnet hatte. Dann aber erzählten die beiden Emmaus-Jünger ihre Erlebnisse. Welch eine Freude für alle!
Der Herr kommt in die Mitte der Seinen
Und dann trat Der, dessen Herzen alle bewegten, der das besondere Gesprächsthema der versammelten Jünger war, höchstpersönlich in ihre Mitte. Trotz seinem Friedensgruss erschraken sie. War Er es tatsächlich, oder war es nur ein Geist? Wie viel Geduld hatte der Herr mit den Seinen, auch nach seiner Auferstehung! Ja, bis heute erträgt Er uns, die wir oft so schwer von Begriff sind, mit grosser Geduld.
Er machte damals den Jüngern deutlich, dass Er leiblich auferstanden war. Er hatte wirklich einen Auferstehungsleib, der zwar nicht mehr an die Gesetze der ersten Schöpfung gebunden war. Doch indem Er vor ihnen ass, verdeutlichte Er seine Worte, sodass es allen klar sein sollte: Christus ist als Mensch auferstanden. Er lebt als Mensch.
Der Auftrag und die Himmelfahrt
Da Jesus Christus im Begriff stand, sie zu verlassen und in den Himmel zurückzukehren, sandte Er sie als seine Zeugen in die ganze Welt. Ihre Verkündigung sollte bei der Stadt beginnen, die Ihn gekreuzigt hatte. Welch eine Gnade! Dann aber sollten sie weitergehen zu allen Nationen. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft für alle Menschen. Keiner ist da ausgeschlossen. Um diesen Dienst tun zu können, würde Er ihnen den Heiligen Geist, diese Kraft aus der Höhe, senden.
Dann verliess der Herr mit segnenden Händen die Erde. Bis heute hat Er sie noch nicht zurückgezogen. Im Himmel verwendet Er sich für die Seinen, die hier auf der Erde leben. Haben wir nicht wie die Jünger damals Grund, unseren Glaubensweg mit Freuden zu gehen?
Einleitung
Nachdem Gott Saul als König verworfen hatte, ging Samuel in seinem Auftrag nach Bethlehem und salbte dort David zum König. Doch es vergingen noch Jahre, bis David auf den Thron kam.
David besiegte den Riesen Goliath, was dem ganzen Volk zugute kam. Da wurde König Saul eifersüchtig auf David und wollte ihn töten. So musste David viele Jahre vor Saul fliehen.
David ging als Gläubiger durch Höhen und Tiefen. Manchmal handelte er im Vertrauen auf Gott, manchmal wählte er einen eigen Weg. Wie gut, dass Gott ihn immer wieder zurechtbrachte!
Saul offenbarte einen abgrundtiefen Hass gegen David. Er konnte zwar fromm reden, hatte aber keine Glaubensbeziehung zu Gott. Im Kampf gegen die Philister nahm er sich das Leben.
David wird zum König gesalbt
Samuel trauerte so lang um Saul, dass der Herr schliesslich eingreifen und den Propheten aufrütteln musste. Gott bleibt beim Versagen des Menschen nicht stehen, auch wenn es heisst, dass es Ihn reute, Saul zum König gemacht zu haben. Er gibt Samuel einen neuen Auftrag. Mit seinem Horn voll Öl (was von Bestand spricht) soll er einen der Söhne Isais zum König salben. In seiner Gnade kommt Gott dem ängstlichen Propheten und seinen Einwänden entgegen. Die Salbung des neuen Königs soll anlässlich eines Opferfestes erfolgen, sodass kein Verdacht auf Samuel fallen kann.
In Vers 7 wird uns mitgeteilt, was Samuel dachte, als er den Erstgeborenen Isais sah. Er hatte immer noch das äussere Bild Sauls vor Augen. Aber Gott beurteilt die Menschen nach anderen Kriterien als wir. Er sieht auf das Herz. Später sagte Petrus zum Römer Kornelius: «In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt (d.h. gläubig ist), ihm angenehm ist» (Apostelgeschichte 10,34.35).
Sieben Söhne Isais kamen vor Samuel, aber keinen von ihnen hatte der Herr erwählt. David, den jüngsten, hatte man gar nicht zum Opferfest geholt. Er war mit den Schafen und Ziegen noch auf der Weide. Aber gerade ihn hatte Gott ausersehen. Er war der Mann nach seinem Herzen. – Wir finden bei David viele Hinweise auf den Herrn Jesus, z.B. als den Hirten, als den Gesalbten des Herrn, aber auch als den, auf den der Geist Gottes kam und blieb (Johannes 1,33).
David hält sich am Königshof auf
Zur Zeit, als der Geist des Herrn über David kam, wich Er von Saul. Das war die Folge der Verwerfung durch Gott (1. Samuel 15,23). Was aber noch schlimmer war, finden wir im zweiten Teil von Vers 14: «Ein böser Geist von dem Herrn ängstigte ihn.» Die Beamten des Königs hatten Mitleid mit ihm und suchten einen Weg, um ihm Erleichterung zu verschaffen.
Durch Gottes Vorsehung kam der frisch gesalbte König in die Nähe des amtierenden Königs, den Gott aber verworfen hatte. David musste damals noch sehr jung gewesen sein. Und doch hatte er ein aussergewöhnlich schönes Zeugnis von den Menschen (Vers 18). Das Wichtigste aber war, dass es von ihm heisst: «Der Herr ist mit ihm.» Auch darin glich er unserem Herrn Jesus (Apostelgeschichte 10,38).
David kam zum König und wurde am Königshof behalten. Seine Bemühung, dem geängstigten König mit Lautenspiel zu helfen, zeigte Wirkung. «Saul fand Erleichterung», aber keine Heilung. Dazu hätte sein Gewissen in Übung kommen, und er hätte Buße tun müssen.
Gleicht er nicht manchen Leuten, die heute in der Bibel Trost suchen und durch manche Ermunterung des Wortes Gottes auch eine momentane Erleichterung erfahren? Aber sie sind nicht bereit, sich ins Licht Gottes zu stellen, sein Urteil über sich zu akzeptieren und an den Erlöser zu glauben. Daher finden sie keinen bleibenden inneren Frieden.
Goliath verhöhnt Israel
Bereits in 1. Samuel 14,52 haben wir gelesen, dass der Kampf gegen die Philister heftig war und während der ganzen Regierungszeit Sauls andauerte. So kam es zu Beginn unseres Kapitels zu einem erneuten militärischen Konflikt, und zwar im Stammesgebiet von Juda. Die zwei Heere standen sich auf zwei benachbarten Bergen gegenüber. Dazwischen lag das Tal.
Dieses Mal sollte die Entscheidung nicht in einer Schlacht der beiden Heere fallen, sondern in einem Zweikampf. Die Philister stellten den Riesen Goliath als ihren Mann. Nun sollten die Israeliten auch einen bestimmen, der den Zweikampf mit Goliath aufnahm. Der Ausgang des Kampfes sollte über das Los der beiden Völker entscheiden. Die Verhöhnung der Soldaten Sauls zeigt, wie siegessicher Goliath sich fühlte. Es ist offensichtlich, dass weder Saul noch irgendeiner seiner Soldaten es mit diesem Riesen aufnehmen konnten. Die Hilfe musste von Gottes Seite kommen, der durch die Verhöhnung des Heeres Israels ebenfalls verhöhnt wurde, denn es ging um sein Volk.
Beim Lesen der Beschreibung Goliaths und seiner Bewaffnung denken wir an die Macht Satans. Er ist der Widersacher Gottes und der Feind der Menschen. Seitdem Adam und Eva auf seine Verführung gehört haben und in Sünde gefallen sind, übt Satan seine Macht über die Menschen aus. Durch die Macht des Todes hält er sie in Furcht und Knechtschaft (Vers 11; Hebräer 2,14.15).
David kommt ins Heerlager
Durch den Ausbruch des Krieges wurde der Lautenspieler des Königs nicht mehr am Hof gebraucht. So kehrte David nach Hause zurück und hütete aufs Neue die Schafe seines Vaters. Seine drei ältesten Brüder aber waren mit Saul in den Kampf gezogen. Sie erlebten Tag für Tag die Verhöhnung durch Goliath. Wie sehr musste die Moral der Truppe darunter gelitten haben.
Nun sandte Isai seinen jüngsten Sohn ins Terebinthental, um Nachricht von seinen Söhnen zu bekommen. Wir werden unwillkürlich an den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, erinnert, der vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen war (Johannes 16,28).
David war ein Hirte, dem die Herde am Herzen lag. Es wird ausdrücklich gesagt, dass er sie einem Hüter überliess. Als er zum Heerlager kam, wurde der junge, gottesfürchtige Hirte Zeuge eines Auftritts von Goliath. Was er zu hören bekam, rief seinen Unwillen hervor. Entrüstet fragte er: «Wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt?» Die Belohnung, die König Saul dem versprach, der es mit Goliath aufnehmen würde, beeindruckte ihn nicht. Und von seinem ältesten Bruder liess er sich nicht einschüchtern. Es ging ihm nur um die Ehre Gottes, die derart in den Schmutz gezogen wurde. Darum konnte er nicht schweigen.
David ist hier ein schwaches Vorausbild auf den Herrn Jesus, der in Psalm 69,10 prophetisch zu Gott sagte: «Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.»
David will gegen Goliath kämpfen
Die mutigen Worte Davids kamen auch Saul zu Ohren. So musste der junge Mann vor den König kommen, der ihn vermutlich nicht mehr erkannte. Mutig und voll Gottvertrauen sagte David: «Dein Knecht will gehen und mit diesem Philister kämpfen.» Die menschlich weise Antwort Sauls vermochte David nicht abzuhalten, denn «das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen» (1. Korinther 1,25). Er berichtete von früher gemachten Erfahrungen mit seinem Gott und vertraute, dass Er ihm auch jetzt helfen und ihn aus der Hand Goliaths erretten werde.
Nun war der König bereit, ihn in den Kampf ziehen zu lassen. Aber wenigstens seine eigene Rüstung wollte er ihm mitgeben. Doch David zog sie wieder aus. Er sagte: «Ich kann nicht darin gehen, denn ich habe es nie versucht.» Seine Waffe bestand aus fünf glatten Steinen und seiner Schleuder.
Wir finden in diesen Versen drei Arten von Waffenrüstungen. Die erste ist die Ausrüstung Goliaths. Sie ist ein Bild von der Macht Satans. Die zweite Waffenrüstung ist die von Saul. Sie symbolisiert die Bemühungen der alten Natur. Alles, was wir aus eigener Kraft und Weisheit tun wollen, gehört zu dieser Waffenrüstung.
Die Bewaffnung Davids schliesslich spricht von den Hilfsquellen des Glaubens. Dazu gehört das geschriebene Wort Gottes, das in Epheser 6,17 als das Schwert des Geistes bezeichnet wird. Es ist das einzige, mit dem wir Satan siegreich widerstehen können (Jakobus 4,7; 1. Petrus 5,9).
David geht dem Riesen entgegen
Nun gingen die zwei ungleichen Kämpfer aufeinander zu. Goliath hatte noch den Schildträger bei sich. Und David? Er trat dem Riesen auch nicht allein, sondern mit Gott entgegen (1. Samuel 17,37.45). Der Philister hatte nur tiefe Verachtung und Flüche für den jungen Mann übrig. David aber schwieg zunächst. Doch dann gab er eine Antwort, die von Gottvertrauen zeugte.
Die Worte der beiden Gegner offenbaren ihren Herzenszustand. Während der eine nur Spott und Verachtung äusserte und sich sogar beleidigt zeigte, dass David ihm in dieser Aufmachung entgegentrat, liess sich der andere weder vom Riesen und seiner Bewaffnung noch von seinen Worten beeindrucken. Wir bewundern die Ruhe und Zuversicht, die David ausstrahlte. Sie waren das Ergebnis einer bewusst gelebten Gemeinschaft mit seinem Gott. Als Folge davon war er überzeugt, dass Gott ihm an diesem Tag den Sieg schenken würde.
In Vers 45 spricht David als Vertreter des einzig wahren Gottes. Er handelte sozusagen in seinem Auftrag und kämpfte für die Ehre des Herrn. Darum suchte er nichts für sich. Die Ehre gehörte nur Gott: «Die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat …, denn des Herrn ist der Kampf.»
Nun zeigte sich, wie wahr die Worte der Knechte Sauls waren: «Er ist ein tapferer Held und ein Kriegsmann» (1. Samuel 16,18). Aber David focht nicht für sich, sondern er «kämpfte die Kriege des Herrn» (1. Samuel 25,28).
David besiegt Goliath
Wie sich die beiden Gegner näher kamen, liess David dem Philister gar keine Zeit, die Initiative zu ergreifen. Er eilte dem Riesen entgegen, lud einen Stein in die Schleuder und schleuderte mit hoher Treffsicherheit. Der Stein traf den Philister an seiner Stirn, und zwar derart hart, dass er in seine Stirn drang.
In Vers 50 lesen wir Gottes Kommentar über diesen kurzen, aber entscheidenden Kampf: «So war David mit der Schleuder und mit dem Stein stärker als der Philister, und er schlug den Philister und tötete ihn.» – Die endgültige Niederlage Goliaths besiegelte David damit, dass er ihn mit dessen eigenem Schwert enthauptete. Darin weist er auf einen Grösseren hin – auf unseren Erlöser, von dem es in Hebräer 2,14 heisst, dass «er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel». Diesen Sieg errang unser Heiland am Kreuz.
Nun flohen die Philister, was ein Bild der Niederlage der Welt ist. Unser Herr hat am Kreuz nicht nur den Tod und den Teufel besiegt, sondern auch die Welt überwunden. – Interessant ist die Erwähnung von Jerusalem in Vers 54, das damals noch gar nicht Hauptstadt von Israel war. Das wurde diese Stadt erst unter König David (2. Samuel 5,6-9).
Weder König Saul noch sein Oberbefehlshaber Abner kannten David. Er musste sich als Lautenspieler am Hof sehr diskret verhalten haben. Zudem hatten diese Führer in Israel keine wirkliche Beziehung zum Sieger. Es gab auch nie eine. Weder Saul noch Abner teilten den Glauben Davids.
Buchtipp: David und sein Leben im Glauben
Jonathan liebt und verehrt David
Während Saul und Abner durch ihre Unwissenheit zeigten, dass sie keine Beziehung zu David hatten – ihnen fehlte sein Glaube –, verband sich die Seele des Kronprinzen Jonathan mit der Seele Davids. Zwischen ihnen gab es eine «Verwandtschaft»: So wie David bei der Begegnung mit Goliath Mut und Gottvertrauen bewiesen hat, so hatten Jonathan und sein Waffenträger in 1. Samuel 14 Mut und Gottvertrauen gezeigt, als sie zu zweit die Philister angriffen. Auch ihnen schenkte Gott einen Sieg.
Jonathan bewies David seine Freundesliebe, indem er ihm sein Oberkleid, seinen Waffenrock, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. So dürfen wir als Glaubende unserem Erlöser und Herrn alles, was wir haben und sind, zur Verfügung stellen und Ihm damit ein wenig unsere Liebe und Dankbarkeit zeigen. Durch sein Verhalten gewann David auch die Anerkennung der Knechte Sauls. Später heisst es sogar: «Ganz Israel und Juda hatten David lieb» (Vers 16).
Und die Reaktion Sauls? Die Frauen empfingen die zurückkehrenden Sieger singend mit den Worten: «Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende.» Darüber ergrimmte der König sehr, obwohl die Aussage stimmte. Neid machte sich im Herzen Sauls breit, der später zu tödlichem Hass wurde (Vers 11). Der Mann, den er in Vers 2 bei sich behalten wollte und in Vers 5 beförderte, wurde plötzlich zu seinem Gegenspieler. Erinnerte er sich vielleicht an die Worte Samuels in 1. Samuel 15,28? War David dieser Nächste, der besser war als er?
Saul wirft den Speer gegen David
Durch den Neid, den Saul in seinem Herzen aufkommen liess, öffnete er sich dem bösen Geist von Gott erst recht. So verwundert es uns nicht, dass er am Tag nach der triumphalen Rückkehr eine ganz schlimme Zeit hatte. Anstatt dass das Lautenspiel Davids ihm Erleichterung brachte, wuchs der innere Widerstand gegen ihn, sodass er in seinem Hass den Speer nach ihm warf. Zweimal konnte David dem Tod ausweichen. Er durfte erfahren, dass der Herr auch jetzt mit ihm war.
Von Saul aber heisst es, dass er sich vor David fürchtete und sich vor ihm scheute. Er merkte, dass er es mit dem, zu dem der Herr sich offenkundig bekannte, nicht aufnehmen konnte. Also entfernte er ihn aus seiner Gegenwart. Er gab ihm einen Posten in der Armee. Das war der Beginn der Verfolgung Davids durch Saul. Wie viel Schweres lag noch vor dem Mann, der Goliath besiegt und den Gott zum König über sein Volk bestimmt hatte!
Ging es unserem Herrn anders? In seinem ganzen Leben hat Er den Widerspruch vonseiten der Sünder erduldet, der darin endete, dass man Ihn kreuzigte. Aber gerade am Kreuz hat unser Heiland einen Sieg errungen, der unvergleichlich grösser und weitreichender ist als der Sieg Davids über Goliath.
Der vom König gehasste und abgeschobene Mann gewann immer mehr das Herz seiner Landsleute. So wurde die Grundlage für seine spätere Annahme als König gelegt (Vers 16; 2. Samuel 5,2).
David heiratet Michal
Saul gab den Gedanken, David endgültig zu beseitigen, nicht auf. Wenn es ihm nicht gelang, seinen Gegenspieler an die Wand zu spiessen, gab es vielleicht die Möglichkeit, dass er im Kampf mit den Feinden Israels fiel. Indem Saul ihm seine Tochter Merab versprach, wollte er David zu diesen lebensgefährlichen Unternehmungen animieren. Doch der Plan Sauls misslang.
Michal, die andere Tochter Sauls, liebte David wirklich. Doch es war nur eine natürliche Liebe, mehr nicht. Im Herzen Michals wohnte leider nicht der Glaube, der das Herz und das Leben Davids bestimmte.
Saul aber benutzte die Liebe zwischen seiner Tochter und David, um einen weiteren Versuch zu machen, diesen Mann durch die Hand der Philister zu töten. David tat mehr, als was Saul verlangte – und blieb am Leben! Nun musste der König sein Wort halten und David seine Tochter Michal zur Frau geben. Es wurde keine glückliche Ehe, obwohl es zweimal heisst, dass Michal David liebte. Michal und David trafen sich nur auf menschlicher Ebene. Weil Michal ungläubig blieb, gab es geistlich keine Beziehung zwischen den beiden (2. Samuel 6,16.20-23).
Nun war der Bruch zwischen Saul und David besiegelt. «Saul war Davids Feind alle Tage.» Aber der Herr bekannte sich zu dem vom König Gehassten und Verachteten. Er gab ihm besonderes Gelingen in seinen militärischen Aktionen. «David hatte mehr Gelingen als alle Knechte Sauls, und sein Name wurde sehr geachtet.»
Saul will David töten
Nun informiert Saul die Menschen, die ihm am nächsten stehen, über seinen Plan, David zu töten. Er macht seinen Hass gegen den Sohn Isais publik. Aber diese Verschärfung der Lage Davids bringt die Echtheit der Freundschaft Jonathans ans Licht. Er erweist sich als ein Freund, «der zu aller Zeit liebt und der als Bruder für die Bedrängnis geboren wird» (Sprüche 17,17). Einerseits warnt er seinen Freund und anderseits versucht er, seinen Vater umzustimmen. Wie geht er vor?
Er stellt ihm seine böse Absicht als Sünde vor. Dann spricht er von der Nützlichkeit der Taten Davids und versucht, sein Herz zu erreichen, indem er ihn daran erinnert, wie er sich über diesen Mann und seine Heldentat gefreut hat. Zuletzt appelliert er an das Gewissen seines Vaters.
Wie reagiert Saul? Er hört auf Jonathan und beteuert mit einem Schwur, dass er David nicht töten wolle. Doch wo bleibt die Buße, die Einsicht und das Bekenntnis, dass er David gegenüber falsch gehandelt hat? Sein Gewissen ist wohl berührt, aber an seiner Haltung ändert sich nichts. Das ist die Tragik im Leben Sauls: Es kam bei ihm nie zu einer echten Umkehr.
Wohl bringt Jonathan seinen Freund wieder zu Saul, aber die Lage ist nur äusserlich wieder wie früher. Ohne aufrichtige Buße bleibt die Wurzel des Hasses gegen David im Herzen Sauls bestehen – um früher oder später wieder hervorzubrechen.
David muss fliehen
Wie lange diese äusserlich entspannte Lage gedauert hat, wissen wir nicht. Doch es kam der Moment, da der böse Geist vom Herrn erneut über Saul kam. David versuchte ihm durch das Lautenspiel Linderung zu verschaffen. Doch Saul warf erneut den Speer gegen David, der nur durch eine schnelle Reaktion der todbringenden Waffe ausweichen und dann fliehen konnte.
Wir denken an unseren Herrn, der oft Hass für seine Liebe erntete (Psalm 109,4.5). Denken wir nur an das, was Er in der Synagoge von Nazareth erlebte! Obwohl die Menschen sich über seine Worte der Gnade verwunderten, wurden sie so wütend auf Ihn, dass sie Ihn umbringen wollten (Lukas 4,22.28.29).
Michal, die Frau Davids, erkannte den Ernst der Lage und riet ihm, sofort zu fliehen. Ein menschlich weiser Rat, der sicher ihrer natürlichen Liebe zu David entsprang! Aber als ungläubige Frau wusste sie nichts von Gottvertrauen. Aus der Erzählung, wie sie ihren Mann vor dem Zugriff ihres Vaters geschützt hat – durch eine raffinierte List, verbunden mit Lüge –, erfahren wir, dass sie sogar einen Hausgötzen besass. Wie traurig: Im Haus des gottesfürchtigen David gab es einen Teraphim!
Als Michal von ihrem Vater zur Rede gestellt wurde, redete sie sich mit einer Notlüge heraus. Aber denken wir daran: In den Augen Gottes ist auch eine sogenannte Notlüge eine Lüge und damit eine Sünde, die Er verabscheut.
David bei Samuel
Wohin sollte David fliehen? Er suchte den Propheten Samuel auf. Ein junger gläubiger Mann, der in Not war, suchte den Rat und die Hilfe eines alten, erfahrenen Mannes Gottes! Welch ein nachahmenswertes Beispiel! Für eine Zeit konnte der Flüchtling bei Samuel bleiben.
Sobald jedoch Saul erfuhr, wo David sich aufhielt, versuchte er, ihn zu verhaften. Dazu schickte er Boten – vermutlich Soldaten – nach Najot bei Rama. Es scheint, dass David und Samuel nichts von den bösen Plänen Sauls wussten. Sie befanden sich also in einer lebensgefährlichen Lage.
Nun zeigte sich, was für einen wunderbaren Gott die Seinen haben. Er ist der Allmächtige, dem alles zu Gebote steht. Nie kommt Er in Verlegenheit. In diesem Fall benutzte Er die Macht seines Geistes, um seinen Knecht David vor dem Zugriff Sauls zu schützen.
Sobald die Abgesandten Sauls in die Nähe der Versammlung der Propheten in Najot kamen, wurden sie so vom Heiligen Geist erfasst, dass sie weissagen mussten und den Auftrag des Königs nicht ausführen konnten. Saul machte drei Versuche, um David habhaft zu werden. Alle misslangen. Schliesslich macht er sich selbst auf den Weg, um die Sache persönlich in die Hand zu nehmen. Doch auch er musste sich der Macht des Geistes beugen. Diese zeitweilige Beherrschung durch den Geist änderte das Herz Sauls aber nicht. Er blieb der gottlose Mann, wie die Menschen ihn kannten (vergleiche Vers 24 mit 1. Samuel 10,12).
David und Jonathan treffen sich
Durch das mächtige Eingreifen Gottes zum Schutz von David bekam dieser die Möglichkeit, von Najot zu fliehen und so der Verhaftung durch Saul zu entgehen. In seiner Not und Bedrängnis suchte er Jonathan, seinen Freund, aufs Neue auf. Aus dem Gespräch, das die beiden miteinander hatten, erkennt man, dass David einen wesentlich klareren Blick für den Ernst der Lage hatte als Jonathan. Die enge Verbindung zu seinem ungläubigen Vater trübte sein Unterscheidungsvermögen. Auch unser geistliches Urteilsvermögen wird in dem Mass getrübt werden, wie wir uns unnötigerweise mit der Welt verbinden.
Die Worte Davids zeigen, wie gross die Angst seines Herzens war. Er sah tatsächlich den Tod vor sich. Aber die Angst ist kein guter Ratgeber. Sie vertuscht die Wahrheit mit einer Notlüge (Vers 6). Sie fängt an, die Liebe des Freundes in Frage zu stellen (Vers 8). Sie sorgt sich darüber, wie sie die nötigen Nachrichten erhalten kann (Vers 10).
Auch wenn David als ein Verfolgter ein Vorausbild auf unseren Herrn ist, der von den Führern der Juden gehasst und verfolgt wurde, so ist dieses Bild doch mangelhaft. Nie hat unser Herr sich durch eine Unwahrheit aus einer gefährlichen Situation herausgeredet. Als man Ihn fragte: «Wer bist du?», antwortete Er: «Durchaus das, was ich auch zu euch rede.» Seine Worte stellten Ihn als Den dar, der Er war: die Wahrheit. Und in Psalm 17,3 sagt Er prophetisch: «Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund.»
Jonathan will David helfen
Um vor irgendwelchen ungebetenen Lauschern geschützt zu sein, setzten die beiden Freunde ihr Gespräch auf dem Feld draussen fort. Es scheint, dass nun auch Jonathan wusste, wie ernst die Sache stand.
In einer gewissen Vorahnung dessen, was über Saul und seine Familie kommen würde, schloss Jonathan einen neuen Bund mit David. Gegenüber dem ersten (1. Samuel 18,3) ging dieser weiter und umfasste auch die Nachkommen der beiden Freunde. Die spätere Geschichte zeigt, dass David sich an diesen Bund gehalten hat. Wie viel Güte und Gnade erwies er später Mephiboseth, dem körperlich behinderten Sohn Jonathans! Er bekam einen festen Platz an der königlichen Tafel (2. Samuel 9).
Die Freundesliebe zwischen Jonathan und David war tief. Aber Jonathan erkannte nie, dass mehr nötig gewesen wäre, als seine Liebe zu beteuern. Er hätte die Verwerfung und das Leben als Flüchtling mit David teilen sollen. Doch er blieb bei seinem Vater und kam schliesslich mit ihm ums Leben (1. Samuel 31,2.6).
Nach dem Gespräch schlug Jonathan seinem Freund ein Zeichen vor, mit dem er ihn, der sich versteckt halten sollte, über die Lage am Hof benachrichtigen konnte. Das Schiessen der Pfeile zu Übungszwecken konnte keinen Verdacht erregen. Niemand würde dahinter etwas Besonderes vermuten.
Wie die Lage auch ausgehen würde, sie wollten sich an die Abmachungen halten. Das war ihr Ernst vor Gott, der alles beurteilt.
Jonathan setzt sich für David ein
Das Bankett am Königshof anlässlich des Neumondes fand ohne David statt. Als sein Platz leer blieb, dachte Saul: «Er ist nicht rein.» Aber waren sein Herz und seine Gedanken rein? Die Haltung Sauls lässt uns an die Juden denken, die den Tod von Jesus forderten und damit sein Blut auf sich nehmen wollten, aber nicht ins Prätorium hineingingen, um sich nicht zu verunreinigen (Johannes 18,28). Welch eine Heuchelei!
Als David am zweiten Tag immer noch nicht erschien, fragte Saul seinen Sohn Jonathan über den Verbleib des Sohnes Isais. Auf die Antwort Jonathans reagierte Saul mit schrecklichen Schimpfwörtern gegen ihn und seine Mutter. Schliesslich warf er den Speer nach ihm, wie er ihn wiederholt gegen David geschleudert hatte.
Jonathan übernahm die Verantwortung für seinen Freund und versuchte, seinen Vater vom geplanten Mord abzuhalten, indem er fragte: «Warum soll er getötet werden? Was hat er getan?» Er musste einsehen, dass sein Bemühen nichts nützte. Zutiefst verletzt – nicht persönlich, sondern wegen den Schmähworten seines Vaters über seinen Freund – stand er auf und verliess die königliche Tafel. Die Haltung Jonathans erinnert an Nikodemus und Joseph von Arimathia, die sich gegenüber den Feinden des Herrn für Ihn einsetzten – auch ohne Erfolg (Johannes 7,50; Lukas 23,51).
So wie Saul den Speer sowohl gegen David als auch gegen Jonathan warf, so richtet sich der Hass Satans und der Welt sowohl gegen Christus als auch gegen die Christen (Johannes 15,18-20).
David nimmt Abschied von Jonathan
Am nächsten Morgen ging Jonathan aufs Feld hinaus, um mit dem verabredeten Zeichen David über den Stand der Dinge zu informieren. Entsprechend der Abmachung schoss er den Pfeil über den Knaben hinaus. Als David Jonathan sagen hörte: «Der Pfeil ist ja jenseits von dir!», wusste er, dass sein Schicksal vonseiten Sauls besiegelt war.
Nachdem Jonathan den Knaben mit den Waffen in die Stadt zurückgesandt hatte, konnten sich die Freunde ungestört treffen und aussprechen. Die Trauer war gross. Wir verstehen die übermässige Not Davids. Wie würde sein Leben nach der eindeutigen Todesdrohung des Königs weiter verlaufen?
Interessanterweise bat David seinen Freund nicht, mit ihm zu gehen. Das Neue Testament lehrt uns, dass Jüngerschaft und Nachfolge des Herrn Jesus nichts Erzwungenes sind (Lukas 9,57-62). Der Herr Jesus wünscht, dass wir Ihm nachfolgen, aber Er zwingt uns nicht dazu. Jonathan zeigt gewisse Ähnlichkeit mit dem reichen Jüngling, der den Herrn Jesus betrübt verliess, weil er nicht bereit war, Ihm kompromisslos nachzufolgen (Markus 10,21.22).
David beim Priester Ahimelech
Als David ins Unbekannte fortzog, kehrte Jonathan in die Stadt zurück. Ihm fehlte die Glaubenskraft, um sein Leben mit dem Verworfenen zu teilen. Oder dachte er, auf dem Weg des Kompromisses zum Ziel zu kommen: dass David König würde und er der Zweite nach ihm sein konnte? (1. Samuel 23,17).
Nun musste David lernen, als mittelloser Flüchtling zu leben. Das war kein einfacher Weg. Der Erste, bei dem er Hilfe suchte, war der Priester Ahimelech. Um seine Lage nicht zu verraten, nahm er es wieder nicht genau mit der Wahrheit. Wir wollen David nicht verurteilen, denn wohl keiner von uns befindet sich in einer derart gefährlichen Lage. Doch wir wollen aus dieser göttlichen Mitteilung lernen, es mit der Wahrheit genau zu nehmen und wirklich in die Fussstapfen unseres Herrn zu treten, in dessen Mund kein Trug gefunden wurde (1. Petrus 2,21-23).
Der Priester gab David schliesslich die Schaubrote, die eigentlich für die Priester bestimmt waren, und das Schwert Goliaths. Sowohl das Brot als auch das Schwert sind ein Bild des Wortes Gottes. Nun war David für den Augenblick gut versorgt.
Als der Herr Jesus als Mensch hier lebte und von den Führern der Juden immer wieder angegriffen wurde, zitierte er einmal diese Begebenheit aus dem Leben Davids (Lukas 6,1-5). Er zeigte damit seinen Gegnern, wie paradox es war, die Sabbatgebote (und andere) peinlich genau einzuhalten und gleichzeitig den Herrn des Sabbats, den Gesetzgeber, zu verwerfen. Die Zeit Jesu in den Evangelien glich der Lage, in der sich David damals befand: Der König nach den Gedanken Gottes wurde nicht anerkannt, sondern mit tödlichem Hass verfolgt.
David bei Achis in Gat
Am Schluss des gestrigen Abschnitts haben wir gelesen, dass der nächste Ort, wohin David vor Saul floh, das Land der Philister war. Er kam zu Achis, dem König von Gat. Das war keine Glaubenstat, sondern eine Reaktion seines Kleinglaubens. Die Flucht in das Land der Feinde brachte ihn in grosse innere und äussere Nöte.
David hoffte, wie später Petrus, von der Welt unentdeckt zu bleiben. Es gelang beiden nicht. Als die Philister David erkannten, erinnerten sie sich sofort an seinen Sieg über Goliath. Nun war er auch in Gat seines Lebens nicht mehr sicher. Aus Angst vor dem Tod verstellte er seinen Verstand und benahm sich wie ein Wahnsinniger. Und Petrus? Um sein Leben zu retten, verleugnete er seinen Herrn und Meister (Johannes 18,15-18).
Was für Ängste und Nöte David in jener Zeit durchmachte, beschreibt er in den Psalmen 34 und 56, die er damals gedichtet hat. Vor allem Psalm 34 zeigt zudem, wie David in seiner Notsituation innerlich wieder zurechtgekommen ist und die Rettung des Herrn erfahren durfte. Er konnte Gat unbeschadet verlassen. Wie gross ist doch die Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn! Er stellte auch seinen Jünger Petrus ganz wieder her. Einem David anvertraute Gott später sein Volk. Er sollte es weiden wie ein Hirt (Psalm 78,70.71). Und dem Apostel Petrus anvertraute der Herr seine Schafe und seine Lämmer (Johannes 21,15-17).
David in der Höhle Adullam
Nach der Rückkehr ins Land Israel durfte David die Ermunterung durch seine Familie erfahren. Alle, auch seine Brüder, die ihm früher unfreundlich begegneten, kamen zu ihm. Sowohl Neid als auch Verachtung waren verschwunden. Durch ihr Kommen zeigte die Familie, dass sie verstand, dass David zu Unrecht von Saul verfolgt wurde. Besorgt um seine vermutlich alten Eltern suchte er in Moab einen sicheren Aufenthaltsort für sie. In der Zukunft wird der treue Überrest ebenfalls in Moab Unterschlupf finden (Vers 3; Jesaja 16,4).
David in der Höhle Adullam ist ein schönes Vorausbild auf unseren Herrn, der, obwohl von seinem Volk verworfen, alle Mühseligen und Beladenen zu sich ruft (Matthäus 11,28). Als wir in Buße und Glauben mit unseren Sünden zum Heiland kamen, glichen wir da nicht denen, die sich damals zu David versammelten? Und gerade einige von diesen Männern wurden zu seinen Helden (z.B. 2. Samuel 23,13-17).
Gad, der Prophet, ist hier der Träger des Wortes und Zeugnisses Gottes. Er weist David an, ins Land Juda zu gehen, und David gehorcht dem Wort von Gott. Dann wird er entdeckt und Saul zeigt durch seine Worte, welch einen völlig unbegründeten Hass er gegen David hegte und wie er glaubte, alle hätten sich gegen ihn verschworen. Nun tritt Doeg, der Edomiter, als feiger Verräter auf. Er hatte sich also nicht mit aufrichtigen Absichten vor dem Herrn zurückgezogen aufgehalten (1. Samuel 21,8). Dieser böse Verdacht veranlasste David, Psalm 52 zu dichten.
Saul rächt sich an den Priestern
Nun wurde der Priester Ahimelech mit seiner ganzen Familie vor den König zitiert. Auf die Vorwürfe Sauls antwortete der Mann, der sich keiner Schuld bewusst war, freimütig. Dabei stellte er David ein gutes Zeugnis aus, verschwieg jedoch die Unwahrheit, die er vorgebracht hatte (1. Samuel 21,3).
Doch die Wut und der Hass Sauls waren so gross, dass er dem Priester Verschwörung unterschob und dafür das Todesurteil über ihn und seine Familie fällte. Wie schrecklich! Sogar die Soldaten des Königs weigerten sich, ein derart ungerechtes Urteil zu vollziehen.
Der Verräter Doeg aber hatte keine Skrupel, 85 Priester zu ermorden und die ganze Stadt der Priester zu schlagen. Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Tiere – alle fielen dem Schwert zum Opfer. Einerseits erfüllte sich damit die göttliche Prophezeiung über die Familie Elis (1. Samuel 2,31-33); aber anderseits war dieser Edomiter für diese Tat hundertprozentig verantwortlich. Gott wird ihn einmal dafür zur Rechenschaft ziehen.
Ein einziger Priester entkam dem Massaker: Abjathar. Wohin floh er? Zu David! Welch ein Trost müssen die Worte Davids für Abjathar gewesen sein! Dabei ist David nur ein schwacher Hinweis auf unseren Herrn, bei dem jeder, der im Vertrauen zu Ihm kommt, für ewig in Sicherheit ist (Johannes 10,28). Jeder Glaubende ist beim Herrn Jesus wirklich wohl bewahrt.
David aber empfand seine Mitschuld am Tod der Priesterfamilie zutiefst.
David rettet Kehila
Es muss in Israel manche gegeben haben, die in ihrem Herzen David bereits als König anerkannten, denn in Vers 1 heisst es, dass man David und nicht Saul vom Überfall der Philister berichtete. Wie nachahmenswert ist die Abhängigkeit Davids von seinem Gott! Zuerst fragte er den Herrn, ob er in den Kampf ziehen sollte. Als seine Männer Bedenken äusserten, fragte er den Herrn nochmals, um wirklich sicher zu sein, dass er sich auf Gottes Weg befand.
Wenn wir im Blick auf eine Entscheidung nicht ganz sicher sind, dann dürfen wir den Herrn weiter um Klarheit bitten. Es ist wichtig, dass wir als Kinder Gottes den Weg im Leben gehen, den Er uns weist. Der Herr kann nur mit uns sein, wenn wir auf seinem Weg bleiben.
Mit der klaren Zusage des Herrn zog David in den Kampf und besiegte die Philister. Aber was noch wichtiger war, finden wir am Schluss von Vers 5: «So rettete David die Bewohner von Kehila.» Erwies er sich da nicht als wahrer Hirte seines Volkes, der zum Wohl seiner Herde dem Feind, der zerstören und verderben wollte, mutig entgegentrat? (1. Samuel 17,34.35; Psalm 78,70-72).
Die Erwähnung des Ephods, das der Priester Abjathar mitbrachte, weist wohl auf das Ephod des Hohenpriesters mit dem Brustschild hin, in das die Urim und Tummim gelegt wurden (2. Mose 28,30). Diese spielten bei Fragen nach Gottes Willen eine wichtige Rolle (4. Mose 27,21).
David flieht in die Wüste Siph
Nach dem Sieg Davids über die Philister erfährt Saul, dass David in Kehila ist. Er meint, Gott habe ihn verworfen und ihn in seine Hand gegeben. Aber Gott ändert seine Meinung nie. Er steht immer zu dem, was Er einmal gesagt hat. Sein Wort durch Samuel in 1. Samuel 15,26-28 galt immer noch.
Was soll David tun? In aller Unterwürfigkeit fragt er den Herrn, und dieser offenbart ihm die unloyale Haltung der Bewohner von Kehila. So verlassen David und seine Männer die Stadt, bevor Saul sie belagern kann, und suchen auf den Bergfestungen in der Wüste ein neues Versteck. Gott lässt nicht zu, dass David in die Hand Sauls fällt.
Wie anders war es bei unserem Herrn. Als Judas Iskariot Ihn verriet, ging Er seinen Häschern entgegen und liess sich verhaften, obwohl Er die Möglichkeit gehabt hätte, sich zu wehren (Johannes 18,3-6.12; Matthäus 26,53).
Als David realisiert, dass er nirgends vor Saul sicher ist, kommt sein Freund Jonathan zu ihm in den Wald, um ihn zu ermuntern. Wie? Indem er die Hand seines bedrängten Freundes in Gott stärkt. – So dürfen auch wir Mitgläubigen, die in Not sind, eine Hilfe sein, indem wir sie auf den Herrn Jesus hinweisen und ihr Gottvertrauen zu stärken suchen.
So ermunternd diese Begebenheit mit Jonathan für David auch war, so traurig endet sie, und zwar mit den Worten: «Jonathan ging in sein Haus.» Er war nicht bereit, das Los Davids mit ihm zu teilen.
David in der Wüste Maon
Nicht nur die Bewohner von Kehila, auch die Siphiter hielten zu Saul und verrieten David, der sich in ihrem Gebiet aufhielt. Ihre schmeichelnden Worte an Saul erinnern an das Verhalten von Judas Iskariot gegenüber den Führern der Juden (Markus 14,10.11).
Und Saul? Dieser ungläubige, aber religiöse Mann segnet diese Verräter im Namen des Herrn! Sein Herz voller Hass freut sich in der Hoffnung, sein Ziel – den Tod Davids – zu erreichen.
Vermutlich hörte David von der erneuten Nachstellung Sauls erst, als dieser mit seinen Soldaten bereits in der Nähe war. Er versuchte sich in den Felsen zu verstecken. Es scheint, dass für eine Flucht an einen anderen Ort keine Zeit mehr blieb. Nun wurde es ganz kritisch: Als David ängstlich bemüht war, Saul zu entgehen, wurden er und seine Männer von den Soldaten Sauls umzingelt. Jetzt blieb David wirklich nur noch der Ausweg nach oben.
Wir lesen nicht, dass David besonders gebetet hätte, aber frühere Verse zeigen sein Leben mit Gott. Nun griff der Herr selbst ein. Durch die Nachricht von einem erneuten Einfall der Philister musste Saul die Verfolgung Davids für den Moment aufgeben. Der Herr hatte sichtbar eingegriffen, um David zu retten (1. Samuel 23,14.27). Der Name, den man jenem Ort gab, lässt uns an Psalm 124,7 denken: «Unsere Seele ist entkommen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelfänger; die Schlinge ist zerrissen, und wir sind entkommen.»
David verschont den König
Nachdem David durch das gnädige Eingreifen Gottes der Verfolgung durch Saul für den Augenblick entgehen konnte, suchte er sich mit seinen Männern auf den Bergfestungen von En-Gedi zu verstecken. Aber auch dort blieb er nicht verborgen und wurde an Saul verraten. So zog der König, sobald es die Umstände erlaubten, aufs Neue los. Zusammen mit 3000 auserlesenen Männern versuchte er David zu verhaften.
Als er auf dem Weg an einer Höhle vorbeikam, ging er ein Stück weit hinein, um seine Füsse zu bedecken. Ganz hinten in dieser Höhle aber sassen David und seine Männer. Diese betrachteten die Gelegenheit sofort als günstigen Augenblick für David, um sich an seinem Feind zu rächen. Wie sehr wurde da die Gesinnung Davids auf die Probe gestellt! Was für innere Nöte er dabei hatte, aber auch zu welcher Ruhe er in seinem Gott fand, das zeigt uns Psalm 57, den er zu jener Zeit gedichtet hat. So schnitt er dem schlafenden König einfach einen Zipfel des Oberkleides ab. Sogar dies tat er nur mit Herzklopfen. Wie zart reagierte das Gewissen Davids!
Seinen Männern aber wehrte er, Hand an den König zu legen. Solange Gott diesen Mann am Leben liess, war er für ihn der Gesalbte des Herrn, d.h. der regierende König. Auf keinen Fall wollte er Gott vorgreifen und sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Er wusste, dass Gott ihn zum König über sein Volk bestimmt hatte. Doch der Zeitpunkt seines Regierungsantritts lag ganz in Gottes Hand.
David bezeugt seine Unschuld
Kaum war Saul weiter gezogen, da verliess auch David die Höhle. Dann rief er hinter dem König her und versuchte Sauls Herz und Gewissen zu erreichen. Zuerst bewies er ihm, dass er ihn hätte töten können, und erklärte ihm, warum er es nicht getan hatte. Der abgeschnittene Zipfel des königlichen Oberkleides sollte der Beweis dafür sein, dass er nichts Böses gegen den König im Schild führte. Es gab keinen Grund für die Verfolgung Davids durch Saul.
Mit den weiteren Worten legte er die ganze Sache in die Hand Gottes. «Der Herr richte zwischen mir und dir.» In seinem ersten Brief stellt der Apostel Petrus den Herrn Jesus in seinem Leben als Mensch auf dieser Erde als nachahmenswertes Beispiel für uns vor. Dabei schreibt er unter anderem von ihm: «Der, gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet» (1. Petrus 2,23). Darin glich David seinem Herrn.
Mit den Vergleichen in Vers 15 wollte David in aller Demut sagen: Ich bin ja nichts. – Von unserem Heiland heisst es, dass Er sich selbst zu nichts machte (Philipper 2,7). Und von sich sagte Er: «Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig» (Matthäus 11,29).
Zum Schluss legte David noch einmal die ganze Angelegenheit in die Hand Gottes. Hätten diese Worte Saul nicht zu Herz und Gewissen gehen sollen? Wenn Gott die Rechtssache Davids in die Hand nahm, musste Er dann nicht Sauls unbegründeten Hass bestrafen?
Saul zeigt eine oberflächliche Reue
Die ergreifenden Worte Davids liessen die Emotionen Sauls hochgehen. Er weinte und bekannte: «Du bist gerechter als ich.» Die ganze Reaktion Sauls macht den Anschein einer echten Bekehrung: Tränen, Bekenntnis, Selbstgericht, Anerkennung der Gerechtigkeit Davids und ein Ja zu Gottes Aussagen im Blick auf das Königtum. Er wünschte für David sogar das Gute vom Herrn. Doch die weitere Geschichte zeigt, dass es bei Saul nicht zu einer definitiven inneren Umkehr gekommen war. Zu einer solchen gehören die Buße zu Gott und der rettende Glaube (Apostelgeschichte 20,21). Saul fehlte der Glaube, und darum blieb bei ihm auf die Länge gesehen alles beim Alten.
David war weise genug, den schönen Worten Sauls nicht zu vertrauen. Wohl versprach er ihm, dessen Nachkommen nicht auszurotten. Aber er zog es doch vor, auf der Bergfestung zu bleiben, als Saul in sein Haus zurückkehrte.
Was können wir für uns aus dieser Geschichte lernen? Dem Herrn sei Dank, werden wir als gläubige Christen in unseren Ländern äusserlich nicht verfolgt. Aber vergessen wir nicht: Die Welt um uns her hasst den Herrn Jesus. Lassen wir uns von ihrem Schein und ihren schönen Worten nicht betören und verführen. Nur wenn wir uns nahe beim Herrn aufhalten und die Waffenrüstung Gottes tragen (Epheser 6,10-18), sind wir sicher und geschützt.
David bittet Nabal um Nahrung
Der Tod Samuels markiert den Auftakt zur letzten Periode des traurigen Lebens von Saul. Das Volk empfand den grossen Verlust und klagte um Samuel. Ein grosser Prophet und ein Mann der Fürbitte, den Jeremia auf eine Stufe mit Mose stellt (Jeremia 15,1), war verstummt.
Zu jener Zeit hielt sich David in der Wüste Paran vor Saul verborgen. Doch wovon sollten er und die Männer, die bei ihm waren, leben? Nun dachte er an Nabal, dessen Herden sie während längerer Zeit bewacht hatten. Ob dieser reiche Viehzüchter ihnen vielleicht etwas von seinem Überfluss abgab?
Wer war dieser Nabal? Er war ein Kalebiter. Doch er hatte nur die Energie, aber nicht den Glauben seines Vorfahren. Kaleb hatte seine Fähigkeiten in den Dienst Gottes und seines Volkes gestellt, während Nabal seine Energie nur für sich einsetzte. «Der Mann aber war hart und boshaft in seinen Handlungen.» So beschreibt ihn der Geist Gottes.
Aus der harten Antwort an die Abgesandten Davids können wir weiter entnehmen, dass Nabal seinen Reichtum nur sich selbst zuschrieb. Da war kein Gedanke an Gott, von dem doch alles kam. Diese Selbstsucht machte ihn hart, sodass er anderen gegenüber keinerlei Barmherzigkeit zeigte.
Möge dieses abschreckende Beispiel uns anspornen, die Aufforderung aus Lukas 6,36 mehr auszuleben: «Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.»
Abigail reitet David entgegen
Die Reaktion Davids auf die harte Antwort Nabals ist menschlich verständlich. Vielleicht hätten wir ähnlich reagiert. Aber – so müssen wir fragen – ist das der gleiche David, der kurz vorher so grosszügig und barmherzig mit seinem Feind umgegangen war und ihn am Leben gelassen hatte? War eine solche Veränderung im Herzen Davids vorgegangen?
Die Antwort lautet: David hatte als gläubiger Mann nicht nur das neue Leben von Gott in sich, sondern auch noch die alte Natur – eine Tatsache, die von jedem gläubigen Christen ebenso wahr ist. In diesem Moment war es nicht das Gottvertrauen, sondern die alte Natur in David, die sein Handeln bestimmte. Wir wollen uns merken, was das Neue Testament dazu sagt: «Rächt nicht euch selbst, Geliebte», und: «Eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit» (Römer 12,19; Jakobus 1,20).
Als Abigail von der Reaktion ihres Mannes auf die Anfrage Davids hörte, handelte sie sofort. Sie «eilte», um «durch eine Gabe im Verborgenen den Zorn abzuwenden» (Sprüche 21,14). Ohne ihrem Mann etwas zu sagen, machte sie sich mit Lebensmitteln für 600 Mann auf den Weg, David entgegen.
In Vers 20 wird das Zusammentreffen von Abigail mit David erwähnt. Aber in Vers 21 wird nochmals die innere Einstellung Davids beschrieben, um zu zeigen, dass Abigail einem fest entschlossenen Mann begegnete. Nun musste sie mit Weisheit handeln, die sie nur vom Herrn bekommen konnte, um das Unglück noch abzuwenden.
Abigail hält David von der Rache ab
Der Geist Gottes berichtet ausführlich über das Verhalten und die Worte Abigails, als sie David begegnete. Er zeigt uns damit, was für eine gottesfürchtige und weise Frau sie war.
Ihre Haltung und ihre Worte bewiesen ihre Demut (1. Samuel 25,23.24). Sie wusste, was für ein Mensch ihr Ehemann Nabal war. Sie beschönigte nichts von seinem Verhalten. Und welche Weisheit offenbarte sie, indem sie die Schuld auf sich nahm, ohne sich zu rechtfertigen (1. Samuel 25,24.28). Sie anerkannte David als Herrn, der die Kriege des Herrn kämpfte. 13-mal nennt sie ihn in diesen Versen «Herr». Aber sie glaubte auch an seine zukünftige Stellung als Fürst über Israel. Trotzdem hiess sie das Böse, das er vorhatte, nicht gut. Mit Worten, die Davids Gedanken auf den Herrn lenken mussten, sprach sie das geplante Blutvergiessen an (1. Samuel 25,26.31). Sie sagte sogar: «Der Herr hat dich verhindert, in Blutschuld zu kommen.» Aber sie war das Werkzeug in der Hand Gottes.
Die Worte Abigails erreichten das Herz und das Gewissen Davids. Er sah ein, dass er auf einem verkehrten Weg war und im Begriff stand, fleischlich zu handeln. Er dankte dem Herrn, dass Er ihn durch diese weise Frau vor einer grossen Sünde bewahrt hatte.
Der Frieden, den er früher Nabal und seinem Haus gewünscht hatte (Vers 6), der aber mit bösen Worten zurückgewiesen worden war, kam auf Abigail. Wie sehr hatte sie diesen Frieden nötig für ihr schweres Leben mit einem Mann, wie Nabal einer war!
Nabal stirbt, Abigail wird Davids Frau
Abigail verhielt sich auch ihrem Mann gegenüber weise. Als sie zurückkam, hielt dieser ein Festmahl wie ein Königsmahl, wobei er dem Alkohol übermässig zusprach. Den gesalbten, aber verworfenen König hatte er abgewiesen. Selbst aber wollte er wie ein König leben.
Erst als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, berichtete ihm seine Frau, welche Gefahr ihm gedroht hatte. Welch ein Schock für Nabal! Einen ähnlichen Schock hatte König Belsazar, als während eines ausgelassenen Festes eine Hand erschien und das Urteil Gottes über ihn an die Wand schrieb (Daniel 5,5.6). In beiden Fällen folgte kurz darauf der Tod. Wie gut, dass David verhindert worden war, Gott vorzugreifen! Nun konnte er den Herrn dafür preisen, dass Er seinen Rechtsstreit geführt hatte.
Als David nach dem Tod Nabals um Abigail warb und sie seine Frau wurde, kommen weitere schöne Charakterzüge dieser Frau zum Vorschein. Die reiche Gutsherrin war bereit, den Platz einer Dienerin einzunehmen. Welch eine Demut! Zudem erwähnt das Wort, dass sie sich schnell aufmachte, um zu David zu kommen und seine Frau zu werden. Sie wartete nicht, bis David offiziell König wurde, um seine Frau zu werden. Sie war bereit, sein Leben als Verfolgter mit ihm zu teilen.
Abigail ist ein schönes Bild der Glaubenden in der jetzigen Zeitperiode, die zusammen die Versammlung Gottes bilden. Wir Glaubende bekennen uns zum Herrn Jesus, der heute noch verworfen ist. Doch wir werden dereinst seine Herrlichkeit mit Ihm teilen.
David verschont Saul zum zweiten Mal
Schon einmal hatten die Siphiter David an Saul verraten (1. Samuel 23,19). Nun tun sie es ein zweites Mal. Entgegen aller schönen Worte, die der König gegenüber David geäussert hatte, zog er erneut mit einer Spezialeinheit von 3000 Mann in die Wüste Siph, um David zu suchen und wenn möglich zu verhaften.
Als David sicher war, dass Saul ihm aufs Neue nachstellte, ergriff er die Initiative und schlich in die Nähe Sauls und seiner Soldaten. Dann suchte er einen mutigen Gefährten, der mit ihm ins Lager Sauls eindringen wollte. Abisai, sein Neffe, war bereit, ihm zu folgen. Welch eine Kühnheit des Glaubens zeigte sich bei diesen zwei Männern! – Wer heute dem Herrn Jesus in allen Umständen treu nachfolgen will, braucht auch einen kühnen Glauben. Doch Gott will ihn jedem entschiedenen Jünger des Herrn Jesus schenken.
Ohne entdeckt zu werden, gelangten die zwei mutigen Männer bis zu Saul, der, umgeben von seinen Soldaten, in der Wagenburg schlief. Abisai hätte den König am liebsten auf der Stelle getötet. Er meinte, es sei die Gelegenheit für David. Aber dieser antwortete in Gnade: «Töte ihn nicht!» Aufgrund der Erfahrung, die er soeben mit Nabal gemacht hatte, konnte er Saul dem Herrn überlassen. Er würde ihn zu seiner Zeit schlagen. Aber als Beweis seiner eigenen Unschuld nahm er den Speer und den Wasserkrug Sauls mit.
Zum Schutz von David und Abisai hatte Gott selbst einen tiefen Schlaf auf Saul und sein Heer fallen lassen. So antwortete Er auf die Kühnheit des Glaubens.
David spricht zum letzten Mal mit Saul
Nachdem David genügend Abstand zwischen sich und Saul mit seinen Soldaten hat, ruft er Abner, dem Heerführer Sauls, zu und wirft ihm vor, den König nicht genügend geschützt zu haben. Abner weiss nicht, wer so ruft, aber Saul erkennt die Stimme Davids.
Nun wendet sich der Verfolgte erneut an das Herz und Gewissen von Saul. Es gab überhaupt keinen Grund für den Hass Sauls. David zeigt seinem Feind, welche Folge die ständige Verfolgung hat: Er wird aus dem Erbteil des Herrn vertrieben. Wohin? Zu Menschen, die Götzen dienen. Oder er sieht den Tod vor sich. Doch auch im Tod möchte er nicht von Gott getrennt sein. So spricht der Glaube. Aber wie stark ist dieser nach der langen Zeit der Verfolgung noch? Die Antwort gibt uns 1. Samuel 27,1.
Ein weiteres Mal bekennt Saul: «Ich habe gesündigt», ohne der Buße würdige Frucht zu zeigen. Es bleibt bei einem leeren Bekenntnis und mündlichen Beteuerungen. Doch David traut der Sache nicht. Er lässt den Speer und den Krug holen und übergibt die Sache dem Herrn. Dieser wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten.
David hat an jenem Tag das Leben Sauls geschont. Für sein eigenes Leben stützte er sich nicht auf die Aussagen Sauls, sondern auf den Herrn. «Er möge mich erretten aus aller Bedrängnis» (vergleiche Psalm 62,2.6). Wie wertlos ist die Segnung Sauls in Vers 25! Früher hatte er mit ähnlichen Worten jene gesegnet, die David verrieten (1. Samuel 23,21)!
David flieht zu den Philistern
Die dauernde Verfolgung und die ständigen Gefahren machten David schliesslich mutlos. Unglaube erfüllte sein Herz, sodass er den Entschluss fasste, zu den Philistern zu fliehen. Wie schade! Ist David nicht ein Bild von uns? Wie leicht ermatten wir, wenn eine Prüfung lang andauert oder eine Situation ausweglos scheint! Doch wir erleiden einen grossen Verlust, wenn wir Gott aus der Schule laufen. Das lernen wir aus der Geschichte Davids. Wir wollen sie zu Herzen nehmen!
Nun gab Saul die Verfolgung Davids auf (Vers 4). Doch die Zeit, die David in Feindesland zubrachte, war für Gott verloren. Wie hätte er auf einem solchen Weg Gemeinschaft mit dem Herrn haben können? Das war unmöglich.
Um sich mit den Philistern zu arrangieren und damit kein Verdacht auf ihn fiel, musste er zu Lügen und Unehrlichkeit greifen. Der zweite Teil von Vers 11 illustriert uns die Vorsicht des Fleisches. Aber in Jeremia 17,5 heisst es: «Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von dem Herrn weicht!» Wie ernst!
Durch sein unehrliches Verhalten betrachteten ihn die Philister als Verräter seines eigenen Volkes. Achis meinte sogar, er hätte David zum Knecht für immer – anstatt dass David der Knecht des Herrn gewesen wäre.
Für uns wollen wir den wichtigen Schluss ziehen: Auf einem Weg der Kompromisse mit der Welt kann der Gläubige weder ein Zeuge für den Herrn sein noch einen Dienst für Gott tun – eine verlorene Zeit!
Saul fürchtet sich vor den Philistern
Ein neuer Krieg bahnt sich zwischen den Philistern und Israel an. David steht auf der Seite der Feinde des Volkes Gottes und wird mit in den Konflikt hineingezogen. Daran hat er wohl nicht gedacht, als er vor Saul zu den Philistern floh. Er gibt Achis eine doppelsinnige Antwort, die dieser als Zusage versteht. Daraufhin befördert er David zum Kommandanten seiner Leibgarde. War er für eine solche Aufgabe gesalbt worden?
Davids Erfahrungen zeigen uns, wohin wir kommen können, wenn wir uns als Glaubende mit der Welt verbinden, anstatt uns von ihr zu trennen.
In Vers 3 wechselt die göttliche Berichterstattung den Schauplatz. Wir erfahren nun, wie es Saul in dieser neuen Bedrohung durch die Philister erging. Zunächst wird an den Tod Samuels und an die Trauer Israels über diesen Verlust erinnert. Wie nötig hätte das Volk den Propheten und seine Fürbitte jetzt gehabt! Weiter wird erwähnt, dass Saul alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land entfernt hatte. Damit hatte er eine Anweisung des Gesetzes ausgeführt (5. Mose 18,10-14). Aber dieses richtige Verhalten stellte kein Gegengewicht zu seinem Ungehorsam gegenüber Gott dar. Die Klammer von Vers 3 ist eigentlich die Einleitung zu dem, was nun folgt.
Als Erstes versucht ein angstvoller, zitternder Saul den Herrn um Rat zu fragen. Doch Gott antwortet ihm nicht mehr. Er war von dem ungehorsamen König gewichen, weil dieser wie einst Esau «keinen Raum zur Buße» gefunden hatte (Hebräer 12,17), obwohl er mehrmals die Möglichkeit dazu gehabt hatte.
Saul sucht eine Wahrsagerin auf
Als Saul merkte, dass Gott ihm auf keine Weise mehr antwortete, wandte er sich an den Teufel und begab sich in den Bereich der Mächte der Finsternis. Durch seine Verkleidung konnte er die Wahrsagerin täuschen. Und durch einen Schwur, bei dem er den Namen des Herrn missbrauchte, konnte er sie dazu bewegen, ihm zu Diensten zu sein. Aber Gott konnte er nicht täuschen.
Bis jetzt hatte diese Frau Kontakt zur Dämonenwelt. Auf ihren Wunsch und den ihrer Kunden verstellte sich der gerufene Dämon jeweils und nahm die Gestalt der gewünschten, bereits gestorbenen Person an. Aber dieses Mal war es anders. Nicht der Dämon in Gestalt von Samuel kam, sondern Samuel selbst. Das war durch den Herrn bewirkt worden, der allein die Schlüssel des Todes und des Hades hat (Offenbarung 1,18). Nun kam der Betrug Sauls ans Licht.
Aus dem Mund Samuels musste Saul noch einmal Gottes Urteil vernehmen und den Grund, warum Gott so mit ihm handelte. Schliesslich sagte ihm Samuel, wie die Schlacht mit den Philistern ausgehen würde und dass er und seine Söhne am nächsten Tag fallen würden.
Da im Alten Testament noch nicht offenbart war, dass es im Totenreich zwei Orte gibt, sagte Samuel: «Morgen wirst du bei mir sein», d.h. im Totenreich. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass der Geist und die Seele derer, die im Glauben sterben, im Paradies sind, während die im Unglauben Gestorbenen am Ort der Qual sind (Lukas 16,19-31; 23,43).
Saul isst und geht nachts davon
Was Saul zu hören bekam, warf ihn zu Boden. Nun war keine Kraft mehr in ihm. Unwillkürlich denken wir an einen anderen Saul, den Gott auch zu Boden geworfen hatte: Saulus von Tarsus. Aber wie gewaltig gross ist der Unterschied zwischen den beiden!
König Saul stand schliesslich auf und ass das Mahl, das die Wahrsagerin ihm und seinen Begleitern zubereitete. Dann ging er in jener Nacht fort – in den Tod, in die ewige Finsternis. Saul, der erste König in Israel, starb «in seiner Sünde». Er hatte treulos gegen Gott gehandelt. Er war gegenüber dem Wort von Gott ungehorsam gewesen, als er den Auftrag bekam, Amalek auszurotten. Und am Ende seines Lebens offenbarte er ein völliges Abfallen von Gott, als er eine Totenbeschwörerin aufsuchte (1. Chronika 10,13.14). Welch ein tragisches Bild!
Und dann der Gegensatz dazu: Saulus von Tarsus. Als der Herr ihn zu Boden warf, erkannte er sich im Licht Gottes, tat Buße und fand Frieden mit Gott. Obwohl er nach diesem Ereignis noch drei Tage blind war, stand er doch als ein anderer Mensch auf.
Als der Herr den Jünger Ananias zu Saulus sandte, charakterisierte er ihn mit den Worten: «Siehe, er betet.» Aus dem «Lästerer und Verfolger und Gewalttäter» (1. Timotheus 1,13) war ein Beter geworden, der später ein besonderes Werkzeug in der Hand des Herrn Jesus wurde.
Die Philister lehnen David ab
Während Saul sich mit den Mächten der Finsternis einliess, bereiteten sich die Philister zum Krieg gegen Israel vor. Beim Defilee vor dem Kampf waren auch David und seine Männer dabei. Wird David so weit gehen und gegen sein eigenes Volk kämpfen? Nein! Gott lässt es nicht zum Schlimmsten kommen.
Die Fürsten der Philister stellen sich gegen Achis, der David als ein von Israel Abgefallener in Schutz nehmen will. Sie werden zornig über Achis und fordern klar: «Schicke den Mann zurück.» Sie wollen das Risiko nicht eingehen, dass er ihnen plötzlich in den Rücken fällt. Sein Sieg über den Riesen Goliath ist noch lebendig in ihrem Gedächtnis.
Wird David für diesen Ausweg aus einer sehr schwierigen Lage danken? Leider nein. Auf die Worte von Achis, der ihm sein volles Vertrauen ausspricht, gibt er eine scheinheilige Antwort und verleugnet sein eigenes Volk. Er spricht von Israel als von den Feinden meines Herrn. Aber Achis beugt sich dem Druck der Fürsten seines Volkes und schickt David zurück, der dann auch geht.
Aus dem unrühmlichen Verhalten Davids wollen wir für uns lernen: Ein weltlicher Christ verliert die Sympathie der Welt und die Anerkennung Gottes. Das sehen wir auch bei Lot (1. Mose 19,9). Doch der Herr gibt in seiner Treue die Seinen, wenn sie sich von Ihm abgewandt und in die Welt begeben haben, nicht auf. Wie oft benutzt Er seine Vorsehung, um sie zurückzubringen. Welch eine Liebe und Gnade!
An einem Tiefpunkt angelangt
Drei Tage später treffen David und seine Männer in Ziklag ein. Wenn sie gehofft hatten, zu Hause zur Ruhe kommen zu können, wurden sie schwer enttäuscht. Ziklag war verbrannt und die Frauen und Kinder weggeführt worden. Da wurden die Männer von übermässiger Traurigkeit übermannt: «Sie weinten, bis keine Kraft mehr in ihnen war zu weinen.»
David hatte das Gleiche erlitten wie seine Männer. Auch seine beiden Frauen waren gefangen weggeführt worden. Aber jetzt kam er neben seiner Trauer über den Verlust noch in Bedrängnis. Das Volk suchte in seiner Erbitterung einen Schuldigen und sprach davon, David zu steinigen. Nun begann die Züchtigung Gottes Frucht zu tragen. Es heisst: «Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott.» Die grosse Not hatte dazu geführt, dass er zu seinem Gott zurückfand (Psalm 46,2; 94,19).
Und sofort bewahrheitete sich Psalm 119,71: «Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lernte», und Vers 67: «Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich; jetzt aber halte ich dein Wort.» David wollte keinen Schritt mehr in Unabhängigkeit vom Herrn tun. Er fragte Ihn um Wegweisung. Und der Herr? Er gab ihm eine klare Antwort ohne einen Tadel. Wie gütig ist Er!
Als David das Wort von Gott hatte, konnte ihn nichts mehr zurückhalten, auch die körperliche Müdigkeit nicht. Mit 400 Mann, die noch genug Energie hatten, nahm er die Verfolgung der Amalekiter auf.
Gott gibt einen Sieg
Nachdem David zum Herrn zurückgefunden hat und aufs Neue auf einem Weg der Abhängigkeit und des Gehorsams vorangeht, ist er wieder ein schönes Vorausbild auf den Herrn Jesus. Der ägyptische Mann, den sie auf dem Feld finden und der David und seine Männer schliesslich zu den Amalekitern führt, illustriert auf eindrückliche Weise die Bekehrung eines Menschen.
Jeder Mensch gehört von Geburt an zur Welt der Ungläubigen. Er ist ein Sklave Satans und der Sünde. Doch die Welt ist grausam. Wenn jemand im Leben nicht mehr klarkommt (wie dieser ägyptische Jüngling krank wurde), wird er einfach fallen gelassen. Doch der Herr Jesus (von dem David ein Bild ist) kümmert sich gerade um solche «Mühseligen und Beladenen». Sehen wir das nicht auch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der sich um den kümmerte, der halbtot am Wegrand lag? (Lukas 10,30-35). Beim Herrn Jesus findet der Mensch wahre Hilfe (Nahrung und Stärkung), aber auch ein neues Leben und Befreiung vom alten Meister (Vers 15). Zu einer echten Bekehrung gehört zudem ein aufrichtiges, schonungsloses Bekenntnis (1. Samuel 30,13.14). Schliesslich dürfen wir uns als Glaubende dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen, wie dieser Ägypter bereit war, David den Weg zu zeigen.
Gott schenkte David und seinen Leuten einen überwältigenden, vollständigen Sieg über Amalek. Alle Frauen und Kinder und all ihr Vieh brachten sie zurück. Nichts fehlte. Niemand war getötet worden oder sonst umgekommen.
David handelt gnädig
Nun kommt die siegreiche Schar mitsamt ihrer Beute zu den 200 Männern zurück, die am Bach Besor geblieben sind, weil sie keine Kraft mehr hatten, den Feinden nachzujagen. David, ihr Anführer, fragt zuerst nach ihrem Wohlergehen. Dann wehrt er denen, die in ihrem Egoismus nicht bereit sind, die Beute gerecht zu verteilen. Er antwortet in Gnade und weist darauf hin, dass sie den Sieg und die Beute nur dem Herrn zu verdanken haben. Dann stellt er eine Regelung auf, die fortan gelten sollte: Die Beute soll zwischen den Kämpfenden und denen, die bei den Geräten bleiben, gleichmässig verteilt werden.
Auf uns angewendet können wir sagen, dass der Herr einmal jeden Dienst, der für Ihn getan worden ist, belohnen wird. Er weiss, dass wir nicht alle das gleiche Mass des Glaubens haben, und daher nicht alle gleich grosse Dienste tun können. Doch Er sieht die Treue, mit der wir unsere Aufgabe erfüllen, und wird diese belohnen.
Die Gnade im Herzen Davids denkt auch an die Bewohner im südlichen Teil des Stammesgebiets von Juda. Es sind jene Orte, wo er auf seiner Flucht vor Saul umhergezogen war und die ihn sicher auch unterstützt hatten. Ihnen allen schickt er einen Teil der Beute, gewissermassen als Dank. Bemerkenswert ist, dass er in Vers 26 von seinen Freunden spricht, während er vor Achis von den gleichen Leuten als den Feinden meines Herrn gesprochen hatte. David hat wirklich eine vollständige innere Wiederherstellung erfahren.
Saul und Jonathan fallen im Kampf
Während David erfolgreich gegen die Amalekiter kämpfte und alles Geraubte wieder zurückführte, spielte sich der letzte Akt im Leben Sauls ab. Israel unterlag im Kampf mit den Philistern. Saul und seine Söhne kamen in arge Bedrängnis. Zuerst fielen Jonathan, Abinadab und Malkischua, die Söhne Sauls. Armer Jonathan! Er war bereit, David den Thron zu überlassen und der Zweite im Königreich zu sein. Weil er sich aber nie von seinem ungläubigen Vater trennte, musste er schliesslich auch sein Los im Tod mit ihm teilen: Beide fielen im gleichen Krieg mit den Philistern. Wie ernst!
Als Saul merkte, dass die Feinde ihn im Visier hatten, wurde ihm sehr angst. Als religiöser Mensch wollte er nicht, dass unbeschnittene Heiden ihn töteten. Doch seine eigene Beschneidung, d.h. seine Zugehörigkeit zum Volk Gottes, war nur eine äusserliche. In seinem Herzen gab es keinen Glauben und keine Beziehung zu Gott (Römer 2,28.29). Als sein Waffenträger davor zurückschreckte, den König zu töten, verübte Saul seine letzte schwere Sünde und nahm sich selbst das Leben. Und der Waffenträger? In seiner Verzweiflung sah er keinen anderen Ausweg, als sich ebenfalls zu töten (Matthäus 27,5). War dies ein Ausweg? Nein, denn damit fiel er direkt in die Hand des lebendigen Gottes (Hebräer 10,31).
Das traurige Ende des Königs nach den Wünschen der Menschen blieb nicht ohne Folgen. Viele Leute aus Israel flohen nach verlorener Schlacht, und ihre Städte wurden von den Philistern besetzt.
Saul und seine Söhne werden begraben
Die Philister verbreiteten die Nachricht ihres Sieges über Israel in ihrem Land, indem sie den Kopf Sauls und seine Waffen dorthin sandten. Gewissermassen um ihren Göttern zu danken, legten sie die Waffen Sauls in den Götzentempel der Astarot. Die Leichname der gefallenen Königsfamilie hängten sie an die Stadtmauer von Beth-Schean: Eine öffentliche Verhöhnung der Führer Israels!
Am Anfang des ersten Buches Samuel hatten wir die traurige Geschichte des Hohenpriesters Eli und seiner Söhne. Sie dokumentiert den Niedergang des Priestertums. Dann zeigt es uns mit dem Tod Samuels das Ende der Zeit der Richter. Das Buch schliesst mit dem Ende des Königtums nach dem Menschen. Damit wird der Weg frei für die Regierung von König David, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Drei Personen treten in diesem Buch besonders hervor: Samuel, der letzte Richter und der erste Prophet; Saul, der König nach dem Fleisch und David, der Mann nach dem Herzen Gottes und der zukünftige König.
Doch die letzten Verse werfen noch einen Lichtstrahl auf das sonst so düstere Bild. Die Bewohner von Jabes-Gilead hatten nicht vergessen, dass Saul sie einst aus der Hand der Ammoniter gerettet hatte (1. Samuel 11,1-11). Tapfere Männer aus ihnen machten sich auf, um die geschändeten Leichname Sauls und seiner Söhne von der Stadtmauer von Beth-Schean herabzuholen und würdig zu begraben, und zwar in Jabes. Sie fasteten sieben Tage, um ihre Trauer über den Tod des Königs auszudrücken.
Gruss
Der Apostel Paulus hatte während eineinhalb Jahren in Korinth gearbeitet und gewirkt. Viele Menschen öffneten sich dem Evangelium und glaubten an Gott. So entstand dort eine grosse Versammlung. Doch es gab Probleme. Uneinigkeit machte sich breit. Zudem sandten die Korinther dem Apostel einen Brief, in dem sie ihm verschiedene Fragen vorlegten. Nun schrieb Paulus den Korinthern von Ephesus aus diesen Brief. Dabei geht er nicht nur auf ihre Fragen ein. Er nimmt die Missstände in jener Versammlung zum Anlass, um über die kollektive Verantwortung der Gläubigen zu reden, die örtlich als Versammlung zusammenkommen. Gemeinsam bilden sie ein sichtbares Zeugnis von dem, was von der Versammlung als Gesamtheit aller Erlösten wahr ist. Was dazu gehört und was dabei zu beachten ist, zeigt uns dieser Brief.
Der Apostel richtet sich nicht nur an die Versammlung Gottes in Korinth, sondern darüber hinaus an «alle, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen». Die Gültigkeit des Briefes erstreckt sich also auch auf uns. Wir wollen daher die Lehre, die der Herr uns darin vorstellt, beherzigen und praktisch befolgen.
Sosthenes, den der Apostel im Eingangsgruss erwähnt, ist vermutlich der in Apostelgeschichte 18,17 erwähnte Synagogenvorsteher. Als Jude wurde er damals von der aufgebrachten Menge vor dem Richterstuhl von Gallion geschlagen. Jetzt ist er ein Bruder, der als ein Korinther zusammen mit Paulus die Gläubigen der dortigen Versammlung grüsst.
Einleitung
Wie gross war die Gnade Gottes, die die Versammlung in Korinth empfangen hatte! Diese Gläubigen waren in allem reich gemacht worden – in allem Wort und aller Erkenntnis. In geistlicher Hinsicht fehlte ihnen nichts für ein gesundes inneres Wachstum. Für alles hatte der Herr gesorgt. Dafür konnte der Apostel seinem Gott von Herzen danken.
In der Versammlung von Korinth fehlte keine Gnadengabe. Da gab es Brüder, die als Lehrer das Wort erklären und die biblische Wahrheit verständlich weitergeben konnten. Es gab Hirten, die versuchten, die Herzen mit dem Herrn Jesus zu verbinden, aber auch Evangelisten, die die Botschaft vom Kreuz solchen verkündigten, die noch ungläubig waren.
Von Gottes Seite aus gesehen fehlte nichts. Aber es fällt auf, dass der Apostel nichts über die Korinther sagt. Der weitere Verlauf des Briefs zeigt, dass sie ihren grossen, von Gott geschenkten Vorrechten nicht entsprachen. Bei den meisten von ihnen hatte wieder die alte Natur die Oberhand, statt dass sie das neue Leben nährten und förderten.
Darum erinnert sie Paulus an die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus und nicht an die Entrückung. Wenn das Offenbarwerden des Herrn erwähnt wird, hat dies meistens mit unserer Verantwortung zu tun. Dann wird unser Leben in sein Licht gestellt. Doch Er wird nur das belohnen, was seine Anerkennung findet. Gott ist treu. Sind wir es auch im Blick auf unsere Verantwortung?
Spaltungen
Nach dem Dank gegenüber Gott für das, was Er den Korinthern geschenkt hatte, muss Paulus die Briefempfänger ermahnen. Zuerst prangert er die Spaltungen und Parteiungen unter ihnen an. Auf dieses unerfreuliche Thema kommt er bis zum Ende des vierten Kapitels immer wieder zurück. Die Spaltungen führten zu Streitigkeiten, die die Einheit in der örtlichen Versammlung zerstörten.
Die verschiedenen Gruppen unter den Korinthern, die sich voneinander abgrenzten, beriefen sich auf einzelne Diener des Herrn – ohne deren Einwilligung zu haben – als ihre Führer. Die einen bezogen sich auf Paulus, andere auf Apollos oder Petrus. Es gab sogar solche, die Christus zum Haupt ihrer Partei machten. – Die Fragen, die der Apostel den Briefempfängern in Vers 13 stellt, hätten ihnen zeigen sollen, wie verkehrt es war, Gruppen zu bilden. Christus und seine Versammlung bilden eine Einheit. Jede Spaltung ist ein Angriff auf die von Gott geschenkte und bewirkte Einheit.
Paulus war froh, dass er in der grossen Versammlung von Korinth nur einige wenige getauft hatte. Wären es mehr gewesen, hätte dies zu einer Sondergruppe führen können. Die von ihm Getauften hätten als besonders Privilegierte auftreten können.
Paulus hatte nicht den gleichen Auftrag wie die zwölf Apostel (Matthäus 28,19). Seine Botschaft war das Evangelium der Herrlichkeit. Er verkündigte, dass jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, mit Ihm, dem Verherrlichten, verbunden ist und ein Glied seiner Versammlung wird.
Das Wort vom Kreuz
In Vers 17 hat der Apostel das Thema der Redeweisheit angesprochen. Die Griechen waren für ihre menschliche Weisheit bekannt und berühmt. Viele waren in der Lage, ihre Weisheit redegewandt an den Mann zu bringen. Da Korinth eine grosse Stadt in diesem Kulturbereich war, lebten die gläubig gewordenen Korinther in diesem Umfeld.
Als der Apostel Paulus dort hinkam, verkündigte er etwas ganz anderes. Er predigte das Wort vom Kreuz. Er tat es nicht mit menschlicher Redeweisheit. Der Inhalt seiner Verkündigung war ein Schlag gegen die Weisheit der Welt. Er musste den Menschen zeigen, dass ihre Weisheit sie keinen Schritt näher zu Gott gebracht hatte. Sie lebten weit entfernt von Ihm.
Die Botschaft von Paulus – das Evangelium von Jesus Christus – verlangt von den Zuhörern Glauben, keine Weisheit. Aber das fiel den Menschen so schwer. Dass einer am Kreuz für andere sterben sollte, um ihnen den Weg zu Gott zu bahnen, lehnten die Juden ab. Sie wollten Gott durch ihr Tun befriedigen. Aber auch die Griechen verwarfen diese Botschaft als etwas Törichtes: Wie soll einer einem anderen helfen können, wenn er wie ein Verbrecher stirbt?
Und doch gab es in Korinth Menschen, die an Jesus Christus glaubten und errettet wurden. Doch sie gehörten nicht zur Elite der Welt. Gott sorgte dafür, dass der Mensch sich niemals vor Ihm rühmen kann. Als Glaubende wissen wir, dass wir nichts, gar nichts zu rühmen haben. Aber wir dürfen uns des Herrn rühmen, der uns alles geworden ist.
Das Zeugnis Gottes
Nun erinnert Paulus die Briefempfänger an seinen ersten Besuch in Korinth. Er hatte ihnen das Zeugnis Gottes auf ganz einfache Weise verkündigt. Dieses Zeugnis zeigt dem Menschen, dass er in Gottes Augen ein Sünder ist, der das Gericht, die Hölle, verdient hat. Aber es hält auch einen Ausweg, eine Rettung bereit: den Sühnungstod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Deshalb wollte Paulus nichts anderes als «Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt», predigen. Diese Worte schliessen auch das Erlösungswerk mit ein.
Die Predigt war von Schwachheit, Furcht und Zittern begleitet. Die Verse 9 und 10 in Apostelgeschichte 18 bestätigen, dass der Apostel Grund hatte, sich zu fürchten. Paulus versuchte auch nicht, seine Botschaft mit menschlicher Rhetorik an den Mann zu bringen.
Es war der Geist Gottes, der an den Herzen wirkte, so dass die Botschaft die Gewissen der Zuhörer erreichte und sie zur Buße und zum Glauben an den Erlöser führte. Das ist heute noch so: Wenn durch die Verkündigung des Evangeliums Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen, dann geschieht dies nicht durch menschliche Intelligenz oder Fähigkeit, sondern nur durch die Tätigkeit des Heiligen Geistes.
Das Fundament unseres Glaubens ist nicht Menschenweisheit, sondern das Wort Gottes, hinter dem seine ganze Macht steht. Wer sich im Glauben darauf stützt, hat auf Felsengrund gebaut (Matthäus 7,24.25).
Wie Gott sich offenbart
Nun spricht der Apostel von einer Weisheit. Sie steht im Gegensatz zur Weisheit der Welt, die den Korinthern so wichtig war. Es ist Gottes Weisheit. Es sind seine ewigen Gedanken, die Er im Alten Testament noch nicht offenbart hatte. Doch jetzt will Er den Seinen dieses Geheimnis kundtun. In den Versen 10-16 wird erklärt, auf welchem Weg dies geschieht.
In Vers 6 sagt der Apostel, für wen diese Weisheit Gottes ist: für die geistlich erwachsenen Christen, d.h. für die, die im vollen Bewusstsein ihrer Stellung in Christus als Kinder Gottes leben. Das konnte man von den Korinthern nicht sagen. In 1. Korinther 3,1 bezeichnet der Apostel sie als Unmündige in Christus, weil bei ihnen die alte Natur statt das neue Leben die Oberhand hatte. Deshalb konnte er bei ihnen nicht auf den Inhalt des Geheimnisses, d.h. der Gedanken Gottes, eingehen.
In Vers 10 sind die Apostel und Propheten des Neuen Testaments gemeint. Sie besassen den Heiligen Geist. Dadurch verstanden sie, was Gott ihnen durch diesen Geist mitteilte. Das, was Gott ihnen schenkte, verkündigten sie (und schrieben es auch auf). Die Weitergabe dieser Botschaft durch die Apostel und Propheten erfolgte unter der Inspiration des Heiligen Geistes (Vers 13). So wurde uns das Neue Testament unfehlbar und fehlerlos übermittelt. Weil wir als Gläubige den Heiligen Geist besitzen, verstehen wir dieses Wort von Gott (Verse 14-16).
Fleischliches Verhalten
Der geistliche Zustand der Korinther liess sehr zu wünschen übrig. Anstatt im Glauben gewachsen zu sein, musste der Apostel sie als Unmündige bezeichnen, die immer noch «Milch» nötig hatten und keine feste geistliche Speise vertrugen.
Sie waren fleischlich, d.h. ihr Leben und Verhalten wurde von der alten Natur bestimmt, obwohl sie neues Leben aus Gott besassen. Neid und Streit unter ihnen bewiesen dies.
Ab Vers 6 spricht Paulus vom Dienst für den Herrn. Er und Apollos hatten verschiedene Aufgaben. Doch sie arbeiteten miteinander für die gleiche Sache. Sie waren auf dem Ackerfeld Gottes tätig. In diesem Fall waren die Korinther das Ackerfeld. Paulus hatte gepflanzt, d.h. er hatte in Korinth das Evangelium verkündigt. Apollos unterwies die gläubig gewordenen Korinther, nachdem Paulus weitergereist war. Aber weder Paulus noch Apollos vermochten von sich aus etwas zu bewirken. Das Wachstum konnte nur Gott schenken. Trotzdem war jeder für seinen Arbeitsbereich verantwortlich.
Die Verse 10 und 11 zeigen uns die Verantwortung jedes Glaubenden auf. Der Grund ist gelegt. Es ist Jesus Christus und mit Ihm die Lehre des Neuen Testaments, wie wir sie vor allem in den Briefen des Apostels Paulus finden. Was machen wir damit? Bauen wir auf den gelegten Grund, indem wir die Wahrheit, wie wir sie im Neuen Testament finden, praktisch verwirklichen und uns entsprechend verhalten?
Am Haus Gottes arbeiten
In diesen Versen wird die Versammlung als Haus (Tempel) Gottes bezeichnet. Dieses Bild wird im Neuen Testament unter zwei Gesichtspunkten gesehen:
- Als das Haus, das der Herr selbst mit lebendigen Steinen, d.h. mit wahren Gläubigen baut. Die Grundlage ist Er selbst, der ewige Sohn Gottes als der Fels (Epheser 2,20.21; 1. Petrus 2,5; Matthäus 16,18).
- Als das, was die Menschen in ihrer Verantwortung auf den gelegten Grund bauen. Um diese zweite Sichtweise geht es in unseren Versen.
Jeder, der sich an der Arbeit am Haus Gottes beteiligt, wirkt entweder zum Segen oder zum Schaden. Das wertvolle Material ist die gute Belehrung, die zur geistlichen Auferbauung der Gläubigen dient. Das schlechte, wertlose Material entspricht einer schlechten Belehrung, die z.B. von der Bibel abweicht oder ihre Aussagen verwässert. Sie hilft den Gläubigen nicht weiter. Oft schadet sie ihnen. Die Auswirkungen eines Dienstes sind nicht immer sofort erkennbar. Doch der Tag wird kommen, da unsere Arbeit im Feuer der Heiligkeit Gottes geprüft und beurteilt wird.
In den Schlussversen kommt der Apostel auf die menschliche Weisheit zurück und warnt die Korinther vor Selbsttäuschung. Die Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott! Zwei Zitate aus dem Alten Testament bestätigen Gottes Handeln gegen die Weisen dieser Welt und sein Urteil über ihre Gedankengebäude.
Der Gläubige sollte sich nicht über Menschen rühmen, sondern alles, was Gott ihm schenkt – auch durch menschliche Diener –, aus seiner Hand annehmen.
Das richtige Urteil
Die Korinther sollten die Knechte des Herrn nicht als Führer ihrer Parteien betrachten, sondern als das, was sie sein wollten: Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Als Diener waren sie dem Herrn treu und als Verwalter waren sie treu im Blick auf das, was Gott ihnen anvertraut hatte.
Aus den Worten von Vers 3 kann man schliessen, dass die Korinther die verschiedenen Diener des Herrn in ihrer Beurteilung gegeneinander auszuspielen suchten. Der Apostel nimmt dieses Verhalten zum Anlass, ihnen einige wichtige Belehrungen zu geben.
Paulus wich dem Urteil der Korinther über seinen Dienst nicht aus. Doch er wusste, dass das entscheidende Urteil vom Herrn selbst kommt. Persönlich beurteilte er seinen eigenen Dienst überhaupt nicht. Auch wenn ihm nichts Negatives bewusst war, überliess er die Sache ganz dem Herrn.
In Vers 5 geht es nicht um das Beurteilen oder Richten von vorgefallenem Bösen, das z.B. in die Versammlung eingedrungen ist (vergleiche 1. Korinther 5). Es handelt sich um die Beurteilung eines Dieners des Herrn vor der Zeit.
Beim Kommen des Herrn, am Richterstuhl des Christus, werden nicht nur die Resultate unseres Dienstes für den Herrn offenbar und belohnt. Dann wird Er auch die Beweggründe, die verborgenen Gedanken und Gefühle beurteilen und belohnen. Jeder wird dann für sich selbst vor dem Herrn offenbar werden.
Gutes Verhalten der Diener Gottes
Paulus und Apollos waren demütige Diener des Herrn, die nichts aus sich machten. Die Briefempfänger konnten von ihnen lernen. Wir haben in 1. Korinther 1 gesehen, dass die Korinther an keiner Gnadengabe Mangel hatten. Aber nun scheint es, dass sie sich auf das, was sie von Gott empfangen hatten, etwas einbildeten.
Hochmütig dachten sie, es handle sich um ihre eigenen Errungenschaften. Sie waren selbstgefällig und überheblich geworden. Sie verwechselten die heutige Zeit, die eine Zeit des Ausharrens und des Leidens für den Herrn Jesus ist, mit der Zukunft, wenn wir mit Ihm herrschen werden.
In überaus eindrücklicher Weise beschreibt Paulus dann die Stellung der Apostel in der Welt. Sie bildeten sozusagen das Schlusslicht und waren für die ungläubigen Menschen bedeutungslos. Indem Paulus sich zusammen mit den anderen Aposteln den Korinthern gegenüberstellte, versuchte er ihre Herzen und Gewissen zu erreichen. Hätten sich die Korinther nicht schämen und ihr Verhalten ändern müssen, wenn sie daran dachten, wie die Apostel alles auf sich nahmen und erduldeten?
Diese Diener des Herrn aber litten nicht nur. Sie zeigten auch nicht nur Ausharren, sie praktizierten auch Gnade: «Geschmäht, segnen wir; verfolgt, dulden wir; gelästert, bitten wir.» Die Gnade verlieh ihnen Kraft, auch die grösste Verachtung zu erdulden: ein Abschaum aller zu sein.
Paulus und Timotheus
Die erklärenden Worte in Vers 14 schreibt Paulus den Korinthern nicht als ein Erzieher, der Korrekturen anbringt, sondern als ein Vater, der sie von Herzen liebt. Es ging ihm um das Wohl der Gläubigen in Korinth, wo leider manches nicht in Ordnung war. O wie wünschte er, dass sie, denen er das Evangelium verkündigt hatte und die es im Glauben angenommen hatten, jetzt seine Nachahmer würden!
Da es dem Apostel im Augenblick nicht möglich war, persönlich nach Korinth zu kommen, hatte er Timotheus, seinen Mitarbeiter, zu ihnen gesandt. Dieser Mann wusste, was Paulus in allen Versammlungen lehrte (sie hatten damals noch kein Neues Testament), und konnte deshalb auch die Korinther in der richtigen Weise belehren.
Aber es gab Männer in Korinth, die gegen den Apostel arbeiteten und das Vertrauen der Gläubigen zu Paulus untergraben wollten. Sie behaupteten, er habe Timotheus geschickt, weil er es nicht wage, selbst zu kommen.
Aber Paulus würde bald kommen – sobald der Herr es ihm klar zeigte. Dann würde es eine Konfrontation mit den Aufgeblasenen geben. Doch es ging ihm nicht um ihre Worte, sondern um das praktische Verhalten. Im Leben zeigt sich die Kraft wahrer Gottesfurcht nicht in vielen schönen Worten.
Es war dem Apostel jedoch ein grosses Anliegen, nicht in Strenge, sondern in Liebe und im Geist der Sanftmut zu den Korinthern zu kommen.
Darf Böses geduldet werden?
In der Versammlung von Korinth kam Hurerei vor. Paulus hatte davon gehört und nimmt klar Stellung gegen dieses Böse. Traurigerweise hatten sich die Korinther über diese Sache weder gebeugt noch vor Gott gedemütigt. Gingen sie einfach darüber hinweg?
Der Apostel erklärt ihnen nun, dass jemand, der so in Sünde lebt – der Fehlbare hatte mit seiner Stiefmutter sexuellen Kontakt –, aus der Mitte der Gläubigen weggetan werden muss. Die Sache war für ihn so schlimm, dass er für sich selbst bereits ein apostolisches Urteil gefällt hatte: einen solchen dem Satan zu überliefern. Er hatte die Autorität, dies zu tun (1. Timotheus 1,20). Doch in diesem Fall handelte er nicht als Apostel, sondern band die Sache auf die Herzen der Gläubigen in Korinth. Sie mussten als Versammlung (Vers 4) gegen das Böse in ihrer Mitte vorgehen.
Sauerteig ist in der Bibel immer ein Bild des Bösen, von etwas Sündigem. Der alte Sauerteig bezeichnet die Sünden, die wir vor der Bekehrung verübt haben, und die sich durch die Wirksamkeit der alten Natur leider auch im Gläubigen wieder zeigen können.
Wenn wir das Böse in unserem Leben oder unter den Gläubigen dulden, wirkt es weiter. Damit kein weiterer Schaden entsteht, muss es entschieden gerichtet und weggetan werden (Sprüche 28,13). Als Gläubige waren die Korinther ihrer Stellung vor Gott nach ungesäuert. Nun sollten sie auch im täglichen Leben mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit leben, also alles Böse meiden (1. Thessalonicher 5,22).
Zucht in der Versammlung
Aus Vers 5 kann man wohl schliessen, dass der Mann, der in einer solch schlimmen Sünde lebte, tatsächlich Leben aus Gott hatte («damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn Jesus»). Er war ein Bruder, aber er verhielt sich überhaupt nicht wie ein Gläubiger, sondern wie ein ungläubiger Weltmensch, in dessen Leben die Sünde regiert.
Der Apostel weist die Korinther nun an, mit einer solchen Person keinen Umgang zu haben. Es geht nicht darum, dass die Gläubigen die Sünden in der Welt anprangern und gar keinen Umgang mit Ungläubigen haben. Wir leben noch in der Welt und sind von all diesen Sünden und Sündern umgeben, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir haben keinen Auftrag, die Welt zu verbessern.
Unsere Aufgabe ist es, entschieden gegen das Böse, das in der Mitte der Gläubigen vorkommen kann oder von aussen in die Versammlung eindringen will, Stellung zu nehmen und uns davon zu trennen. So mussten die Korinther diesen Mann hinaustun, also von der Gemeinschaft am Tisch des Herrn ausschliessen und auch sonst keinen Umgang mehr mit ihm haben. Dann befand er sich «draussen», ganz in der Hand Gottes. Die Gläubigen in Korinth hatten keine Möglichkeit mehr, einen Dienst an ihm zu tun. Sie konnten nur für eine Wiederherstellung des Fehlbaren beten, sonst aber mussten sie ihn ganz Gott überlassen. Auf diese Weise konnte die Versammlung zeigen, dass sie Böses entschieden ablehnte.
Keinen Rechtsstreit unter Christen!
In diesem Kapitel schneidet der Apostel ein weiteres Problem unter den Korinthern an. Da bei ihnen die alte Natur wieder die Oberhand hatte, gab es Streitigkeiten unter ihnen. Aber anstatt diese irdischen Probleme brüderlich, vielleicht mit Hilfe von erfahrenen Gläubigen zu lösen, zogen sie einander vor weltliche Gerichte.
Mit dem vorwurfsvollen «Wisst ihr nicht?», erinnert der Apostel sie an die Zukunft, da wir mit dem Herrn Jesus herrschen und Verwaltungsaufgaben in dieser Welt wahrnehmen werden. Wie unwürdig war es da, vor weltlichen Richtern für ihr Recht zu kämpfen!
Sie hätten die Sache unter sich regeln sollen. Aber nun taten sie es vor den Ungläubigen. Welch eine Unehre fiel da auf den Namen des Herrn! – Doch es gab eine zweite Überlegung: «Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen?» Hätte die Gesinnung des Herrn Jesus sie geprägt (1. Petrus 2,23), dann hätten sie auf ihr Recht in irdischen, weltlichen Belangen verzichten können. Aber diese himmlische Gesinnung fehlte ihnen.
Mit dem zweiten «Wisst ihr nicht?» appelliert der Apostel an die Verantwortung der Gläubigen in Korinth. Anhand der in den Versen 9 und 10 aufgeführten Liste sollten sie ihr Leben ernsthaft prüfen. Einst lebten sie in diesen schlimmen Sünden. Doch durch die Gnade des Herrn waren sie abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt worden. Entsprach ihr praktisches Leben nun wirklich der Stellung, in die die Gnade sie gebracht hatte? Eine herzerforschende Frage auch für uns!
Flieht die Hurerei!
Ab Vers 12 kommt der Apostel auf unseren menschlichen Körper zu sprechen. Er beginnt mit der Freiheit, in der ein Christ leben darf. Er ist nicht unter Gesetz, sondern frei, um für seinen Herrn zu leben (Galater 5,1). Ein Leben zur Ehre unseres Herrn umfasst auch unseren Körper. Dieser ist zwar noch nicht erlöst (Römer 8,23). Aber er gehört zu unserer Persönlichkeit. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper (1. Thessalonicher 5,23).
Wenn der Apostel nun das Sündigen mit dem Körper – die sexuelle Beziehung ausserhalb der Ehe – anspricht, fragt er wieder: «Wisst ihr nicht?» Das geht auch uns an. Wie leicht vergessen wir, dass unser Körper ein Glied von Christus ist. Zudem ist er der Tempel des Heiligen Geistes, den jeder Glaubende persönlich in sich wohnend hat. Wie sehr sollten wir deshalb darauf achten, mit unserem Körper nicht zu sündigen!
Der Apostel macht deutlich, dass beim sexuellen Kontakt eines Mannes mit einer Frau die zwei ein Fleisch werden. Wie schlimm, wenn ein Gläubiger, der doch aufs Engste mit seinem Herrn verbunden ist, einen solchen Kontakt ausserhalb der Ehe eingeht! Eine schreckliche Sünde gegen den Herrn! Deshalb: «Flieht die Hurerei!»
Lasst uns mehr an den hohen Preis – das Leben und Blut unseres Heilands – denken, um den wir für Gott erkauft worden sind! Dann wird es sicher unser aller Begehr sein, Gott in unserem Körper zu verherrlichen. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wird uns die Kraft dazu schenken.
Ehe und Ehescheidung
Im Anschluss an die Sünde der Hurerei beantwortet der Apostel Paulus jetzt eine Frage, die die Korinther ihm gestellt hatten. Es gibt nur wenige Menschen, die fähig sind, unverheiratet zu bleiben – und nicht zu sündigen (Vers 1). Darum ist es der Normalfall, dass gläubige Menschen heiraten.
Die Verse 3-6 richten sich an verheiratete Kinder Gottes. Wie wichtig ist es, dass sie in der Ehe aufeinander Rücksicht nehmen! Aber sie sind grundsätzlich für einander da und sollen sich einander nicht entziehen.
In Vers 5 wird die Möglichkeit einer gewissen Zeit der Enthaltsamkeit angesprochen. Doch sofort wird auch die Gefahr des Sündigens vorgestellt. Wir haben also alle nötig, uns immer wieder bewahren zu lassen. Vor dem Hintergrund der Gefahren auf sexuellem Gebiet gibt Paulus seine geistlichen Hinweise, ohne über die Korinther zu herrschen.
Den Unverheirateten und Witwen empfiehlt der Apostel, allein zu bleiben wie er, aber nicht um jeden Preis. Wenn die Natur ihr Recht fordert, sollen sie heiraten. Das ist sicher der bessere Weg, als von sexuellem Verlangen verzehrt zu werden oder gar in Sünde zu fallen.
Den Verheirateten sagt er klar, dass eine Ehescheidung niemals nach Gottes Gedanken ist. Sollte dies trotzdem vorkommen, dann stellt er zwei Möglichkeiten vor: Unverheiratet bleiben oder sich mit dem geschiedenen Ehepartner versöhnen und wieder als Ehepaar leben.
Unterschiedliche Situationen
In diesen Versen geht es nicht um eine Ehe, die ein Kind Gottes im Ungehorsam gegen Gottes Wort mit einem ungläubigen Partner eingegangen ist (2. Korinther 6,14). Eine solche Verbindung hat keine Verheissungen. Der Apostel spricht hier von Ehen, die von zwei ungläubigen Menschen geschlossen wurden. Nachdem sie geheiratet haben, wird entweder der Mann oder die Frau gläubig. Was nun?
Wir leben heute in der Zeit der Gnade. Etwas von dieser Gnade wird in den Anweisungen der Verse 12-16 deutlich. Die gläubig gewordene Person soll, wenn immer möglich, mit dem noch nicht bekehrten Ehepartner zusammenbleiben. Von der gläubigen Seite wird ein heiligender Einfluss auf die ganze Familie ausgehen. Vielleicht kommt der ungläubige Mann oder die ungläubige Frau ebenfalls zum Glauben an den Herrn Jesus und wird errettet (Vers 16).
Wenn der ungläubige Partner sich aber vom gläubig gewordenen trennen will, soll der Erlöste ihn ziehen lassen. Der Bruder oder die Schwester ist in diesem Fall nicht sklavisch gebunden.
Die Verse 17-24 enthalten einen allgemeinen Grundsatz: Jeder Gläubige bleibe in dem Stand, in den der Herr ihn gestellt und in den Gott ihn berufen hat. Wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, ändert sich seine Lebenssituation in der Regel nicht. Normalerweise muss und soll er sie auch nicht ändern. Er darf da, wo Gott ihn hingestellt hat, nun ein Zeugnis für seinen Heiland und Herrn sein.
Nur im Herrn heiraten
Nicht jeder Bibelleser kommt mit diesen Versen gleich gut zurecht. Wir wollen versuchen, die Schwerpunkte zu erfassen, die der vom Geist Gottes inspirierte Apostel darin niedergelegt hat.
Als glaubende Christen haben wir eine himmlische Bestimmung. Ehe und Familie gehören aber zur Erde und zur ersten Schöpfung. Deshalb empfiehlt Paulus, um des Herrn und anderer Gründe willen (1. Korinther 7,26.29) unverheiratet zu bleiben. Aber er legt es nicht als ein Gebot auf die Gläubigen, sondern bemerkt, dass dieser «bessere» Weg wirklich nur für den ist, der mit der natürlichen Geschlechtlichkeit keine Probleme hat, seinen Willen entsprechend zügeln und das Alleinsein ertragen kann. Die Praxis zeigt, dass die Ehelosigkeit um des Herrn willen eher eine Ausnahme ist.
Deshalb gibt Paulus in diesen Versen neben seiner persönlichen Meinung auch nützliche Hinweise für die, die heiraten. Zunächst macht er klar, dass es keine Sünde ist zu heiraten (1. Korinther 7,28.36). Doch der Verheiratete wird erfahren, dass eine Ehe und Familie zusätzliche Sorgen und Verpflichtungen mit sich bringt (1. Korinther 7,28.32-34).
Vers 39 macht nochmals deutlich, dass eine Ehe fürs Leben geschlossen wird. Sie wird erst durch den Tod des einen Partners aufgelöst. Wer sie vorher durch eine Scheidung auflöst, handelt gegen Gott und seine Anordnungen. Vers 39 betont, dass eine Ehe «nur im Herrn» geschlossen werden soll. Das bedeutet: Beide sollen nicht nur von neuem geboren sein, sondern auch dem Herrn Jesus in Treue nachfolgen. Zudem soll jeder dem anderen wirklich eine Hilfe sein.
Das Essen von Götzenopfern
Hier kommt der Apostel auf eine weitere Frage der Korinther zu sprechen. Darf ein Christ Fleisch essen, das einem Götzen geopfert worden ist? Als Antwort darauf zeigt Paulus zunächst die Nichtigkeit eines Götzenbildes auf, dem ein solches Opfer gebracht wurde. Für uns ist klar: Es gibt nur einen Gott und einen Herrn. Daher unterscheidet sich das Fleisch von einem Tier, das einem Götzenbild geopfert wurde, in nichts vom Fleisch eines normal geschlachteten Tieres.
Starke und Schwache
Nicht alle Gläubigen in Korinth erkannten dies. Sie hatten sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt und wollten mit allem, was zum Götzendienst gehörte, nichts mehr zu tun haben. Manche von ihnen hätten ihr Gewissen belastet, wenn sie weiter Götzenopferfleisch gegessen hätten. Paulus bezeichnet diese Personen als Schwache. Sie hatten den ganzen Umfang der christlichen Freiheit noch nicht erfasst.
Aber jene Gläubigen in Korinth, die Erkenntnis hatten, sollten auf diese Schwachen Rücksicht nehmen. Wenn sie jedoch entsprechend ihrer Erkenntnis der christlichen Freiheit lebten, ohne in Liebe an die Schwachen zu denken, wurden sie diesen zum Anstoss und zu einem ernsten Hindernis für deren Glaubensleben (Verse 8-13). Paulus zeigt ihnen und auch uns den guten Weg: Lieber auf etwas verzichten, von dessen Richtigkeit man von der Bibel her überzeugt ist, als dem Bruder einen Anstoss zu geben oder ihn sogar zu Fall zu bringen.
Dienst und Lohn
Kapitel 9 ist eine gewisse Fortsetzung von Kapitel 8. Paulus spricht von seinen Rechten als Apostel, von denen er aber in Korinth keinen Gebrauch gemacht hat. Er wollte den Gläubigen keinen Anstoss geben. In Vers 1 legitimiert er sich aber als Apostel. Die Korinther, die durch seinen Dienst zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren, bewiesen, dass er seinen Auftrag als Apostel ausgeführt hatte. Damit gab er denen eine klare Antwort, die versuchten, sein Apostelamt in Frage zu stellen, weil er sich anders verhielt als viele der zwölf Apostel oder die Brüder des Herrn: Er war nicht verheiratet. Er sorgte neben seinem Dienst für seinen Lebensunterhalt. Er hätte ein Recht zu beidem gehabt. Aber er hat es nicht beansprucht.
Die drei in Vers 7 erwähnten Beispiele unterstreichen das Recht eines Dieners des Herrn auf Unterstützung. Wenn der Herr jemand ganz in seinen Dienst ruft wie z.B. die Apostel, sollte ein solcher von denen, die Nutzen von ihm haben, unterstützt werden. Es gab sogar eine Anweisung im Gesetz von Mose, die in ihrer geistlichen Bedeutung diesen Grundsatz unterstreicht.
Paulus und seine Begleiter haben den Korinthern das Evangelium gebracht. Sie haben ihnen «das Geistliche gesät». Viele sind zur Buße und zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Es war für diese Diener eine gewisse Ernte, wenn die gläubig Gewordenen sie ihrerseits materiell unterstützten. Dieser Grundsatz gilt heute noch.
Freiwilliger Verzicht auf Unterstützung
Es scheint, dass die Korinther andere Diener des Herrn materiell unterstützten und damit das Recht dieser Arbeiter bestätigten. Paulus hatte dieses Recht ebenfalls, nahm es aber nicht in Anspruch. Er hat während seines Aufenthalts in Korinth beim Zeltmacher-Ehepaar Aquila und Priszilla seinen Lebensunterhalt verdient. Vermutlich erkannte er die negativen Charakterzüge der gläubigen Korinther schon früh und verzichtete daher auf eine materielle Unterstützung von ihnen.
Die Verse 13 und 14 bestätigen anhand der Priester und Leviten im Alten Testament den Grundsatz der materiellen Unterstützung der Arbeiter des Herrn. Es ist eine Anordnung des Herrn, dass die, die Gottes Wort verkündigen, auch davon leben sollen, indem sie von den Hörern unterstützt werden (Lukas 10,7).
In den Versen 15-18 erläutert der Apostel nochmals, warum er von dem ihm zustehenden Recht keinen Gebrauch gemacht hat. Wie sehr lag es ihm am Herzen, den Auftrag, den er von seinem Herrn empfangen hatte, im Gehorsam auszuführen. Er fühlte, wie die ausserordentliche Gabe, die ihm sein Herr verliehen hatte, ihm zu einer Notwendigkeit wurde. Er musste sie ausüben. Er konnte nicht anders, als das Evangelium zu verkündigen. Aber das war nicht alles. Er wollte diese Botschaft auch kostenfrei machen. Keiner sollte irgendwie auf den Gedanken kommen, er müsse für das Evangelium etwas bezahlen. Eine materielle Unterstützung des Apostels hätte in Korinth zu diesem Fehlschluss führen können.
Selbstverleugnung im Dienst
Paulus hat wohl wie kein anderer Apostel völlig erfasst, was echte christliche Freiheit bedeutet. Aber er, der von allem frei war, machte sich zum Sklaven von allen. Sein grosses Ziel war: auf alle Weise einige zu erretten. Er konnte sich äusserlich den Juden anpassen und besonders denen, die noch sehr am Gesetz von Mose festhielten. Aber er konnte sich äusserlich auch denen anpassen, die aus dem Heidentum kamen. Immer ging es ihm darum, einen Zugang zu den Herzen und Gewissen seiner Zuhörer zu finden, damit diese das Evangelium annahmen und errettet wurden.
In Vers 24 fragt Paulus erneut: «Wisst ihr nicht?» (vergleiche z.B. 1. Korinther 3,16; 5,6; 6,9). Er erinnert sie an Tatsachen, die sie eigentlich kannten. Aber er musste sie darauf aufmerksam machen. Oft folgt im Anschluss an seine Frage eine Ermahnung, so auch hier.
Sie kannten das Bild aus der Sportwelt. Ein Läufer, der in der Rennbahn gewinnen will, verzichtet schon im Training auf vieles, was andere sich erlauben können. Jene Athleten taten dies für einen vergänglichen Preis.
Wie viel mehr sollten Kinder Gottes in ihrem Glaubenslauf bereit sein, aus Rücksicht auf schwache Mitgläubige auf ihre vermeintlichen Rechte zu verzichten! Paulus stellt sich dabei selbst als Beispiel vor. Dieser Glaubensmann lebte – im Gegensatz zu den eingebildeten Korinthern – in ständiger Selbstverleugnung. Ein Vorbild auch für uns!
Das Volk Israel als warnendes Beispiel
Die äussere Zugehörigkeit zum Volk Gottes – wir könnten auch sagen: das äussere Bekenntnis zum Christentum – genügt nicht. Das zeigt uns die Geschichte Israels. Alle waren aus Ägypten gezogen, durch das Rote Meer hindurchgegangen und in die Wüste gelangt. Alle waren in den Genuss des Brotes vom Himmel (Manna) und des Wassers aus dem Felsen gekommen. Sowohl das Manna als auch der Fels weisen auf Jesus Christus hin (Vers 4; Johannes 6,32-35). Doch an den meisten Israeliten hatte Gott kein Wohlgefallen (Vers 5). Warum nicht? Weil sie keinen Glauben hatten! Genauso ist es im Christentum. Wer sich nur äusserlich – z.B. durch die christliche Taufe – zum Christentum bekennt, aber nicht an den Herrn Jesus als seinen persönlichen Erlöser glaubt, wird nicht in den Himmel kommen. Er geht verloren.
In den Versen 6-10 erinnert Paulus an verschiedene Situationen während der Wüstenwanderung des Volkes Israel. In allen offenbart sich das Murren und die Auflehnung gegen Gott. Sie sind zu unserer Warnung aufgeschrieben, damit wir die uns drohenden Gefahren erkennen. Wir haben immer noch die alte Natur in uns, die zu allem fähig ist, wie wir bei Israel sehen. Möge niemand von uns denken, ihm könne nichts passieren, er sei stark genug, um nicht zu fallen. Jeder hat Gottes bewahrende Gnade nötig!
Prüfungen, die Gott uns schickt, erproben unser Vertrauen. Manchmal gehen sie sehr weit. Aber Gott wird nicht zulassen, dass wir als seine Kinder überfordert werden. Zu seiner Zeit wird Er helfend eingreifen.
Der Tisch des Herrn
In diesen Versen stellt der Apostel die Grundsätze des Tisches des Herrn vor. Er tut es vor dem Hintergrund der Warnung vor dem Götzendienst. Die Korinther standen in Gefahr, sich wieder mit Götzen einzulassen. Dadurch hätten sie aber eine Gemeinschaft mit den Dämonen ausgedrückt, die sich hinter den toten Götzen verbargen. Eine solche Gemeinschaft ist wie jede andere religiöse Gemeinschaft unvereinbar mit der Gemeinschaft, die wir als Gläubige mit dem Herrn Jesus an seinem Tisch ausdrücken.
Um diese Gemeinschaft verständlich zu machen, erinnert Paulus an das Friedensopfer im Alten Testament. Von jenem Opfer bekam jeder sein Teil: Gott, der Priester, der Opfernde und jeder reine Israelit (3. Mose 3,3.4; 7,31-34.19).
Durch die Teilnahme an Brot und Wein des Mahls des Herrn drücken wir unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und miteinander aus. Der Kelch wird zuerst genannt. Er erinnert an das Blut des Heilands, an den Preis der Erlösung (1. Petrus 1,19). Auf dieser Grundlage haben wir Frieden mit Gott und Vergebung unserer Sünden. Beim Brot denken wir einerseits an den Körper unseres Heilands, den Er für uns in den Tod gegeben hat. Anderseits ist dieses Brot ein Bild der Einheit der Erlösten. Zusammen bilden sie den Leib des Christus. Wenn wir sonntags das Brot brechen und jeder anwesende Gläubige davon isst, drücken wir mit dieser Handlung unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und untereinander aus.
Freiheit und Rücksichtnahme
Was der Apostel in diesen Versen behandelt, ist nicht neu in diesem Brief. Schon in 1. Korinther 6,12; 8,9; 9,1 hat er das Thema der christlichen Freiheit erwähnt. Die Korinther hatten eine falsche Vorstellung und meinten, sie hätten die Freiheit, alles zu tun, was ihnen passte.
Paulus schränkt die christliche Freiheit in keiner Weise ein, zeigt aber, dass wir als Gläubige immer an die anderen und ihr Wohl denken sollten. Wir stehen z.B. im Begriff, etwas tun, wozu wir vor dem Herrn die volle Freiheit haben. Nun merken wir aber, dass wir dadurch das Gewissen eines anderen beunruhigen, der nicht frei ist, dieses zu tun. Wie verhalten wir uns dann? Beharren wir auf den Rechten unserer christlichen Freiheit oder fragen wir, ob unser Verhalten wirklich zur Ehre Gottes ausschlägt? Wie kann es zu seiner Ehre sein, wenn ein anderes Kind Gottes durch mein Benehmen beunruhigt oder irritiert wird?
Darum schliesst der Apostel seine Ausführungen mit den bemerkenswerten Worten: «Seid ohne Anstoss, sowohl Juden als Griechen als auch der Versammlung Gottes.» Paulus ging in dieser Sache mit dem guten Beispiel voran. Er suchte nicht seinen Vorteil, sondern das Wohl der anderen – ob sie nun religiös waren (Juden) oder zu den Heiden (Griechen) gehörten oder Mitgläubige (Versammlung Gottes) waren. Von ihm wollen wir lernen und mehr an die anderen und weniger an uns denken.
Die Schöpfungsordnung Gottes
Gewissermassen als Abschluss zu dem, was er in Kapitel 10 gesagt hat, fordert Paulus die Korinther auf: «Seid meine Nachahmer.» Doch er will sie nicht zu seinen Anhängern machen, sondern ihnen ein Vorbild in der Nachfolge des Herrn Jesus sein. Darum fügt er hinzu: «Wie auch ich Christi.»
In den weiteren Versen geht es um die Schöpfungsordnung Gottes. Sie gilt für uns, solange wir auf der Erde leben. Christus, der Mensch gewordene Sohn Gottes und der verherrlichte Sohn des Menschen, steht über jedem Mann und jeder Frau. Aber Gott hat den Mann als sichtbares Haupt der Frau eingesetzt. Gott selbst steht über allem, auch über Christus als Mensch.
Wir anerkennen diese göttliche Ordnung und stellen uns darunter, indem der Mann keine Kopfbedeckung trägt, wenn er betet oder weissagt. Die Frau dagegen soll nicht unbedeckt beten oder weissagen. So drücken wir unseren Gehorsam gegenüber Gottes Wort aus. Ab Vers 5 folgen verschiedene Argumente dafür, dass die Frau sich bedecken soll. Indem sie sich beim Beten und Weissagen bedeckt, bejaht sie ihre von Gott gegebene Stellung. In diesen Argumenten spielt auch das Haupthaar eine Rolle. Für eine Frau ist frei wachsendes Haar eine Ehre. Aber Gott bezeichnet es als eine Unehre, wenn sie ihr Haar schneidet. Beim Mann ist es gerade umgekehrt: Er soll sein Haar schneiden, denn langes Haar ist eine Unehre für ihn. – Diese Fragen können nicht wie menschliche Ansichten diskutiert werden (Vers 16).
Schlechtes Verhalten beim Brotbrechen
Zu Beginn dieses Kapitels konnte der Apostel den Korinthern noch ein Lob aussprechen (Vers 2). Im Blick auf die Themen, die er jetzt anschneidet, kann er nicht loben.
Der erste Punkt betrifft die Parteiungen, die es unter den Korinthern gab (1. Korinther 1,10-12). Diese Gruppen machten sich auch in den Zusammenkünften bemerkbar. Da, wo man auf dem Boden der Einheit aller Gläubigen zusammenkam, zeigten sich Spaltungen. Damit wird der Charakter der Versammlung, die örtlich sichtbar werden soll, gestört und der Name des Herrn Jesus als Mittelpunkt der Versammelten verunehrt. Es ist wichtig, den Vers 19 gut zu verstehen. Gottes Wort ruft uns dazu auf, einander in Liebe zu ertragen, und das geht sehr, sehr weit (Epheser 4,2). Aber nie werden wir aufgefordert, etwas zu dulden, was im Widerspruch zum Herrn und seinem Wort steht.
Beim zweiten Punkt geht es um das Mahl des Herrn. Die Korinther hatten aus dem Gedächtnismahl eine gewöhnliche gemeinsame Mahlzeit der Glaubenden gemacht. Dabei warteten sie nicht aufeinander und versuchten, bei diesem Mahl ihren Hunger zu stillen. Es kam vor, dass sie dabei sogar übermässig tranken. Entrüstet muss Paulus sie fragen: «Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes?» Das Verhalten der Korinther war eine Beleidigung Gottes, indem sie auf diese Weise seine Versammlung verachteten. Der Apostel musste sie deshalb ernst tadeln.
Das Mahl des Herrn
Als der Herr Jesus in der Nacht seiner Verhaftung das Gedächtnismahl einsetzte, war Paulus nicht dabei. Doch der verherrlichte Herr hat ihm darüber eine Offenbarung geschenkt und ihm gezeigt, dass dieses Mahl von den gläubigen Christen als Gedächtnis an ihren Erretter gehalten werden soll. Das Brot erinnert an den Körper des Heilands, der damals am Kreuz geopfert wurde (Hebräer 10,10). Der Kelch mit dem Wein erinnert an das Blut des Herrn Jesus als die Grundlage unserer Erlösung. Um uns vom ewigen Tod zu befreien, ist Er für uns gestorben. Durch das Essen vom Brot und das Trinken aus dem Kelch verkündigen wir den Tod des Herrn, bis Er uns zu sich holt. Dann benötigen wir diese Zeichen nicht mehr, dann werden wir Ihn von Angesicht zu Angesicht sehen.
Gläubige Menschen können dieses Mahl in unwürdiger Weise halten. Das ist dann der Fall, wenn sie es leichtfertig tun, ohne an den Ernst der Sache zu denken, oder mit Sünden im eigenen Leben, die sie nicht im Selbstgericht verurteilt und weggetan haben. Unwürdiges Essen und Trinken hat göttliche Konsequenzen. Wegen der Unordnung in Korinth musste Gott züchtigend eingreifen (Vers 30). Die einen wurden schwach, andere krank, es gab sogar solche, die der Herr in seiner Züchtigung vorzeitig aus dem Leben abrief. Das heisst nicht, dass diese verloren gingen. Aber es war doch ernst für sie und die ganze Versammlung. Darum die warnende Schlussfolgerung des Apostels, das Gedächtnismahl des Herrn nicht zu missbrauchen.
Der Geist Gottes und die Gnadengaben
Vermutlich haben die Korinther dem Apostel auch eine Frage bezüglich der geistlichen Gaben gestellt (vergleiche 1. Korinther 12,1 mit 1. Korinther 7,1; 8,1). In 1. Korinther 1,7 hatten wir gesehen, dass sie alle Gnadengaben besassen. Weil bei vielen von ihnen die alte Natur statt das neue Leben die Oberhand hatte, gingen sie mit diesen göttlichen Gaben nicht richtig um. Das führte zu Problemen.
In der Zeit vor ihrer Bekehrung wurden sie von den Götzenpriestern als Unwissende behandelt. Sie konnten nicht beurteilen, was ihnen vorgegaukelt wurde und wie sie geleitet wurden. Jetzt aber steht der Heilige Geist hinter allem. Sein Wirken hat ein grosses Ziel: die Verherrlichung des Herrn Jesus (Johannes 16,14).
Gnadengaben sind Geschenke Gottes, mit denen der Herr die Seinen ausstattet. Sie können sehr verschieden sein. Aber alle werden in der Kraft und Energie des Heiligen Geistes ausgeübt. Die Verschiedenheiten von Diensten ergeben sich, wenn diese Gaben unter der Leitung und Autorität des Herrn Jesus zur Ehre Gottes und zur Förderung des geistlichen Lebens der Gläubigen ausgeübt werden. Und die Resultate? Nicht die Menschen, die sich gebrauchen lassen, bewirken etwas, sondern Gott, «der alles in allen wirkt».
Die Verse 8-10 zeigen, wie verschieden die geistlichen Begabungen sein können. Aber alles wird von ein und demselben Geist hervorgebracht und von Ihm in göttlicher Weisheit benutzt. Und jede Gnadengabe kann nur in seiner Kraft ausgeübt werden.
Der Leib und die Glieder (1)
Alle Glaubenden, die heute auf der Erde leben, bilden zusammen eine wunderbare Einheit: den Leib des Christus. Jeder Einzelne – so verschieden wir unserer Herkunft oder unserer sozialen Stellung nach sein mögen – ist ein Glied an diesem Leib. Es ist der in uns wohnende Heilige Geist, der uns als Glieder miteinander und mit dem verherrlichten Herrn als dem Haupt seines Leibes verbindet. – In diesem einen Leib des Christus gibt es eine grosse Vielfalt durch die einzelnen Glieder. Der Apostel Paulus zeigt dies anhand unseres menschlichen Körpers. Dabei spricht er zwei besondere Gefahren an:
- Die Unzufriedenheit der Glieder mit dem Platz, den Gott ihnen an dem Leib gegeben hat (Verse 16-20).
- Der Hochmut einzelner Glieder gegenüber anderen (Verse 21-25).
Wir verstehen gut, dass der Fuss nicht behaupten kann, er sei nicht Teil unseres Körpers, nur weil er nicht Hand ist. Aber wenn es um unseren Platz unter den Glaubenden geht, können wir unzufrieden werden. Wir denken, wir seien zu nichts nütze und deshalb überflüssig. Wir meinen, wenn wir anders wären als wir sind, wenn wir die Begabung unseres Mitgläubigen hätten, dann sähe es besser aus. Darauf gibt es zwei Antworten:
- Der Leib kann doch nicht ein Glied, z.B. alles Auge sein. Die Vielfalt der Glieder und ihrer Aufgaben ist nötig, damit der Körper richtig funktioniert.
- Es ist Gott, der die einzelnen Glieder an den von Ihm gewollten Platz am Leib gesetzt hat. Unzufriedenheit darüber ist daher eine Auflehnung gegen Ihn.
Der Leib und die Glieder (2)
Ab Vers 21 begegnet der Apostel der zweiten Gefahr: dem Hochmut einzelner Glieder gegenüber anderen. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht. Jedes Glied am menschlichen Körper hat seine besondere Funktion: Mit dem Auge sieht der Mensch, mit der Hand fasst er Dinge an und die Beine und Füsse dienen zur Fortbewegung.
Aber als Gläubige stehen wir in Gefahr, uns zu überschätzen. Hochmütig denken wir dann, wir hätten den «geringeren» Bruder neben uns nicht nötig. Haben wir nicht schon gemeint, wir kämen ohne diesen oder jenen Mitgläubigen zurecht? Nein, sagt der Apostel: «Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig.» Wir wollen jede aufkommende Überheblichkeit gegenüber anderen sofort im Selbstgericht entschieden verurteilen, «damit keine Spaltung in dem Leib sei». Lasst uns vielmehr das Wohl der anderen suchen, auf sie Acht haben, und sie als Brüder und Schwestern, die der Herr uns zur Seite gestellt hat, lieben und schätzen.
Wie beim menschlichen Körper so ist es auch im geistlichen: Wenn ein Glied leidet, wird der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen. «Ihr aber seid Christi Leib, und Glieder im Einzelnen.» Die Korinther als örtliche Versammlung waren ein sichtbares Zeugnis von dem, was von der ganzen Versammlung gilt. Wie wichtig war es da, dass sich jeder von ihnen als Glied an diesem Leib richtig verhielt. Das konnte er nur, wenn er sich an dem Platz befand, an den Gott ihn gestellt hatte, und das tat, wozu er begabt war.
Die Liebe als Motiv
Die Korinther waren stolz auf die von Gott geschenkten Gaben. Es scheint sogar, dass sie das Reden in Sprachen als das Begehrenswerteste betrachteten. Was ihnen aber fehlte, war echte Liebe zueinander. Deshalb fügt Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes an dieser Stelle das Kapitel der Liebe ein. Sie sollte bei jeder Tätigkeit für den Herrn die Triebfeder sein. Das ist der «weit vortrefflichere Weg».
In den ersten drei Versen konstruiert Paulus Beispiele, die über die Realität hinausgehen. Damit zeigt der Apostel den Korinthern und uns, wie wertlos jeder Dienst und jede Aufopferung ohne Liebe als Triebfeder ist. Haben wir seine Botschaft verstanden?
In den Versen 4-7 haben wir eine Beschreibung der göttlichen Liebe. Sie verhält sich so, ohne dass ihr Gegenüber sie dazu veranlasst. Hat Gott uns seine Liebe in der Dahingabe seines Sohnes nicht zu einer Zeit erwiesen, als wir noch Sünder waren? Lasst uns doch seine Nachahmer sein!
Die Liebe vergeht nie
Die Verse 8-13 zeigen, dass alles Erkennen in unserem Leben hier nur Stück um Stück möglich ist. Das Vollkommene erreichen wir erst mit dem Kommen des Herrn zur Entrückung. Dann wird jeder Dienst zu Ende gehen. Es wird kein geistliches Wachstum, kein Zunehmen der Erkenntnis mehr geben. Jetzt leben wir noch in der Begrenztheit eines Kindes. Wir sehen vieles undeutlich. Dann aber wird alles klar. Und die göttliche Liebe? Sie vergeht niemals. Sie ist unvergänglich und ewig. Wenn wir am Ziel sind, werden wir sie in vollkommenem Mass geniessen.
Weissagen und in Sprachen reden
Vor dem Hintergrund der Überbetonung der Gabe des Redens in fremden Sprachen in Korinth spricht der Apostel über den Dienst der Weissagung. Mit Weissagen ist hier nicht ein Voraussagen zukünftiger Ereignisse gemeint. Weissagen bedeutet hier, dass bei der Verkündigung des Wortes Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes die Herzen und Gewissen der Zuhörer ins Licht Gottes gestellt werden (1. Korinther 14,24.25). Eine solche Verkündigung dient zur geistlichen Auferbauung der Versammlung. Das ist es, worauf der Apostel in diesem Kapitel das Schwergewicht legt. Auch ein solcher Dienst, der «den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung» sein soll, muss die Liebe als Triebfeder haben (Vers 1).
Das Reden in fremden Sprachen war in Korinth wohl sehr verbreitet. Wenn die Sprachen jedoch nicht übersetzt oder ausgelegt wurden, nützte dieser Dienst niemand. «Ihr werdet in den Wind reden.»
Im Gegensatz zum Reden in Sprachen wollte der Apostel in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre zu ihnen reden. Offenbarungen haben wir heute keine mehr, da die Bibel abgeschlossen ist. Aber die übrigen drei Punkte gehören heute noch zu einer Gott gewollten Verkündigung.
Auch wenn wir heute das Reden in Sprachen nicht mehr haben – dieser Dienst hat aufgehört (1. Korinther 13,8) –, sollte jeder Verkündiger des Wortes Gottes die Hinweise der Verse 8-12 zu Herzen nehmen. Von Nutzen ist nur eine Botschaft, die von den Zuhörern verstanden wird.
Mit Verstand und zum Nutzen
Auch diese Verse enthalten beherzigenswerte Hinweise für unser Zusammenkommen als Gläubige, sei es zur Wortverkündigung, zum Gebet oder zu Lob und Anbetung. Wie wichtig ist es für jeden Bruder, der ein öffentliches Gebet spricht, dass er auch mit dem Verstand betet. Das wird ihn davor bewahren, zu lang zu beten oder Gebetsgegenstände zu erwähnen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Wenn wir mit dem Geist und mit dem Verstand beten, wird es den Hörern nicht schwer fallen, am Schluss ein deutlich hörbares Amen zu sagen. Hingegen ist es schwierig, von Herzen Amen zu sagen, wenn ein Gebet so lang ist, dass man am Schluss nicht mehr recht weiss, was der Bruder zu Beginn gesagt hat. – Auch beim Vorschlagen und gemeinsamen Singen von Liedern wollen wir den Verstand gebrauchen. So wird auch das Beten und Singen zur Erbauung der Versammlung dienen.
In Vers 23 haben wir den Ausdruck «als Versammlung zusammenkommen». Eine Zusammenkunft der Gläubigen hat dann diesen Charakter, wenn sie auf der alleinigen Grundlage des Wortes Gottes im Namen des Herrn versammelt sind und Er der alleinige Mittelpunkt ist. Wenn in einer solchen Zusammenkunft der Heilige Geist ungehindert einen Dienst der Weissagung bewirken kann, wird dies auf einen Unkundigen, der hereinkommt, nicht ohne Wirkung bleiben. Er wird ins Licht Gottes gestellt werden und anerkennen, dass Gott in dieser Versammlung anwesend ist und sich offenbart.
Anweisungen für die Wortverkündigung
Wenn die Gläubigen an einem Ort als Versammlung zusammenkommen, dann wird der Dienst nicht von einer Person ausgeführt, auch nicht von einigen dafür bestimmten Personen. Der Herr Jesus möchte, dass der Dienst von mehreren getan wird, ohne dass man vorher eine menschliche Abmachung trifft. Diese Freiheit bedeutet jedoch nicht, dass jeder tun kann, was er will. Wer etwas sagt, muss unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen, die Anweisungen in der Bibel beachten und sich fragen, ob sein Beitrag wirklich zur Erbauung der Versammlung dient.
Erneut wird klar, dass das Reden in Sprachen den Zuhörern nur dann von geistlichem Nutzen ist, wenn ein Ausleger da ist. Propheten waren Brüder, die einen Dienst taten, wie er in diesem Kapitel beschrieben wird. Auf heute übertragen kann es sein, dass in einer Zusammenkunft zur Verkündigung des Wortes Gottes mehr als ein Bruder spricht. Oberstes Ziel, das jeder Redende im Auge behalten muss, ist die Auferbauung der Versammlung. Deshalb dürfen wir in keinem Fall den Verstand ausschalten (Vers 32).
Und die Zuhörer? Sie werden aufgefordert, das Gehörte anhand der Bibel zu beurteilen. Dabei geht es nicht um Kritik an den menschlichen Schwächen, die wohl jeder Diener des Herrn hat. Sie sollen vielmehr feststellen, ob das Gesagte mit der Lehre der Schrift übereinstimmt und zur geistlichen Erbauung der Versammlung dient. – Wie wichtig ist es, diese Punkte stets zu beachten und zu befolgen, damit in der Versammlung keine Unordnung entsteht.
Ordnung und Frieden
Sowohl gläubige Männer als auch gläubige Frauen sind Kinder Gottes, die der Vater mit der gleichen Liebe liebt. In ihrem Wert vor Gott unterscheiden sie sich in nichts (Galater 3,28). In Bezug auf die Stellung von Mann und Frau auf der Erde, wo die Schöpfungsordnung Gottes gilt, gibt es jedoch Unterschiede. Das haben wir in 1. Korinther 11,2-16 gesehen. Das kommt auch in den Zusammenkünften der Versammlung zum Tragen. Da sollen die Frauen schweigen und keinen öffentlichen Dienst tun. Auf diese Weise nehmen sie ihren von Gott gegebenen Platz der Unterordnung ein.
Wenn eine Frau Fragen zum Wort Gottes hat, soll sie zu Hause ihren Mann fragen und die Frage nicht öffentlich in den Zusammenkünften stellen. Das ist eine ernste Herausforderung für alle gläubigen Ehemänner. Sind wir in der Lage, die Fragen unserer Frauen zu beantworten? Wir merken, wie nötig es ist, dass wir das Wort Gottes zuerst für uns persönlich lesen und studieren.
Aus Vers 36 kann man schliessen, dass die Korinther es im Blick auf das öffentliche Reden der Frauen in der Versammlung nicht so genau nahmen und von der göttlichen Ordnung abwichen. Aber Paulus macht klar, dass dies ein Gebot des Herrn und daher verbindlich ist. – Noch einmal ermuntert der Apostel die Korinther zu weissagen (vergleiche 1. Korinther 14,39 mit 1. Korinther 12,31; 14,1). Dieser Dienst fördert die Auferbauung der Versammlung. Aber ebenso wichtig ist, dass die Zusammenkünfte anständig und in Ordnung verlaufen. Unordnung schadet den Zuhörern.
Christus ist auferstanden
In diesem Kapitel geht es um die leibliche Auferstehung der heimgegangenen Gläubigen. Es gab in der Versammlung in Korinth Personen, die die von den Aposteln verkündete leibliche Auferstehung in Frage stellten (Vers 12). Es war für sie etwas Unmögliches. Vermutlich hielten diese Leute am Weiterleben der Gläubigen in der Ewigkeit fest, beschränkten es aber auf die Seele.
Der Apostel begegnet diesem Problem, indem er die leibliche Auferstehung des Herrn Jesus herausstellt. Sie gehört zu den Fundamenten des Evangeliums, das die Korinther im Glauben angenommen hatten. Drei Heilstatsachen bilden diese Grundlage. Sie sind bereits im Alten Testament angekündigt worden (Jesaja 53,8.12).
- Christus ist für unsere Sünden gestorben.
- Er ist begraben worden.
- Er ist am dritten Tag auferweckt worden.
Nun fügt der Apostel sechs Beweise der Auferstehung von Christus hinzu. Es sind Begebenheiten, bei denen der Auferstandene den Seinen erschienen ist. Diese alle konnten die Wahrheit der leiblichen Auferstehung des Herrn bezeugen. Ja, Er war auch Paulus erschienen.
Die Verse 9 und 10 zeugen von der Demut des Apostels der Nationen. Nie hat er vergessen, dass er einst die Versammlung Gottes verfolgt hat. Er sagt: Ich bin nicht wert, ein Apostel genannt zu werden. Aber dann rühmt er die Gnade Gottes, die ihn in den Dienst im Werk des Herrn gestellt hat. Welch ein unermüdlicher Arbeiter ist er geworden! Doch er schreibt alles der Gnade Gottes zu, die ihn dazu befähigt hat.
Ohne Auferstehung keine Hoffnung
In diesen Versen argumentiert Paulus mit den Leuten, die die leibliche Auferstehung der Gläubigen leugnen. Dabei denkt er die Sache konsequent bis zum Ende durch. Die ernsten Schlussfolgerungen, die er nacheinander zieht, sollten jedem deutlich machen, wie unsinnig die Leugnung der Auferstehung ist.
Wenn es keine Auferstehung gibt, dann kann auch Christus nicht auferstanden sein. Doch gerade seine Auferstehung hat der Apostel in den Eingangsversen des Kapitels durch mehrere Zeugen belegt. Sollte Christus tatsächlich nicht auferstanden sein, dann war die Predigt des Evangeliums eine wertlose Botschaft, die Korinther hatten einer inhaltslosen Verkündigung geglaubt und die Apostel waren falsche Zeugen.
Aber seine Argumentation geht noch weiter. Die Korinther hatten geglaubt, dass Jesus Christus für ihre Sünden gestorben war. Auf Grund des vollbrachten Erlösungswerks hatte Gott ihnen alles vergeben. Aber ohne Auferstehung würde die göttliche Bestätigung des vollbrachten Erlösungswerks fehlen (Römer 4,24.25). Die Korinther wären trotz ihres Glaubens an Jesus Christus noch in ihren Sünden. Und die heimgegangenen Gläubigen wären verloren. Schliesslich wäre das Christentum auf das Leben vor dem Tod begrenzt und wir Christen hätten keine Hoffnung.
Doch Gott sei Dank, es gibt eine Auferstehung und Christus, auf den wir unser Vertrauen gesetzt haben, ist auferstanden! Er lebt als Mensch im Himmel.
Die Auferstehung und ihre Ordnung
An dieser Stelle unterbricht der Apostel seine Ausführungen über die leibliche Auferstehung. Nachdem er aufgezeigt hat, welch tragische Konsequenzen es für uns Christen hätte, wenn Christus nicht auferstanden wäre, ruft er jetzt triumphierend aus: «Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt.»
Im Anschluss daran führt Paulus aus, was aus der Auferstehung des Herrn Jesus folgt und was damit zusammenhängt. Auf die Sünde des ersten Menschen folgte der Tod, aber durch den Menschen Jesus Christus kam die Auferstehung aus den Toten. Er ist der Erstling einer grossen Ernte. Alle, die im Glauben sterben, werden wie Er aus den Toten auferstehen – die einen bei der Entrückung, die Märtyrer der Drangsalszeit bei seinem Kommen in Herrlichkeit.
Dann wird der auferstandene und verherrlichte Christus 1000 Jahre lang in Gerechtigkeit und Frieden herrschen. Seine Regierung dauert an, bis Er alle Feinde unter seine Füsse gelegt hat. Der letzte Feind, der beseitigt wird, ist der Tod (Offenbarung 20,14).
Die Verse 27 und 28 machen klar, dass es hier um die Stellung von Christus als Mensch geht. Als ewiger Sohn Gottes ist Er eins mit Gott, dem Vater. Aber Er ist Mensch geworden und bleibt es in Ewigkeit. Als solcher ist Er für uns am Kreuz gestorben und wird alle Pläne Gottes mit der ersten Schöpfung erfüllen (Hebräer 2,5-9). Wenn dieses Ziel erreicht ist, wird es neue Himmel und eine neue Erde geben, in denen Gerechtigkeit wohnen wird (2. Petrus 3,13). Dann wird Gott alles in allem sein.
Das Verhalten im Licht der Auferstehung
Jetzt greift Paulus das in Vers 19 unterbrochene Thema wieder auf. Die Taufe wird hier eingeführt, weil sie ein Bild des Begrabenwerdens mit Christus ist – aber mit dem Blick auf die Auferstehung (Römer 6,3.4). Mit den Toten, für die andere getauft werden, meint der Apostel jene gläubigen Christen, die bereits heimgegangen sind. An ihre Stelle traten andere Menschen, die an den Herrn Jesus glaubten und getauft wurden. Ohne die Gewissheit, dass es eine Auferstehung gibt, wäre es sinnlos, Christ zu werden und sich taufen zu lassen.
Ebenso sinn- und zwecklos wären all die Strapazen und Gefahren, die der Apostel Paulus und viele andere Diener seither auf sich genommen haben. Weil das Leben der Christen sich nicht auf das Diesseits beschränkt – sie haben eine wunderbare Hoffnung auf die Auferstehung und das Leben bei Christus in der Herrlichkeit –, werden sie in den notvollen Umständen nicht mutlos.
Menschen, die weder an eine Auferstehung noch an ein Leben im Jenseits glauben, konzentrieren sich nur auf das Diesseits. Von solchen Gedanken sollten sich die Korinther nicht anstecken lassen. Die Warnung gilt auch uns. Wir sollten unser Leben im Licht Gottes und zu seiner Ehre führen. Der Augenblick kommt, da wir vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, um unser Leben mit seinen Augen zu sehen und für das, was Er anerkennen kann, belohnt zu werden (2. Korinther 5,9.10).
Sterben und auferstehen
Die Ausführungen des Apostels in den Versen 35-41 gelten vor allem jenen Menschen, die die leibliche Auferstehung leugnen, weil sie diese mit ihrem Verstand nicht erklären können. Er verweist auf zwei Tatsachen, die jeder in der Natur beobachten kann:
- Damit aus einem Samenkorn eine neue Pflanze entstehen kann, muss dieses sterben.
- Die Pflanze, die aus dem gesäten Korn wächst, gleicht diesem in keiner Weise. Der Auferstehungsleib wird ganz anders aussehen als der beerdigte sterbliche Körper (Vers 40).
Ab Vers 42 folgt die Anwendung des Gesagten. Wenn wir am Grab eines heimgegangenen Erlösten stehen und seinen Körper der Erde übergeben, redet dieser von Verwesung, Unehre und Schwachheit. Doch wir sind nicht ohne Hoffnung. Der Augenblick wird kommen, da dieser Körper als ein geistiger Leib in Unverweslichkeit, Herrlichkeit und Kraft auferweckt werden wird.
Dann zieht der Apostel einen Vergleich zwischen Adam und Christus, als Auferstandenem. Gott bildete den ersten Menschen aus dem Staub der Erde und hauchte ihm den Odem des natürlichen Lebens ein (1. Mose 2,7). Der Herr Jesus, der Mensch vom Himmel, trat nach vollbrachtem Erlösungswerk als Auferstandener in die Mitte der Jünger und hauchte in sie (Johannes 20,22). Damit teilte Er ihnen das Auferstehungsleben mit. Der letzte Adam ist ein lebendig machender Geist!
Jetzt tragen wir das Bild des ersten Menschen mit seiner Begrenztheit. Nach der Auferstehung werden wir dem Herrn gleichförmig sein (Philipper 3,21; Römer 8,29).
Auferstehung und Verwandlung
Jetzt will der Apostel noch ein Wort über den Zeitpunkt der Auferstehung der Glaubenden sagen. Dabei spricht er von einem Geheimnis. Damit meint er eine Wahrheit, die im Alten Testament noch nicht offenbart war. Das Geheimnis betrifft nicht die Auferstehung – diese war den Gläubigen des Alten Testaments bekannt –, sondern die Verwandlung der zu jenem Zeitpunkt lebenden Gläubigen. Aus 1. Thessalonicher 4,15-17 wird klar, dass der Zeitpunkt, von dem Paulus hier spricht, das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung der Seinen ist. Wenn Er aus dem Himmel kommen wird, um uns zu sich zu holen, werden alle im Glauben Gestorbenen auferstehen und alle dann lebenden Gläubigen verwandelt werden. Dieses gewaltige Ereignis wird sich in einem Augenblick abspielen.
Das «Muss» in Vers 53 bezieht sich auf Vers 50, wo gesagt wird, dass Fleisch und Blut (das Sterbliche) das Reich Gottes nicht erben können. Ebenso kann die Verwesung nicht Unverweslichkeit erben. Aber, Gott sei Dank, das Kommen des Herrn Jesus zu unserer Entrückung wird zu einem gewaltigen Sieg über den Tod ausschlagen.
Als glaubende Christen haben wir eine wunderbare Hoffnung auf die Verwandlung des Körpers beim Kommen des Herrn. Zudem wissen wir mit Sicherheit, dass es eine leibliche Auferstehung gibt. Beides spornt uns an, die Zeit, die uns auf dieser Erde bleibt, voll für das Werk unseres Herrn einzusetzen. Es lohnt sich, es ist der Mühe wert!
Sammlungen und Reisepläne
In Vers 1 spricht der Apostel den letzten offenen Punkt an: die Sammlungen oder das materielle Opfer (vergleiche 1. Korinther 7,1; 8,1; 12,1). In Korinth ging es vor allem um die Unterstützung der verarmten Gläubigen in Jerusalem und Judäa (siehe 2. Korinther 8 und 9). Unser Abschnitt gibt uns einige allgemeine Hinweise über das materielle Opfer der Gläubigen:
- Jeder soll persönlich vor dem Herrn geübt sein, wie viel er am Sonntag in die Kollekte einlegt. Der Herr zwingt niemand und überfordert auch keinen.
- Die Sammlung soll an jedem ersten Tag der Woche erfolgen, also in Verbindung mit dem Halten des Gedächtnismahls. Der enge Zusammenhang zwischen den Opfern des Lobes und den materiellen Opfern wird auch aus Hebräer 13,15.16 ersichtlich (siehe auch 5. Mose 12,6).
- Die Verwaltung der eingelegten Gaben geschieht durch vertrauenswürdige Brüder, die von der örtlichen Versammlung dazu bestimmt werden.
Obwohl Paulus den Korinthern einen ernsten Brief schreiben musste, wollte er sie wieder besuchen und für eine Zeit bei ihnen bleiben. Beweist dies nicht seine Liebe zu ihnen? – Bis dahin blieb er in Ephesus, wo er eine geöffnete Tür, aber auch grossen Widerstand fand.
Den von Natur aus ängstlichen Timotheus sollten die Korinther als einen Diener aufnehmen, der am gleichen Werk arbeitete wie der Apostel. – Apollos war ein selbstständiger, dem Herrn verantwortlicher Diener. Vielleicht wegen den Spaltungen dort wollte er noch nicht nach Korinth gehen (1. Korinther 1,12).
Ermahnende Schlussworte
Bevor der Apostel zum Schluss des Briefes kommt, ermahnt er die Korinther nochmals. Die Verse 13 und 14 erinnern an das, was bei ihnen fehlte: die Wachsamkeit gegenüber den Listen des Teufels, das Feststehen im Glauben, die geistliche Energie und die Liebe als Triebfeder jeder praktischen Tätigkeit.
Es gab unter den Korinthern auch einige, die das Herz von Paulus erfreuten. Drei Brüder hatten ihn besucht, als viele der Korinther sich dem Apostel gegenüber eher reserviert verhielten. Einer von ihnen – Stephanas – war wohl der erste Gläubige in jener Provinz. Seiner Familie stellt Paulus ein besonderes Zeugnis aus. Aus Liebe zu ihrem Herrn hatten sie sich den Glaubensgeschwistern zum Dienst verordnet, d.h. sie waren bereit, den anderen zu dienen, was immer diese nötig hatten. – Aquila und Priszilla waren den Korinthern gut bekannt. Jetzt wohnten sie in Ephesus und hatten den Gläubigen ihr Haus geöffnet, damit sie dort zusammenkommen konnten.
Wie die meisten seiner Briefe hat Paulus auch diesen diktiert. In Vers 21 fügt er den Gruss eigenhändig an. Auch wenn ein anderer Bruder diesen Brief niedergeschrieben hat, war doch Paulus der von Gott inspirierte Verfasser des Textes. Der Brief endet
- mit einem ernsten Appell an solche, die nur dem Bekenntnis nach Christen sind,
- mit einem Hinweis auf das Kommen des Herrn,
- mit der Gnade für den weiteren Glaubensweg und
- mit der Liebe des Apostels zu den Briefempfängern.

Kleinasien zur Zeit des Neuen Testaments
Struktur und Überblick
Kapitel 1 – 8
Elia und Elisa dienen als Propheten Gottes im Nordreich von Israel. Ihr Wirken ist ein Beweis, dass der Herr sich in Gnade um sein untreues, götzendienerisches Volk bemüht.
Kapitel 9 – 17
Nach der Thronbesteigung Jehus geht es im Zehnstämme-Reich weiter bergab, bis Gott nach ungefähr 130 Jahren einschreitet und die Menschen nach Assyrien wegführen lässt.
Kapitel 18 – 25
Das Zweistämme-Reich im Süden bleibt noch ungefähr 130 Jahre bestehen. In dieser dunklen Zeit gibt es treue Könige: Hiskia und Josia. Am Ende werden die Juden nach Babel verschleppt.
Einleitung
Der Herr Jesus suchte den Kontakt zu den Menschen: Er besuchte Martha und Maria, nahm die Einladung eines Pharisäers an und kehrte bei Zachäus ein. Anhand von Gleichnissen stellte Er die Gnade Gottes vor: Der barmherzige Samariter kümmert sich um den Verwundeten, der Hirte sucht sein Schaf, der Vater nimmt den verlorenen Sohn auf. In seinen Werken und Worten zeigte sich: «Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist» (Lukas 19,10).
Der Herr sendet 70 Jünger aus
Auf seinem letzten Weg nach Jerusalem sandte der Herr nochmals siebzig Jünger zu je zwei aus. Sie sollten in die Städte gehen, wohin Er selbst kommen wollte, um den Menschen zu sagen: «Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen» (d.h. in der Person des Messias, der aber bereits von der Allgemeinheit verworfen worden war). Für den Einzelnen gab es immer noch die Möglichkeit, die Boten von Christus aufzunehmen und den Frieden zu empfangen, den sie brachten.
Diese Verse reden direkt in unsere Zeit hinein, die wir am Ende der Periode der Gnade stehen. Gibt es nicht viel zu wenig Arbeiter? Es befinden sich noch so viele Menschen auf dem Weg ins Verderben! Zwar verschliesst sich die Mehrzahl dem Evangelium. Aber das entbindet uns keineswegs vom Auftrag, die Botschaft der Gnade so lange wie möglich weiterzusagen (vergleiche Vers 11). Vers 12 kann direkt auf unsere christlichen Länder angewandt werden. Nachdem das Evangelium so viele Jahrhunderte verkündigt worden ist, wird die Ablehnung der Gnade äusserst ernste Folgen haben. Es wird diesen Leuten am Tag des Gerichts schlimmer ergehen als den Bewohnern von Sodom.
Der Herr musste ernste Wehen über jene Städte in Galiläa aussprechen, die seine Belehrungen hörten und seine Wunderwerke sahen und doch nicht Buße taten. Sie hatten ein schreckliches Gericht zu erwarten.
Vers 16 zeigt die weitreichenden Konsequenzen der Verwerfung der Boten von Christus. Sie bedeutet, dass man damit den allmächtigen Gott verwirft!
Freude und Lobpreis
Die Siebzig kehrten freudig von ihrer Mission zurück und berichteten dem Herrn, wie ihnen die Dämonen in seinem Namen untertan waren. Darauf antwortete Er mit dem Hinweis auf das, was in der Zukunft mit Satan geschehen wird (Vers 18; Offenbarung 12,7-9). Sein Endgericht wird der Feuersee sein (Offenbarung 20,10).
Dann aber sprach der Herr von der neuen Zeitperiode der Gnade. Durch seine Verwerfung stand sie damals im Begriff, eingeführt zu werden. Heute sind wir an ihrem Ende angelangt. In dieser Zeit geht es nicht um Sichtbares oder um Werte dieser Erde, sondern um himmlische Dinge, um Beziehungen zum Himmel. Auch wenn gläubige Christen in dieser Welt nicht viel gelten, so sind doch ihre Namen im Himmel angeschrieben. Weiter dürfen wir den Herrn Jesus als Sohn des Vaters kennen und etwas von der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn in der Gottheit wissen. Nachdem sein Volk Ihn als Messias abgelehnt hatte, offenbarte Er sich den Wenigen, die an Ihn glaubten, und zeigte ihnen das, wovon die Glaubenden des Alten Testaments noch nichts wussten.
Die Jünger damals waren tatsächlich glückliche Leute. Sie haben Den mit eigenen Augen gesehen, auf den Propheten und Könige gehofft hatten. Zudem durften sie von Ihm hören, dass Er nicht nur der Christus (der Messias), sondern auch der Sohn des Vaters ist. Doch um diese Person wirklich mit dem Herzen zu erfassen, braucht es Glauben.
Der barmherzige Samariter
Welche Antwort gab der Herr dem Gesetzgelehrten, als er Ihn fragte, was er tun müsse, um ewiges Leben zu erben? Er stellte ihm das Gesetz vor, und der Fragesteller zeigte, dass er die wesentlichen Punkte des Gesetzes erfasst hatte: Gott lieben und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Der Herr konnte darauf nur sagen: «Tu dies, und du wirst leben.» Die rechtfertigende Frage des Gesetzgelehrten zeigt, dass er nicht ohne Weiteres bereit war, jeden, dem er begegnete, wie sich selbst zu lieben.
Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter stellte sich der Herr selbst und sein Handeln in Gnade vor. Wir dürfen von Ihm lernen und uns in seiner Gesinnung unseren Mitmenschen gegenüber verhalten.
Der Mensch, der unter die Räuber fiel, stellt uns Menschen von Natur dar. Wir haben uns von Gott weg gewandt und den Weg der Sünde eingeschlagen. Die Folgen sind schlimm. Nur einer kann da noch helfen: unser Heiland, der sich in Barmherzigkeit zu uns neigt. Er hat ein Heilmittel für die Wunden. Er giesst Öl und Wein darauf und verbindet sie. So kümmert Er sich heute noch um den einzelnen Sünder. Er will ihm Heil und Vergebung und ewiges Leben schenken. Doch die Fürsorge des Herrn Jesus beschränkt sich nicht auf die Bekehrung eines Menschen. Wer Ihn als Retter erfahren hat, erlebt Tag für Tag seine Fürsorge auf dem Glaubensweg, bis Er wiederkommt. Welch eine Gnade und Liebe!
Martha und Maria
Im Gegensatz zum Pharisäer Simon in Lukas 7 lud Martha den Herrn Jesus mit dem aufrichtigen Wunsch, Ihm zu dienen, in ihr Haus ein. Ihre Schwester Maria, die wie sie an Christus glaubte, benutzte diese schöne Gelegenheit, um sich auch zu den Füssen Jesu niederzusetzen und auf seine Worte zu hören. Sie wollte Ihm nicht nur dienen, sondern vor allem etwas von Ihm für ihr Herz empfangen.
Diese Frau zeigt uns, wie wichtig es ist, beim Herrn Jesus zur Ruhe zu kommen. Erst dann können wir beim Lesen seines Wortes wirklich auf seine Stimme hören. Man kann die Bibel nicht im Stehen oder im Vorbeigehen lesen. Um den Segen daraus zu empfangen, brauchen wir Zeit und Ruhe. Wir wollen uns doch bemühen, regelmässig diesen Platz zu den Füssen unseres Herrn einzunehmen, um von Ihm geistlich gesegnet zu werden (5. Mose 33,3).
Und Martha? Sie meinte es gut mit ihrem hohen Gast. Aber durch ihr vieles Dienen wurde sie von Ihm abgezogen. Das musste Er ihr klarmachen. Gleicht sie nicht vielen eifrigen Christen, die nur an das Dienen – an christliche Aktivität – denken, aber kaum Zeit finden, beim Herrn und vor seinem Wort zur Ruhe zu kommen? Vielleicht gilt seine Ermahnung: «Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge; eins aber ist nötig», sogar mir oder dir! Martha hatte die Lektion gelernt und später ihren Dienst an den richtigen Platz gestellt (Johannes 12,1.2).
Herr, lehre uns beten!
Die Jünger sahen, wie ihr Meister oft im Gebet war. Da kam der Wunsch auf: «Herr, lehre uns beten.» Die Apostel kannten damals noch nicht das Vertrauensverhältnis eines Kindes zum Vater, wie wir Christen dies zu Gott haben. Wir dürfen jederzeit mit allem, was uns beschäftigt, zu Gott, unserem Vater, kommen. Auch wenn wir einmal nicht wissen, wie und was wir beten sollen, dürfen wir Ihm dies sagen.
Ab Vers 5 illustriert der Herr seinen Jüngern und uns, dass wir im Gebet zu Gott «kühn» sein dürfen. Manchmal wünscht Er von uns sogar, dass wir durch anhaltendes Flehen zeigen, wie ernst es uns mit unserem Anliegen ist und ob wir auf seine Hilfe warten können.
Vers 9 macht deutlich, dass Er unser Bitten, unser Suchen oder unser Anklopfen nicht unbeantwortet lassen wird. Aber vielleicht müssen wir zuerst beweisen, dass wir echt Bittende, Suchende oder Anklopfende sind, d.h. solche, die nicht nach der ersten Bitte, wenn sie nicht sofort erhört wird, wieder aufgeben, sondern im Gebet anhalten.
Und wie fällt die Antwort unseres himmlischen Vaters aus? Immer so, dass es nur zu unserem Guten, nie zu unserem Schaden ist. Wir geben unseren Kindern auch nur das, was gut für sie ist und ihnen nicht schadet.
Die Jünger hatten damals den Heiligen Geist noch nicht. Darum war es richtig, so zu bitten. Heute aber empfängt jeder Glaubende den Geist Gottes (Epheser 1,13). Wir müssen nicht mehr darum bitten.
Christus ist stärker als Satan
Der Herr heilte einen von einem Dämon besessenen stummen Mann. Nachdem der böse Geist von ihm ausgefahren war, konnte dieser Mensch plötzlich reden. Die einen verwunderten sich. Andere versuchten das Wunder dadurch zu erklären, dass sie behaupteten, der Herr stehe mit Satan im Bund. Darum könne Er Dämonen austreiben. Welch eine Lästerung des Sohnes Gottes!
In seiner Gnade verurteilte der Herr die Menschen, die derart böse Gedanken über Ihn hatten, nicht einfach, sondern versuchte ihnen zu zeigen, wie absurd ihre Überlegungen waren. Jedes Reich, das gegen sich selbst kämpft, zerstört sich selbst. Nein, Er trieb die Dämonen nicht durch den Fürsten der Dämonen, sondern durch den Finger Gottes aus! Wie gern hätte Er durch seine Beweisführung ihre Herzen und Gewissen erreicht und sie zur Buße geführt.
Im Weiteren deutete Er an, dass Er der Stärkere ist, der den Starken (Satan) besiegt. Dies geschah am Kreuz, als Er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat (Hebräer 2,14).
Die Verse 24-26 illustrieren den Zustand des Volkes Israel. Lange Zeit wurde es vom Geist des Götzendienstes beherrscht. Aber zur Zeit, als Christus hier lebte, gab es keinen Götzendienst. Doch anstatt Ihn als Messias anzunehmen, blieb das «Haus» Israel leer. Jener böse Geist wird in der Endzeit zurückkehren und es unter dem Antichristen schlimmer treiben als je zuvor. Das Letzte des ungläubigen Volkes Israel wird schlimmer sein als sein Anfang.
Kein Zeichen für den Unglauben
Mit «diesem Geschlecht» wird nicht pauschal das ganze Volk bezeichnet, sondern die Masse der Ungläubigen. Sie sind ein böses Geschlecht. Sie wollen Zeichen sehen, aber nicht glauben.
Was sollen wir unter dem Zeichen Jonas verstehen? Der Herr selbst vergleicht seinen Tod, sein Begrabenwerden und seine Auferstehung mit dem, was Jona erlebt hatte (Matthäus 12,40). Er, der Sohn des Menschen, ist das Zeichen, das dem Volk Israel gegeben wird (Matthäus 24,30). Dann sprach Er von Menschen, die viel weniger gesehen hatten als die Juden damals und doch glaubten: die Königin des Südens und die Männer von Ninive. Bei den Zuhörern des Herrn Jesus aber, die das Vorrecht hatten, den Sohn des Menschen zu sehen und zu hören, fand sich weder Buße noch Glauben.
Der Herr Jesus war «das Licht der Welt» (Johannes 8,12). Alle konnten es sehen. Damit das Licht aber seine Wirkung in dem haben kann, der es sieht, ist ein lauteres Auge nötig. Das einfältige Auge des Glaubens sieht Jesus Christus, wie Er uns in der Bibel gezeigt wird, und stellt keine kritischen Fragen. Wer Ihn ohne Vorbehalte annimmt, ist «Licht in dem Herrn» (Epheser 5,8) und darf anderen leuchten.
Nicht nur ein «böses Auge», d.h. offener Unglaube, sondern auch eine halbfromme Sache ist gefährlich. Äusserliche Veränderungen ohne Glauben, ohne neues, ewiges Leben, lassen die Seele im Finstern (Vers 35).
Göttliches Urteil über religiöse Führer
Ein weiteres Mal war der Herr Jesus bei einem Pharisäer zu Gast. Die Kritik des Gastgebers an seinem Gast – zwar erst in Gedanken – veranlasste den Herrn, ernste Worte sowohl an die Pharisäer als auch an die Gesetzgelehrten zu richten. Beide Gruppen waren bei jenem Essen zugegen.
Den Pharisäern warf der Herr Heuchelei vor. Sie legten grossen Wert auf eine übermässig genaue äussere Erfüllung des Gesetzes. Aber wie sah es in ihrem Herzen aus? Die Augen des Herrn sahen in ihr Inneres und stellten dort Habsucht (Raub) und Bosheit fest. Das Recht und die Liebe Gottes bedeuteten ihnen nichts. Ein weiterer Punkt, den ihnen der Herr vorwerfen musste, war ihr Hochmut. Wenn immer möglich liessen sie sich von den Mitmenschen als besonders fromme Leute verehren. Aber Gott sah tiefer.
Die Gesetzgelehrten legten schwere Lasten (des Gesetzes) auf andere, während sie sich aus allen Schwierigkeiten heraushielten. Indem sie die Grabmäler der Propheten schmückten, suchten sie ihre eigene Ehre. Aber auf die Worte jener Propheten, die immer noch Gültigkeit hatten, hörten sie nicht. Indem diese Lehrer das, was sie lehrten, weder glaubten noch praktizierten, nahmen sie «den Schlüssel der Erkenntnis» weg. War es im Mittelalter nicht ganz ähnlich? Da wurden die Bibeln sozusagen in die Klöster eingeschlossen. Die Menschen hatten kaum eine Ahnung mehr vom Inhalt des Wortes Gottes.
Wie schlimm war die Reaktion dieser Leute, die so ins Licht gestellt worden waren!
Heuchelei und Menschenfurcht
Die Worte, die der Herr in diesem Kapitel an seine Jünger richtet, beziehen sich auf die Zeit nach seiner Rückkehr in den Himmel. Es sind Warnungen, Mahnungen und Ermunterungen.
In den ersten Versen geht es um Heuchelei. Ausgangspunkt dafür war die Heuchelei der Pharisäer. Doch wir alle müssen uns davor hüten, und wir wollen uns daran erinnern, dass Gott alles ans Licht bringen wird.
Ab Vers 4 ermuntert der Herr die Seinen, die Er seine Freunde nennt, sich nicht vor dem Widerstand und der Verfolgung der Menschen zu fürchten. Sie können nur bis zur Tötung des Körpers gehen. Gott aber, dessen Gewalt weit darüber hinausgeht, sorgt für einen jeden der Seinen. Er vergisst keinen! Ja, Gott ist für uns. Möge dies uns ermuntern, dem Herrn treu zu bleiben, auch wenn es schwierig wird.
Der grösste Beweis für die Wahrheit in Vers 10 ist der Apostel Paulus und das Volk der Juden. Paulus, der einst meinte, «gegen den Namen Jesu, des Nazaräers, viel Feindseliges tun zu müssen», kam zur Umkehr und fand Gnade und Barmherzigkeit. Die Juden aber haben den Herrn verworfen und gekreuzigt und dabei auch den Heiligen Geist gelästert. Nach seiner Auferstehung lehnten sie auch das Zeugnis des Heiligen Geistes durch die Apostel und durch Stephanus ab. Für das Volk als Ganzes blieb keine Hoffnung mehr. Die Schuld blieb unvergeben, und daher folgte das göttliche Gericht.
Habsucht
Nachdem das Volk den Herrn Jesus als Messias abgelehnt hatte, weigerte Er sich, in Israel Recht zu sprechen. Aber Er benutzte die Gelegenheit, ein ernstes Wort über Habsucht zu sagen. Die Neigung, das Geld zu lieben, steckt in jedem von uns. Wenn der Herr uns materiellen Segen schenkt, stehen wir dann nicht in Gefahr, uns in einer gewissen Sicherheit zu wiegen?
Im daran anschliessenden Gleichnis kommt deutlich zum Ausdruck, wie gefährlich es ist, sich auf das Sichtbare zu stützen und dabei seine Seele und die Beziehung zu Gott zu vernachlässigen.
Diese Geschichte will uns sicher in erster Linie die Situation eines ungläubigen Menschen schildern, der nur für das diesseitige Leben lebt und nur an das Sichtbare denkt. Was er in Vers 19 zu seiner Seele sagt, gilt eigentlich seinem Körper. Die Bedürfnisse seiner unsterblichen Seele hatte er völlig ausser Acht gelassen. Darum war er in Gottes Augen ein Tor.
Wir wollen aber nicht denken, dieses Gleichnis habe uns Glaubenden nichts zu sagen. Wie mancher gläubige Christ konzentriert seine Kraft auf das irdische Leben. Die berufliche Karriere und der dadurch mögliche Wohlstand beherrschen ihn. Für die Belange des Herrn bleiben kaum noch Kraft und Zeit. Wenn unser Leben als Glaubende in dieser Weise verläuft, verkümmert unsere Seele und wir sind nicht reich in Bezug auf Gott.
Lebenssorgen
Durch das Wort «deshalb» verbindet der Herr die folgenden Hinweise an seine Jünger mit dem, was Er soeben im Blick auf die Habsucht gesagt hat. Solange wir auf dieser Welt leben, müssen wir uns mit den materiellen Belangen beschäftigen. Wir kommen nicht darum herum. Doch wir sollen uns sowohl vor dem Geist der Habsucht als auch vor dem Sorgengeist hüten. Sind wir nicht Kinder des himmlischen Vaters? Er weiss, was wir an Materiellem auf dieser Erde nötig haben, und wird dafür sorgen. Wir können ganz unbesorgt sein.
Die Natur um uns her beweist uns täglich, wie Gott als Schöpfer für seine Geschöpfe sorgt. Wie viel mehr wird Er sich um seine geliebten Kinder kümmern. Sind sie Ihm nicht mehr wert als die Vögel? Und zudem: Können wir mit unseren Sorgen irgendetwas verändern? Nein, überhaupt nicht. So gesehen sind die Sorgen völlig nutzlos.
Wenn Gott uns die Sorgen abnimmt, dann ermuntert Er uns gleichzeitig, nach dem Reich Gottes zu trachten. Wie ist das zu verstehen? Im Reich Gottes hat der Herr das Sagen. Da geht es um seine Sache. Nun möchte Gott, dass wir unsere Arbeit und die Aufgaben des gegenwärtigen Lebens für den Herrn, nach seinem Sinn und Willen erfüllen, und nicht für uns selbst. Die ungläubigen Menschen leben für sich selbst. Sie haben nur das Diesseits im Auge. Wir dürfen uns für den Herrn und für das einsetzen, was Ewigkeitswert hat.
Schätze sammeln und warten
Als Gläubige werden wir in der Welt immer in der Minderheit sein. Darum der Ausdruck: «Du kleine Herde.» Aber wie reich sind wir! Wir sind Kinder und Söhne, ja, Erben Gottes. Unsere Bestimmung ist nicht diese Erde, sondern der Himmel. Wir dürfen unsere irdischen Güter uneigennützig dazu verwenden, anderen Gutes zu tun. Unser Schatz – Christus und alles, was wir in Ihm besitzen – ist ja im Himmel, wo wir ihn nicht mehr verlieren können.
Die Frage ist nur: Sieht man das an unserem praktischen Verhalten? Wird unser Herz wirklich zum Himmel gezogen, wo unser Schatz ist? Oder ist unser Christenleben von der Erde oder gar von den Ideen der Welt geprägt?
Bis heute ist unser Herr, an den wir glauben, abwesend. Doch Er hat verheissen wiederzukommen. Von dieser Zeit, in der wir als Wartende und Dienende hier leben, reden die Verse 35-40. Dabei sind umgürtete Lenden das Kennzeichen eines Knechtes, der zum Dienst bereit ist, während die brennenden Lampen ein Bild unseres Zeugnisses für unsere Mitmenschen sind. Und während wir an der Arbeit für Ihn sind, dürfen wir Ihn täglich, ja, in jeder Wache der Nacht, erwarten.
Wenn Er dann kommt und uns so findet, wie Er es von uns erwartet, werden nicht nur Freude und Glück herrschen, dann wird Er uns für die Wachsamkeit im Dienst noch belohnen. Er selbst will sich wie ein Knecht umgürten und uns bedienen. Unvorstellbare Gnade!
Gute und böse Knechte
Die Zeit der Abwesenheit unseres Herrn ist die Zeit unserer Verantwortung. Möchten wir alle zu den treuen und klugen Verwaltern zählen! Jeder von uns hat eine Aufgabe vom Herrn. Diese besteht einfach darin, den Platz in Treue auszufüllen, an den Er uns gestellt hat, z.B. als Hausfrau und Mutter. – In Vers 37 fanden wir die Belohnung für die Wachsamkeit: Er selbst! In Vers 44 haben wir jetzt die Belohnung für die Treue im Dienst. Sie besteht im Teilhaben an seiner Herrschaft.
In den Versen 45-48 zeichnet der Herr ein düsteres Bild der bekennenden Christenheit. Sie hat den Gedanken an das Wiederkommen des Herrn weitgehend aufgegeben. Dadurch ging die himmlische Gesinnung verloren. Sie hat einem weltlichen Christentum Platz gemacht.
Wenn wir bei jenem Knecht in Vers 45 an jene denken, die die Herde Gottes hüten sollten, wie viel Selbstherrlichkeit und Eigenmächtigkeit haben sich da eingeschlichen! Nicht umsonst warnt Petrus die Ältesten: «Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist … nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, und nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind» (1. Petrus 5,2.3).
Das in den Versen 47 und 48 angekündigte Gericht ist das der Lebendigen bei der Erscheinung des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Es wird absolut gerecht sein. Das Urteil wird entsprechend der empfangenen Vorrechte gefällt. Wie schlimm wird das Ende derer sein, die viel wussten, aber nach ihrem eigenen Willen lebten!
Die Zeit erkennen
Bei der Ankündigung der Geburt des Heilands verkündeten die Engel: «Friede auf Erden.» Doch die Menschen wollten Christus nicht. Die Folge davon war Hass und Entzweiung. Das wird deutlich, wenn sich in einer Familie jemand bekehrt. Sofort regt sich Widerstand von den übrigen, noch ungläubigen Familiengliedern.
Mit der Taufe in Vers 50 meint der Herr seinen Sühnungstod für uns. Aber was konnte das Herz des Heilands bis dahin beengen? Die vollkommene, unendliche Liebe Gottes war sozusagen in Ihm eingeschlossen. Sie konnte erst ungehindert fliessen, nachdem das Problem der Sünde durch seinen Opfertod gelöst war.
Bis jetzt war das ganze Kapitel an seine Jünger gerichtet (Lukas 12,1). Ab Vers 54 richtet sich der Herr an die Volksmengen. Die Zeichen Gottes in der Natur konnten sie beurteilen, aber als Er seinen Sohn als Mensch zu ihnen sandte, erkannten sie dies nicht als ein Zeichen seiner Barmherzigkeit (Lukas 1,77-79).
Weil sie seinen Sohn ablehnten, war Gott mit den Juden sozusagen auf dem Weg zum Gericht. Die einzige Möglichkeit, mit Gott, gegen den sie gesündigt hatten, ins Reine zu kommen, war die Annahme des Herrn Jesus als Messias. Doch das Volk als Ganzes blieb bei seiner Verwerfung von Christus. Darum ist es «ins Gefängnis geworfen worden». Es bleibt als irdisches Volk Gottes auf die Seite gestellt, bis Jesaja 40,1.2 erfüllt sein wird. Gott wird nicht von ihnen ablassen, bis sie aus seiner Hand das Doppelte für ihre Sünden empfangen haben.
Echte Buße rettet vor dem Gericht
Wenn wir in der Welt offensichtliches Unrecht sehen, denken wir schnell einmal, Gott müsse mit Gericht eingreifen, oder wir meinen, wenn jemand etwas Besonderes zustösst, er stehe für sein Verhalten unter dem speziellen Gericht Gottes. Bei all diesen Überlegungen kommen wir uns besser vor als die Betroffenen. Dem widerspricht der Herr klar. Er zeigt, dass wir alle ausnahmslos vor Gott schuldig sind. Wer dies nicht einsieht und nicht Buße tut (und an den Erlöser glaubt), wird ins Gericht Gottes kommen und ewig verloren gehen.
Das Gleichnis vom Feigenbaum, den jemand in seinen Weinberg pflanzte, spricht vom Volk Israel. Das irdische Volk Gottes wird sowohl mit einem Feigenbaum als auch mit einem Weinberg verglichen (Joel 1,7). Hier geht es besonders um die Zeit, da Jesus Christus als Mensch unter ihnen lebte. Gott erwartete Frucht von seinem Volk. Doch Er fand keine. Sein Sohn wurde abgelehnt, obwohl dieser sich in Liebe und Gnade um die Menschen kümmerte. Alle Mühen des Heilands waren vergeblich. Keine Frucht für Gott vom Volk als Ganzem, sodass Er den Feigenbaum umhauen, d.h. sein Volk auf die Seite stellen musste.
Mit der Kreuzigung des Herrn Jesus endete die Zeit, da Gott vom natürlichen Menschen etwas erwartete. Der Beweis war erbracht, dass wir völlig versagt haben und unfähig sind, aus uns selbst Gott zu gefallen (Römer 3,19.20). Frucht für Gott kann ein Mensch erst bringen, wenn er Buße getan, geglaubt und neues Leben empfangen hat.
Eine Frau wird am Sabbat geheilt
Auch wenn die Zeit seines öffentlichen Dienstes zu Ende ging, wirkte der Herr doch immer noch in Gnade. Er sah die arme, zusammengekrümmte Frau und befreite sie von ihrer Schwachheit, sodass sie sich aufrichten konnte. Dafür verherrlichte sie Gott. Der Synagogenvorsteher aber getraute sich, den Herrn zu kritisieren. Er wollte, dass zuerst das Gesetz eingehalten wurde. Die Gnade durfte sich nach seiner Meinung nur unter Einhaltung des Sabbatgebots entfalten. Der Herr des Sabbats aber bezeichnete ihn als Heuchler. Wie manches taten diese frommen Leute für ihre Tiere am Sabbat, und Ihm wollten sie verbieten, am Sabbat zu heilen!
Für den Augenblick waren seine Widersacher beschämt, und das Volk freute sich. Damit jedoch niemand auf den Gedanken kam, das Reich würde nun in Herrlichkeit erscheinen, fuhr der Herr fort, die Entwicklung des Reiches, nachdem man den König verworfen hatte, aufzuzeigen.
Wir leben heute in dieser Zeit, und die beiden Gleichnisse zeigen die Entwicklung der Christenheit auf. Sie ist einerseits zu etwas Grossem, in der Welt Anerkanntem geworden. Im Gegensatz zu ihrem Herrn, der demütig und sanftmütig war und den letzten Platz einnahm (Philipper 2,5-8), wurde die Christenheit zu einer Macht, die vielen Schutz und Vorteil bietet. Anderseits ist die Christenheit von der reinen Lehre der Bibel abgekommen und von allen möglichen menschlichen Ideen verseucht worden. Das Böse ist überall eingedrungen.
Bald schliesst sich die Tür
Christus war auf dem Weg nach Jerusalem. Zum letzten Mal durchzog Er diese Städte und Dörfer. – Auf die Frage, ob der Überrest, der errettet werden würde, gross oder klein sei, gab der Herr keine direkte Antwort. Er forderte aber alle auf, sich persönlich zu entscheiden und durch die enge Tür einzugehen, d.h. Ihn als den Verworfenen anzunehmen. Viele werden ins Reich Gottes einzugehen suchen, aber nicht auf dem Weg der Buße und der glaubensvollen Annahme des Verworfenen (und Gekreuzigten). Sie werden dereinst draussen stehen und von Ihm verworfen werden. Das Gericht wird darin bestehen, dass die ungläubigen Juden ihre Vorväter und solche aus den Nationen in die Herrlichkeit des Reiches eingehen sehen, während sie hinausgeworfen werden, weil sie im Unglauben verharrten.
Der Herr liess sich durch die Warnung von Herodes nicht vom Weg des Willens Gottes abbringen. Er führte seinen Dienst unbeirrt weiter. Er musste nach Jerusalem ziehen, um dort ausserhalb der Stadt zu sterben.
Aber dann kam noch eine Wehklage über Jerusalem über seine Lippen. Er sprach hier als Gott, der allein Israel sammeln konnte (Jeremia 31,10). Doch sein Volk hatte seinen Gott (den Herrn) in voller Verantwortung verworfen, wie sie die Propheten verworfen hatten (2. Chronika 36,15.16; Markus 12,6.7).
In der Endzeit wird Er in souveräner Gnade erscheinen. Dann wird der gläubige Überrest Ihn als Messias annehmen.
Demut und Gnade
Zum dritten Mal in diesem Evangelium sehen wir den Herrn Jesus bei einem Pharisäer zu Gast. Wieder waren die Motive der Einladung nicht aufrichtig. Trotzdem nahm der Herr sie in seiner Gnade an.
Den Juden ging es immer wieder um die Einhaltung des Sabbatgebots. Deshalb fragte der Herr, ob es erlaubt sei, am Sabbat zu heilen. Da sie in ihrer Verstocktheit schwiegen, heilte Er den wassersüchtigen Mann. In der Unterweisung von Vers 5 geht es um eine Notsituation, nicht um ein tägliches Bedürfnis (Lukas 13,15). Die traurige Lage, in die der Mensch durch die Sünde gekommen ist, ruft dringend nach Rettung. Ruhe für Gott und den Menschen gibt es erst, wenn die Frage der Sünde gelöst ist.
Die Grundsätze, die der Herr in den Versen 7-14 vorstellt, sollten auch unser Leben als Christen prägen. Lasst uns nicht nach Ansehen und Ehre streben, sondern in der Gesinnung unseres Meisters den letzten Platz einnehmen. Der Herr wird uns helfen, diesen Weg der Demut, der unserem Ich entgegensteht, zu gehen.
Der Herr hatte nicht nur für die Gäste ein Wort, sondern auch für den Gastgeber. Die göttliche Liebe offenbart sich darin, dass Christus für Feinde, für Kraftlose, für Sünder gestorben ist (Römer 5,6-11). Jetzt dürfen wir ein Stück weit in die Fussstapfen unseres Meisters treten, die empfangene Liebe Gottes weitergeben und Gnade üben, ohne eine Gegenleistung oder Anerkennung zu erwarten. Gott selbst hat versprochen, die Vergeltung zu übernehmen.
Das Gastmahl der Gnade
Auf den Ausruf eines Gastes antwortete der Herr mit dem Gleichnis vom grossen Gastmahl der Gnade. Dabei zeigte Er, dass man die Einladung annehmen muss, um zu den Glücklichen zu gehören, die den Segen des Reiches Gottes geniessen dürfen.
Gott hat in seiner Gnade ein grosses Gastmahl für die Menschen bereitet. Am Kreuz auf Golgatha wurde die Grundlage dafür gelegt, dass Sünder zu Gott kommen können. Die erste Einladung erging an die Juden. Viele hatten Entschuldigungen. Es gab in ihrem Leben Wichtigeres als die Einladung zum Festmahl der Gnade. Auch heute bringen Menschen, denen das Evangelium vorgestellt wird, viele Entschuldigungen vor, warum sie es nicht annehmen können oder wollen. Vers 21 macht aber klar, dass jeder, der das Heil im Herrn Jesus ablehnt, den Zorn Gottes zu erwarten hat.
Wie gut, dass Gott sein Angebot nicht zurückzog, als die Juden es ablehnten. Zuerst wurde der Knecht – ein Bild des Heiligen Geistes – auf die Strassen und Gassen der Stadt gesandt. Später wurde der Kreis noch weiter gezogen: die Wege und Zäune. So liess Gott zunächst sein Evangelium am Anfang der Apostelgeschichte den Juden verkünden, die sich ihrer Schuld der Kreuzigung des Messias bewusst wurden. Später erreichte die frohe Botschaft auch die Menschen aus den Nationen.
Das Haus ist noch nicht voll. Aber mit dem Kommen des Herrn zur Entrückung wird die Einladung der Gnade zu Ende gehen.
Die Kosten der Jüngerschaft
Wenn wir an die gestern gelesenen Verse über das grosse Gastmahl der Gnade denken, verstehen wir, dass viele Menschen mit dem Herrn Jesus gingen. Seine Gnade zog sie an. Aber jetzt wendet Er sich um und spricht ihre Verantwortung an. Wer seine Gnade in Anspruch genommen hat, von dem möchte der Herr, dass er Ihm als Jünger nachfolgt.
Was schliesst echte Jüngerschaft in sich? Zunächst macht der Herr klar, dass wir als seine Nachfolger Ihm in unserem Leben den Vorrang geben müssen. Es geht um klare Prioritäten. Unsere nächsten Angehörigen, ja, sogar unser eigenes Leben kommen da erst an zweiter Stelle.
Aber es gilt auch, die Kosten der Nachfolge zu überschlagen. Es wird nicht immer einfach sein, dem Herrn Jesus in dieser Welt, die Ihn verworfen hat, in Treue nachzufolgen. Wenn unser Christsein sich auf einen gesetzlichen Gehorsam gründet, werden wir Schiffbruch erleiden. Wenn wir aber mit dem Herrn und seiner Hilfe – nicht aus eigener Kraft – diesen Weg gehen wollen, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Wenn Er mit uns ist, wird die Nachfolge glücklich und leicht sein.
Zum Schluss vergleicht Er den echten Jünger mit Salz. Nur wenn wir uns in unserem praktischen Leben konsequent von aller Art des Bösen trennen, sind wir für den Meister brauchbar. Unmöglich kann ein untreuer Christ, der Kompromisse mit der Welt eingeht, ein Zeugnis für den Herrn sein.
Das verlorene Schaf, die verlorene Drachme
Die fromme Führungsschicht der Juden kritisierte Jesus, weil Er Sünder aufnahm, die von seiner Gnade angezogen wurden, und mit ihnen ass. Daraufhin zeigte der Herr in einem dreifachen Gleichnis, wie Gott in seiner Gnade an den Menschen wirkt. Gleichzeitig machte Er seinen Zuhörern klar, dass sie alle – ob religiös oder nicht – seine Gnade nötig hatten; denn alle Menschen sind ausnahmslos Sünder vor Gott. Wer aber seine Gnade ablehnt, geht ewig verloren.
Der erste Teil des Gleichnisses zeigt uns die Tätigkeit des Herrn Jesus, des guten Hirten. Er geht dem Verlorenen nach, bis Er es findet, und trägt es dann auf seinen starken Schultern nach Hause. Das verlorene Schaf findet den Rückweg nicht mehr selbst. Ohne die Bemühung der Liebe des Herrn Jesus fände kein Mensch den Weg zu Gott zurück.
Im zweiten Teil sehen wir in der Frau und ihrem Suchen die unermüdliche Tätigkeit des Heiligen Geistes. Die Lampe spricht vom Wort Gottes, das Er auf Herz und Gewissen der Menschen anwendet, um sie zur Buße und zum Glauben an den Erlöser zu führen. Der Sünder wird in diesem Teil mit einem toten Geldstück verglichen, was an Epheser 2,1 erinnert. Obwohl wir in der Sünde lebten, waren wir in Gottes Augen «tot in unseren Vergehungen und Sünden».
Beachten wir, wie in den beiden Teilen dieses Gleichnisses nicht die Freude des erlösten Sünders, sondern die gemeinsame Freude des Himmels betont wird. Wenn ein Mensch Buße tut, gerät der Himmel in Bewegung.
Der verlorene Sohn
Der dritte Teil dieses Gleichnisses ist der ausführlichste. Hier steht die Tätigkeit Gottes, des Vaters, gegenüber dem Sünder im Vordergrund. Der jüngere Sohn, der forderte: «Gib mir …» und dann den Vater verliess, ist ein Bild von uns Menschen, wie wir von Natur sind. Haben wir als Geschöpfe Gottes nicht Forderungen an Ihn gestellt und Ihm doch den Rücken gekehrt? Aber getrennt von Gott kommt der Mensch ins Elend wie der verlorene Sohn. Doch er muss auf den Punkt tiefster Demütigung (ein Jude als Schweinehirt!) und grösster Not (niemand gab ihm) kommen, damit er anfängt nachzudenken.
Als der verlorene Sohn an das Zuhause beim Vater dachte, gab es einen Wendepunkt in seinem Leben. Der Entschluss reifte in ihm, mit einem aufrichtigen Sündenbekenntnis zum Vater zurückzukehren. Dann machte er sich auf und ging zu seinem Vater. Echte, gottgemässe Buße führt zu einer inneren und einer äusseren Umkehr. Der Umkehr im Herzen müssen die Füsse folgen.
Und was traf der Sohn zu Hause an? Der Vater wartete schon lange auf ihn, lief ihm, als er ihn von weitem sah, mit bewegtem Herzen entgegen und schloss ihn liebevoll in die Arme. Welch ein Empfang der Gnade!
Nachdem der Sohn sein sündiges Verhalten bekannt hatte, war nur das Beste gut genug für den, der aufs Neue Sohn des Vaters sein durfte. Wieder steht die gemeinsame Freude im Vordergrund. Dieser Teil des Gleichnisses zeigt, wie sehr sich Gottes Herz freut, seine Liebe über einen Sünder auszuschütten.
Der ältere Sohn
Nur einer nahm an der allgemeinen Freude im Haus des Vaters nicht teil. Der ältere Bruder (der Selbstgerechte) war zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Sein Herz stand draussen. Für die Gnade hatte er nichts übrig. Die Freude seines Vaters teilte er nicht. Er verfolgte seine eigenen Ziele. «Auf dem Feld», in der Welt – fern vom Bereich göttlicher Barmherzigkeit und geistlicher Freude – war er tätig.
Mit diesem Teil des Gleichnisses wollte der Herr Jesus den murrenden Pharisäern zeigen, was sie in sich selbst waren. Der ältere Sohn ist aber auch ein Bild von jedem, der dem Namen nach ein Christ ist und sich bemüht, religiös zu leben, aber weder Buße getan noch sich bekehrt hat. Solche Menschen meinen, Gott müsse mit ihnen zufrieden sein. Und wenn Er sie einladet, auch zum Fest der Gnade zu kommen, versteigen sie sich so weit, dass sie Gott Vorwürfe machen.
Wie gross ist Gottes Langmut! Sie wird darin sichtbar, was jener Vater alles versuchte, um seinen älteren Sohn zu gewinnen. Warum wollte er nicht? Wenn ein so grosser Sünder wie sein jüngerer Bruder hineingehen durfte, dann galt ja seine ganze Rechtschaffenheit nichts. Ja, so ist es. Wo die Freude Gottes herrscht, kann die Selbstgerechtigkeit nicht eintreten. Im Himmel wird es einmal nur begnadigte Sünder, keine Selbstgerechten geben. Die Erlösten werden ewig die Gnade rühmen, der sie alles verdanken. Die Gnade ist in der Person Jesu gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu erretten.
Der untreue Verwalter
Um diesen Abschnitt richtig zu verstehen, müssen wir daran denken, dass der Herr hier zu seinen Jüngern spricht. Es geht um das Verhalten von gläubigen Menschen, während sie noch auf der Erde, in der Welt leben, aber nicht mehr von ihr sind.
Mit dem Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde ging die Erprobung des Menschen durch Gott zu Ende. Mit welchem Resultat? Wir haben uns als Verwalter von dem, was Gott, unser Schöpfer, uns anvertraut hat, als völlig untreu erwiesen. Versagen in jeder Hinsicht! Was nun?
Jesus Christus hat uns die Gnade gebracht. Sie kommt jedem zugut, der sich in Buße und im Vertrauen zu Ihm wendet. So wird jeder Glaubende für den Himmel gerettet. Das Gleichnis zeigt uns nun, wie wir als Himmelsbürger mit den materiellen Gütern umgehen sollen. Der Herr lobte nicht die Ungerechtigkeit dieses Verwalters, sondern sein Handeln im Blick auf die Zukunft. Davon sollen wir lernen.
Alles Materielle, das wir als Gläubige hier besitzen, ist «das Fremde». Es gehört eigentlich nicht uns. Aber wir sollen es im Blick auf den Himmel verwalten und verwenden. Anstatt uns ans Geld zu klammern und möglichst viel für uns zusammenzukratzen, dürfen wir es verwenden, um Liebe zu üben. Gott hat uns nicht ewiges Leben gegeben, um als Gläubige möglichst viel Geld zu verdienen, sondern um die Gnade weiterzugeben und dabei von den materiellen Mitteln, die wir haben, guten Gebrauch zu machen.
Ein Blick ins Jenseits
Die Geld liebenden Pharisäer, die alles hörten, was der Herr den Jüngern über die materiellen Güter sagte, nahmen seine Worte überhaupt nicht ernst. Nun musste der Herr ihnen ihre Selbstgerechtigkeit vorhalten. Aber Er zeigte ihnen auch, dass die Zeit des Gesetzes durch das «Reich Gottes» abgelöst wird. In diesen Bereich kommt der Mensch nur durch Buße und Glauben. Wer diesen Weg, den die Gnade zeigt, jedoch ablehnt, bleibt unter dem Gesetz und all seinen Forderungen.
Mit der Erzählung ab Vers 19 zeigt der Herr was im Jenseits folgt, und zwar als Konsequenz unseres irdischen Lebens. Der reiche Mann lebte nur für das diesseitige Leben. Er genoss alles, was es zu geniessen gab. Um Gott kümmerte er sich nicht, denn sein Name war bei Gott nicht bekannt. Den armen Mann aber kannte man im Himmel mit Namen. Lazarus bedeutet: «Mein Gott ist Hilfe.» Seine notvollen Umstände führten ihn sicher dahin, seine Zuflucht bei Gott zu suchen. Er wurde nicht enttäuscht.
Nach dem Tod dieser ungleichen Menschen waren ihre Rollen vertauscht. Lazarus war am Ort des Glücks und der reiche Mann am Ort der Qual. Es gab keine Möglichkeit mehr, die Lage zu ändern (Prediger 11,3).
Nun dachte er an seine Brüder. Er meinte, wenn Lazarus als Auferstandener zu ihnen ginge, würden sie sich warnen lassen. Abraham aber verwies auf die Autorität des geschriebenen Wortes. Vers 31 bestätigte sich in der Apostelgeschichte. Jesus war auferstanden. Doch die Masse der Juden liess sich nicht überzeugen.
Vergebung, Glaube, Dienst
Der Weg des Glaubens durch diese Welt ist kein einfacher. Da gibt es viele Ärgernisse, d.h. manches, wodurch wir zu Fall kommen können. Jakobus schreibt: «Wir alle straucheln oft.» Auslöser dafür können Ungläubige sein. Sie stellen eine besondere Gefahr für die dar, die noch nicht lange gläubig sind. Doch auch als Glaubende können wir dem Bruder ein Hindernis sein. Daher die Ermahnung: «Habt Acht auf euch selbst», indem ihr euch misstraut und Selbstgericht übt. Dem Bruder gegenüber aber soll uns eine Gesinnung der Vergebung prägen. Also Wachsamkeit gegenüber uns und Gnade gegenüber anderen!
Die Apostel merkten, dass die Verwirklichung dieser Grundsätze Glaubensenergie erforderte. Darum ihre Bitte: «Mehre uns den Glauben!» Die Antwort des Herrn könnte man mit folgenden Worten wiedergeben: Es kommt nicht auf die Grösse eures Glaubens an. Wichtig ist, dass der Glaube Gott in die Umstände hineinbringt (Markus 9,23). Er ist die Quelle der Kraft. Sie liegt nicht in uns.
Vertrauen zu Gott und Gehorsam zum Herrn Jesus sind eng miteinander verbunden. Der Herr möchte von uns als seinen Knechten, dass wir Ihm gehorchen. Und wenn wir getan haben, was Er uns aufgetragen hat, wollen wir sagen: «Wir sind unnütze Knechte.» Das Gegenteil einer solchen Aussage wäre die Erwartung einer Belohnung. Doch wir wollen nicht vergessen, dass der Herr sein Werk auch ohne uns tun könnte. Wenn Er uns gebrauchen will, ist es eine Gnade, und wir wollen Ihm dienen, weil wir Ihn lieben.
Zehn Aussätzige
In der Geschichte mit den zehn Aussätzigen, die geheilt wurden, wird deutlich, wie die Zeitperiode des Gesetzes zu Ende ging und die neue Zeit der Gnade eingeführt wurde.
Alle zehn Männer standen auf dem Platz, den das Gesetz dem Aussätzigen anwies (3. Mose 13,45.46). Aus Distanz riefen sie den Herrn um Erbarmen an. Wie reagierte der Heiland? Er forderte sie zu einem Glaubensschritt auf. Alle zehn befolgten seine Anweisung, machten sich auf den Weg zum Priester und wurden gereinigt.
Sicher freuten sich alle über ihre Heilung und waren dankbar. Aber einer kehrte auf der Stelle um. Er wollte nicht nur das Geschenk der Heilung geniessen, sondern dem Geber danken. Indem er laut Gott verherrlichte, kehrte er zum Herrn Jesus zurück, fiel Ihm in Huldigung zu Füssen und dankte Ihm. Der Herr nahm seinen Dank und die Anbetung Gottes an und schickte ihn nicht mehr zum Priester. Er stand nun auf dem Boden der Gnade und nicht mehr unter Gesetz. Das Wort des Herrn entliess ihn in die Freiheit der Gnade.
Und die anderen, nach denen der Herr fragte? Sie gingen zum Priester, damit er sie für rein erklären konnte. Sie erkannten wohl die Kraft, die sie gesund gemacht hatte, aber sie blieben in ihren religiösen Gewohnheiten und Verbindungen. Sie fanden nicht zur Quelle der Kraft zurück. Diese neun gleichen Christen, die mit dem Heil im Herrn Jesus zufrieden sind, aber nie zu wahrer Anbetung kommen. Wie traurig für das Herz des Herrn!
Das zukünftige Erscheinen des Herrn
Die Pharisäer bekamen auf ihre Frage: «Wann kommt das Reich Gottes?», eine klare Antwort. Das Reich Gottes war in der Person seines Königs mitten unter ihnen. Weil Er aber in Gnade und nicht in Macht und Herrlichkeit gekommen war, lehnten sie Ihn ab und verwarfen Ihn.
Die Worte, die der Herr anschliessend an die Jünger richtete, betrafen die Zeit seiner Verwerfung und Abwesenheit von dieser Erde. Es würden schwere Tage für sie kommen, sodass sie die Zeit von damals, als Er unter ihnen weilte, zurückwünschten. Trotz der Schwere der Zeit und der Gefahr der Verführung versicherte ihnen der Herr, dass Er einmal in Herrlichkeit erscheinen würde. Aber nicht jetzt. Nun war Er auf dem Weg zum Kreuz.
Ab Vers 26 beschreibt Er ihnen die Endzeit. Mit seinem Kommen als Sohn des Menschen in Herrlichkeit wird ein Gericht über die Menschen hereinbrechen wie in den Tagen Noahs oder Lots. Dieses Gericht wird plötzlich und mit Sicherheit kommen. Für menschliche Überlegungen wird dann keine Zeit mehr bleiben. Der Herr selbst wird das Gericht über die dann lebenden Menschen ausüben (Matthäus 25,31-46). Die einen werden genommen und gerichtet werden. Die anderen, die zum treuen Überrest gehören und zu denen, die das Evangelium des Reiches angenommen haben, werden für den Segen des Tausendjährigen Reiches gelassen werden.
Die Witwe und der ungerechte Richter
Das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter gehört noch zu dem, was der Herr in Kapitel 17 über die Endzeit sagte. Die Witwe stellt die treuen jüdischen Zeugen in der Zukunft dar, die von den ungläubigen Volksgenossen und vom Antichristen schlimm bedrängt werden. Dieser gläubige Überrest wird Gott inständig um Hilfe anrufen und ein gerechtes Gericht über seine Widersacher fordern.
Dieser Abschnitt enthält aber auch eine allgemeine Belehrung für uns. Das Wort des Herrn, allezeit zu beten und nicht zu ermatten, gilt für alle Erlösten. Jeder von uns macht hin und wieder die Erfahrung, dass alle Umstände gegen ihn sind. Aber Gott ist für uns. Zu Ihm dürfen wir allezeit mit allen unseren Nöten und Schwierigkeiten kommen. Und wenn Er nicht sofort erhört, wie wir dies erwarten, dann lasst uns im Gebet nicht ermatten, sondern festhalten: Er ist für uns.
Wie schön ist der Ausdruck «seine Auserwählten». Ja, das sind wir! Vor Grundlegung der Welt hat Er uns auserwählt, um in den Genuss seiner Liebe zu kommen (Epheser 1,4). Könnte es da sein, dass Er uns seine Hilfe versagen würde? Nein, Er wird uns niemals im Stich lassen.
Aber wie steht es mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen zu Ihm? Beten wir nicht manchmal für eine Sache und trauen dem Herrn die Erhörung doch nur halbherzig zu? Denken wir an die Versammlung in Jerusalem, als sie für Petrus im Gefängnis betete! (Apostelgeschichte 12,5.14-16).
Der Pharisäer und der Zöllner
Mit diesem Gleichnis wollte der Herr deutlich machen, dass Selbstgerechtigkeit Gott missfällt, aber Demut und Beugung wegen unseren Sünden Ihm wohlgefällt. Der Pharisäer war kein Gottloser. Aber er betete bei sich selbst, obwohl er Gott anredete. Er hielt Gott eine Lobrede über seine eigenen Vorzüge, aber dankte Ihm nicht für das, was Gott ist und was er von Ihm empfangen hatte.
Der Zöllner hatte sich im Licht Gottes als ein Sünder erkannt. Was konnte er tun? Seine Hoffnung lag bei dem, in dessen Licht er sich erkannt hatte. Und so beugte er sich vor Gott und bekannte Ihm seinen Zustand. Dann hoffte er auf seine Barmherzigkeit, flehte um Gnade und wurde nicht enttäuscht.
Seit jenem Gleichnis hat der Herr Jesus das Werk der Erlösung vollbracht. Keiner, der sich als Sünder vor Gott erkennt, muss jetzt auf Abstand bleiben. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Wer mit dem aufrichtigen Bekenntnis seiner Sünden zum Heiland kommt, empfängt Heil und Vergebung.
Die Jünger meinten, kleine Kinder seien zu unwichtig für den Herrn Jesus. Er aber zeigte ihnen, wie wertvoll Ihm diese sind. Dann belehrte Er seine Zuhörer anhand der Kinder über den Eintritt ins Reich Gottes. Nur der kann da eingehen, der nicht auf sich selbst vertraut, sondern die Wahrheit von Gott so aufnimmt, wie ein Kind auf ein Wort seiner Mutter hört.
Verkaufe alles und folge mir nach!
Dieser Oberste hatte sich schon sehr viel Mühe gegeben. Er meinte jedenfalls, er hätte die zehn Gebote von seiner Jugend an befolgt. Doch er war trotz allem nicht befriedigt, oder er erwartete vom Herrn Jesus eine Bestätigung für sein bisheriges Verhalten. Jedenfalls kam er fragend zu Ihm. Aber er sah in diesem einfachen, demütigen Menschen nur einen guten Lehrer, der ihm weiterhelfen konnte. Er erkannte Ihn weder als Messias noch als Sohn Gottes. Wusste er überhaupt, was Sünde und was Gnade ist? Nein, er kannte weder sich noch Gott.
Nun stellte der Herr sein Herz auf die Probe. Da zeigte sich, wie er seine Reichtümer liebte und wie er in sich keine Kraft hatte, das Gute zu tun. Betrübt kehrte er dem Herrn den Rücken.
Als Folge davon deckte der Herr zwei wichtige Tatsachen auf:
- Irdische Reichtümer bilden eine grosse Gefahr. Sie können einen Menschen daran hindern, sich als verlorener Sünder zu erkennen und die Gnade anzunehmen.
- Wenn es auf den Menschen ankommt, ist es unmöglich, dass irgendjemand errettet wird. Die Errettung ist ausschliesslich ein Werk Gottes. Sie basiert auf dem Erlösungswerk seines Sohnes am Kreuz von Golgatha.
Auf die Frage von Petrus versicherte ihm der Herr, dass Nachfolge keinen Verlust bedeutet. Jeder Verzicht, der um des Reiches Gottes Willen in Kauf genommen wird, wird in vielfachen Gewinn umschlagen.
Ein Blinder am Weg
Wir sind im Lauf dieses Evangeliums immer wieder der Gnade Gottes, die der Herr Jesus uns Menschen brachte, begegnet. Damit Gott uns aber wirklich Gnade erweisen und sündige Menschen erretten kann, war der Sühnungstod von Jesus Christus unerlässlich. Ein lebender Christus hätte uns nicht helfen können. Darum redete der Herr von seinem bevorstehenden Tod und dessen Begleitumständen, aber auch von seiner Auferstehung. Seine Auferstehung bestätigte die Vollgültigkeit seines Erlösungswerks. Die Herzen der Jünger aber waren so von den Gedanken des Reiches in Herrlichkeit erfüllt, dass die Worte über seinen Tod an ihnen abprallten.
Vor den Toren Jerichos sass ein blinder Bettler, der in Jesus mehr als den Nazaräer sah. Er erkannte Ihn als den Sohn Davids, den Messias, und rief Ihn um Erbarmen an. Er wurde nicht enttäuscht. Die Menschen empfanden sein lautes Rufen als Störung und wollten ihn zum Schweigen bringen. Aber für den Blinden war dies nicht nur eine einmalige, sondern auch die letzte Gelegenheit, dem Herrn Jesus zu begegnen. Diese wollte er sich auf keinen Fall entgehen lassen.
Wenn sich heute ein Mensch im Bewusstsein seiner Sünden bekehren will, stellen sich ihm oft auch Hindernisse in den Weg. Freunde und Bekannte warnen ihn davor, fromm zu werden. Aber wie gut, wenn er sich wie dieser Blinde nicht aufhalten lässt. Als Sehender wurde er ein freudiger Nachfolger des Herrn mit einem Herzen voll Lob und Dank zu Gott.
Zachäus
In Jericho gab es noch ein Herz, das Verlangen nach dem Herrn Jesus hatte. Der reiche Oberzöllner Zachäus wünschte den Heiland zu sehen. Auch er musste Hindernisse überwinden, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Als er dann auf dem Baum sass, sah er nicht nur Jesus. Dieser sah vor allem ihn. Noch heute sind die Augen des Herrn auf den Elenden gerichtet und auf den, der vor seinem Wort zittert (Jesaja 66,2).
Nun hörte Zachäus ein Wort, das seine kühnsten Erwartungen übertraf. Jesus blickte ihn nicht nur an. Er wollte zu ihm nach Hause kommen. Welch eine Freude für Zachäus, diesen Gast willkommen zu heissen! – Nicht alle freuten sich darüber. Die meisten murrten und sagten: Er ist zu einem sündigen Mann eingekehrt. Sie kannten ihr eigenes Herz schlecht. Wo hätte der Herr in dieser Welt einkehren können, ohne einen Sünder zu finden?
Zu Hause erzählte Zachäus seinem Gast, was er alles unternommen hatte, um sein Gewissen zu entlasten. Aber es half nichts. Es gibt nur einen Weg zum Heil: der Glaube an den Erlöser, der gekommen ist, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Diesen Schritt tat Zachäus, denn der Herr konnte bezeugen: «Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist», d.h. ein Glaubender (Römer 4,16; Galater 3,7).
Den Vers 10 könnte man als Kernvers des ganzen Lukas-Evangeliums bezeichnen. Der Sohn des Menschen ist bis zu uns verlorenen Menschen gekommen. Er ist uns nachgegangen, um uns zu erretten!
Das Gleichnis der Pfunde
Immer noch meinten damals viele Menschen, das Reich Gottes würde nächstens erscheinen. Doch der Herr Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, wo es zum Abschluss seiner Verwerfung zur Kreuzigung kommen würde. Durch ein weiteres Gleichnis zeigte Er, dass Er weggehen und später zurückkehren werde. In der Zeit seiner Abwesenheit sollten seine Knechte mit dem ihnen anvertrauten Pfund handeln.
In diesem Gleichnis geht es um die Verantwortung des Menschen. Die Ausgangslage ist bei jedem Knecht die gleiche. Jeder bekommt ein Pfund. Dann liegt die Betonung auf dem Wort «handelt». Wenn der Herr zurückkehrt, werden der Fleiss und die Treue belohnt. Entsprechend unterschiedlich fallen die Belohnungen aus.
Für uns Gläubige lässt Vers 15 an den Richterstuhl des Christus denken, wo Er unser Leben in seinem Licht beurteilt und das belohnen wird, was wir für Ihn getan haben. Die Belohnung entspricht unserer Stellung im Tausendjährigen Reich. Sie wird nicht bei jedem Gläubigen gleich ausfallen. Der Lohn wird auf der Erde, d.h. in dem Bereich ausbezahlt, wo wir während der Zeit der Abwesenheit des Herrn unsere Verantwortung hatten. Unsere Stellung im Himmel wird dadurch in keiner Weise beeinflusst. Sie gründet sich nur auf die Gnade.
Der böse Knecht kannte den Herrn überhaupt nicht, wenn er sagte: «Du bist ein strenger Mann» (vergleiche 1. Petrus 2,3). Er bewies, dass er keine Herzensverbindung zu Ihm hatte. Er stellt einen ungläubigen Bekenner dar.
Der Einzug in Jerusalem
Bevor der Herr Jesus in Jerusalem gekreuzigt wurde, bezeugte Er sich dieser Stadt noch einmal als Sohn Davids. Seine Rechte als Herr über alles sollten proklamiert werden. Ihm stand das Recht zu, als König empfangen zu werden. Aber alles geschah in Niedrigkeit der Gnade. Er kam nicht hoch zu Ross, sondern ritt auf einem Eselsfohlen.
Als die Menge der Jünger anfing, freudig Gott zu loben, regte sich der Widerstand der Pharisäer. Und was musste Er ihnen sagen? «Wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien.» Er sah die Zerstörung dieser Stadt voraus. Oh, wie trauerte Er über die Widerspenstigkeit Jerusalems! Etwa 40 Jahre nach seiner Kreuzigung wurde die Stadt von den Römern zerstört. Sie hatte ihren König nicht erkannt. Doch der Augenblick wird kommen, da sich die Pläne Gottes mit Jerusalem und seinem Volk erfüllen werden. Dann wird diese Stadt zum Zentrum der Friedensherrschaft von Christus werden.
In jenem Moment aber sagten die Jünger: «Friede im Himmel», nicht mehr «Friede auf Erden» wie die Engel bei seiner Geburt. Christus wurde hier verworfen. Als Folge davon sind Verwirrung, Krieg und Gericht das Teil der Erde. Frieden auf Erden wird es erst geben, wenn der einst Gekreuzigte in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. In der Zwischenzeit gibt es Frieden im Himmel, aber auch Frieden für das Herz dessen, der an den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk glaubt (Kolosser 1,20-22).
Jesus im Tempel
Für den Herrn Jesus war der Tempel immer noch das Haus Gottes, ja, das Haus seines Vaters (vergleiche Lukas 2,49). In seiner Vollmacht als Herr dieses Hauses trieb Er all jene hinaus, die mit dem Verkauf von Opfertieren ihre Geschäfte machten (5. Mose 14,24-26). Es war nicht verkehrt, dass sie jenen, die von weither kamen, an Ort und Stelle Opfertiere verkauften. Aber musste das im Tempel geschehen? Das Haus Gottes war doch ein Bethaus und kein Ort, um Geld zu verdienen.
Dieser Eingriff in «ihren Bereich», wie die religiösen Führer dachten, passte ihnen ganz und gar nicht. Aber solange der Dienst des Herrn Jesus noch nicht zu Ende war, konnte niemand Hand an Ihn legen.
Doch die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten liessen nicht locker. Als selbst ernannte Hüter des Hauses Gottes wollten sie vom Herrn Jesus wissen, in welchem Recht Er die Verkäufer aus dem Tempel getrieben und woher Er diese Vollmacht hatte. Als Antwort stellte Er ihnen eine Gegenfrage: War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Nun deckt der Geist Gottes die Unaufrichtigkeit ihrer Herzen auf. Sie wollten nicht glauben – weder an Johannes noch an Jesus Christus. Darum stellten sie sich unwissend.
Der Herr nahm sie sozusagen beim Wort. Seine Frage hätten die meisten aus dem Volk beantworten können. Für sie war Johannes ohne Zweifel ein Prophet. Die Führer aber stellten sich unwissend, forderten jedoch vom Herrn eine Legitimation für sein Tun. Nein, solche Menschen verdienten keine Antwort.
Das Gleichnis der Weingärtner
Der Weinberg in diesem Gleichnis stellt das Volk Israel dar, das Gott aus Ägypten erlöst und auf den Berg seines Erbteils gepflanzt hatte (2. Mose 15,17). Die Weingärtner waren die Verantwortlichen dieses Volkes. Gott erwartete Frucht von seinem Weinberg, aber Er bekam sie nicht. Die Knechte, die Er zum Volk sandte, waren die Propheten des Alten Testaments. Doch auch ihr Dienst blieb im Blick auf das Volk als Ganzes ohne Erfolg. Als Gott schliesslich seinen geliebten Sohn sandte, handelten die Führer wie jene Weingärtner: Sie warfen Jesus hinaus und kreuzigten Ihn. Kurz bevor sie diesen Mord wirklich ausführten, versuchte der Herr mit diesem Gleichnis nochmals ihr Gewissen zu erreichen. Es war vergeblich.
Gott wird den Weinberg anderen geben. Darauf antworteten sie entrüstet: «Das sei ferne!» Dass Gott den Juden aufgrund ihrer Untreue ihre Vorrechte nehmen konnte, war für das stolze Volk ein unmöglicher Gedanke. Doch der Herr sah sie an und ging noch weiter. Er sprach von sich als dem verworfenen Stein, der zum Eckstein geworden ist. Nach Ihm wird sich alles ausrichten. Aber diese gleiche Person ist für alle, die nicht an Ihn glauben wollen (= die auf diesen Stein fallen), ein Fels des Ärgernisses (1. Petrus 2,8; 1. Korinther 1,23).
Der zweite Teil von Vers 18 spricht vom Endgericht. Wenn der Herr in Herrlichkeit erscheinen wird, fällt sein Gericht auf alle, die im Unglauben verharrten.
Die Frage über die Steuer
Durch die arglistigen Fragen der Feinde des Herrn Jesus zeigt sich die Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Durch seine Antworten wird etwas von der Herrlichkeit seiner Person, aber auch von seiner Gnade sichtbar.
Diese Aufpasser, die mit einer raffiniert gestellten Frage den Herrn Jesus in seiner Rede fangen wollten, versuchten sich vor Ihm zu verstellen. Aber dieser demütige Mensch war gleichzeitig Gott, der ihre Schmeichelei und ihre Arglist durchschaute. Trotzdem war Er in seiner Gnade bereit, ihnen eine Antwort zu geben.
Worin bestand die Arglist ihrer Frage? Wenn der Herr geantwortet hätte: Es ist richtig, dem Kaiser Steuern zu bezahlen, hätten sie gesagt: Es kann nicht der Messias sein, denn Er hält zu den Römern. Hätte Er gegenteilig geantwortet, dann hätten sie Ihn als Rebell bei den Römern angeklagt.
Wie göttlich klar ist seine Antwort. Dass die Juden unter der Oberherrschaft des römischen Kaisers standen, war die Folge ihrer Untreue und ihres Ungehorsams gegen Gott. An diesen Platz, wohin ihre Sünde sie gebracht hatte, stellte der Herr sie mit dem ersten Teil seiner Antwort: «Gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist.» Aber wie stand es um die Seite Gottes? Die Römer hatten den Juden bis dahin ihre religiöse Freiheit gelassen. Doch ihr Gottesdienst im Tempel war zu einer kalten, toten Form erstarrt, ohne Herzensbeziehung zu Gott. Darum der zweite Teil seiner Antwort: «Gebt … Gott, was Gottes ist.»
Die Frage über die Auferstehung
In der nächsten Frage zeigt sich der Unglaube der Sadduzäer. Diese jüdische Sekte lehnte die Wahrheit von der Auferstehung ab. Durch ihre ausgeklügelte Geschichte wollten sie den Glauben an die Auferstehung lächerlich machen. Wie und was antwortete der Herr diesen Leuten?
In den Versen 34 und 35 macht Er einen klaren Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Die «Söhne dieser Welt» sind die Ungläubigen, die sich nur für das diesseitige Leben interessieren. Die Glaubenden aber haben eine herrliche Zukunft in der Auferstehungswelt vor sich. Sie werden als «Söhne der Auferstehung» bezeichnet.
Nicht im Leben auf dieser Erde, sondern in der Auferstehung unterscheiden sich die Gläubigen am meisten von den Ungläubigen. Die Glaubenden werden zu einem anderen Zeitpunkt auferstehen als die Ungläubigen (Johannes 5,28.29). Alle, die im Glauben an Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen, und zwar zum Leben. Die Ungläubigen werden mindestens 1000 Jahre später auferstehen, und dann zum Gericht.
Alles, was der Herr in den Versen 35-38 sagt, bezieht sich auf die entschlafenen Gläubigen. Sie leben für Gott, wie Vers 38 es sagt, und erwarten die Auferstehung aus den Toten.
Die Schriftgelehrten, die an die Auferstehung glaubten, pflichteten Ihm in dieser Sache bei: «Lehrer, du hast recht gesprochen.»
Christus – Herr und Sohn Davids
Nachdem die Menschen nicht mehr wagten, Ihn über irgendetwas zu befragen, hatte der Herr selbst noch eine Frage. Sie betraf Ihn. Wie konnte Christus gleichzeitig Davids Herr und Davids Sohn sein?
Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort: Der Messias, Davids Sohn, muss eine göttliche Person sein, damit Er Davids Herr sein konnte. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der sich erniedrigte und als sündloser, abhängiger Mensch hier in Sanftmut und Demut gelebt hat. Seine Erniedrigung ging bis zum Tod am Kreuz, wo Er das Erlösungswerk vollbracht hat. Nach seiner Auferstehung hat Gott Ihn hoch erhoben und Ihm den Platz zu seiner Rechten gegeben. Diesen Platz, der Ihm als Gott gehörte, nimmt Er nun auch als Mensch ein. Einmal wird sich jeder vor Ihm beugen und Ihn als Herrn anerkennen müssen (Philipper 2,9-11).
Die Menschen, die dem Herrn Jesus am schlimmsten widerstanden, waren Heuchler der übelsten Art. Sie benutzten die Religion, um ihre Selbstsucht und Habgier zu bemänteln. Der Herr entlarvte sie und sprach das Gericht über sie aus. Es würde bei diesen Leuten schwerer ausfallen als bei anderen.
Auch in uns steckt diese Wurzel, dass wir gern von den Menschen geehrt werden. Und wie schnell überheben wir uns dann! Vor einer solchen Haltung können wir nur bewahrt bleiben, wenn wir in die Fussstapfen unseres Herrn und Heilands treten und Ihn nachahmen.
Der Tempel wird zerstört
Am Ende des letzten Kapitels musste der Herr die Jünger vor denen warnen, die die Häuser der Witwen verschlingen. In den ersten Versen dieses Kapitels lenkt Er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf eine solch arme Witwe. Er sagte von ihr, dass sie mehr eingelegt habe als alle. Bei unserer Bewertung der Gaben für Gott gehen wir meistens von der Höhe des Betrags aus. Der Herr aber bewertet unsere Gabe nach dem, was wir für uns zurückbehalten. Diese Witwe legte alles ein, was sie noch hatte, und vertraute dann ganz auf Gott.
Der Hinweis auf den schönen Tempel veranlasste den Herrn, von der Zukunft zu reden. Es würde alles zerstört werden. Auf die Frage, wann dies sein werde, sprach der Herr von der bevorstehenden Zerstörung Jerusalems und vom Gericht, das die nationale Einheit dieses Volkes beendete. (Die Evangelisten Matthäus und Markus reden praktisch nur von der Endzeit). Lukas bezieht die ganze Zeit bis zur Vollendung der Zeiten der Nationen mit ein, also auch die Zeit, in der wir leben. Erst ab Vers 25 geht es um die Endzeit.
Und die Jünger? Sie sollten sich nicht verführen und erschrecken lassen, sondern ausharren und ihren Weg des Glaubens weitergehen. Wie die Jünger dürfen auch wir nicht vergessen, dass der Feind den Gläubigen sowohl als verführerische Schlange (Vers 8) als auch als brüllender Löwe zu schaden sucht.
Die Jünger werden verfolgt
In Vers 9 hiess es: «Das Ende ist nicht sogleich da.» Was jetzt in dem gelesenen Abschnitt folgt, beschreibt die Zeit, die direkt auf die Kreuzigung des Herrn Jesus folgte. Es handelt sich hier nicht um zukünftige Ereignisse in der Drangsalszeit.
Ab Vers 12 sagt der Herr den Jüngern Verfolgungen voraus. Die Apostelgeschichte bestätigt die feindselige Behandlung der gläubigen Christen (z.B. Apostelgeschichte 8,1-3). Aber diese Verfolgungen wurden zu einem Zeugnis für die Ungläubigen. Sie haben das Christentum nicht zerstören können. Wie der Herr den Seinen geholfen hat, sich in Weisheit vor ihren Anklägern zu verantworten, sehen wir z.B. in Apostelgeschichte 4,13-22. Gott liess zu, dass sie geprüft wurden, doch kein Haar von ihrem Kopf würde verloren gehen. Wichtig war für sie, dass sie in der Bedrängnis ausharrten und nicht aufgaben. Das gilt auch für uns.
Die in den Versen 20-24 beschriebene Belagerung und Zerstörung Jerusalems bezieht sich auf das, was unter dem römischen Feldherrn Titus im Jahr 70 geschah. Unbeschreibliche Not kam damals über die Bewohner Jerusalems. Die Christen, die sich an diese Worte des Herrn hielten, flohen rechtzeitig aus der Stadt. Was etwa 40 Jahre nach der Kreuzigung des Herrn über die Juden kam, war der Tag der Rache für die Verwerfung ihres Messias. Seither sind viele Juden unter die Nationen zerstreut worden. Und es gibt noch längst keinen Frieden bezüglich Jerusalems.
Der Herr wird wiederkommen
Aus Vers 27 wird deutlich, dass die Beschreibung der Ereignisse ab Vers 25 auf die Zeit zutrifft, die dem Erscheinen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit unmittelbar vorausgeht. Es ist die heute noch zukünftige Drangsalszeit. Sie beginnt erst nach der Entrückung, also nach Abschluss der jetzt noch andauernden Zeit der Gnade. Kein gläubiger Christ wird mehr hier leben, wenn jene Zeit beginnt.
Der Feigenbaum stellt das Volk Israel dar. Eine gewisse Neubelebung, was durch das Ausschlagen der Knospen illustriert wird, sehen wir heute bereits (Gründung des Staates Israel 1948, Rückkehr vieler Juden nach Israel). Auf diese Weise zeigt uns Gott, dass sein Reich (in Herrlichkeit) nahe ist. Doch bevor der Herr erscheint, um seine Herrschaft anzutreten, wird Er für uns kommen, um all die Seinen zu sich zu entrücken. Wie nahe muss daher sein Kommen sein!
Der Ausdruck «dieses Geschlecht» bezieht sich nicht auf die Lebensdauer einer Generation, sondern weist auf die unveränderte ungläubige Haltung der Juden gegenüber Jesus Christus hin. Bis heute lehnen sie Ihn als Messias ab.
Diese Sicht auf zukünftige Zeiten soll eine praktische Auswirkung auf unser Leben als gläubige Christen haben. Möge unser Verhalten uns als Himmelsbürger und nicht als auf der Erde Ansässige auszeichnen. Lasst uns wachen und beten, um in einer gerichtsreifen Welt abgesondert für den Herrn leben zu können.
Einleitung
Das erste Buch Samuel beschreibt den Übergang von der Zeit der Richter zur Zeit der Könige. Mit dem Hohenpriester Eli und seiner Familie ging es bergab. Seine Söhne versündigten sich schwer, so dass Gott sie richten musste.
Doch der Herr gab sein Volk nicht auf. Er berief Samuel zum Propheten und Richter in Israel. Dieser Mann Gottes war ein treuer Beter. Als Samuel alt geworden war, wünschten sich die Israeliten einen König wie die Nationen.
Da bekam Samuel den Auftrag von Gott, Saul zum König über Israel zu salben. Saul kam aus dem Stamm Benjamin. Er hatte viele menschliche Vorzüge, aber keine Glaubensbeziehung zu Gott. Deshalb versagte er auf der ganzen Linie.
Hanna und Peninna
Wie das Buch der Richter so zeigen uns auch die Fortsetzungsbücher, 1. und 2. Samuel, das Volk Israel in seiner Verantwortung. Gott muss viel Versagen aufdecken, weil sowohl das Richteramt verfällt, als auch das Priestertum versagt.
In dieser Situation sendet Gott Samuel, den Propheten, der beim Volk für Ihn einsteht. Durch Samuel wird auch das Königtum eingeführt: zuerst König Saul, den das Volk verlangte. Er war der Mann nach ihren Wünschen. Dann David, der Mann nach dem Herzen Gottes.
Elkana war ein Levit, der im Stammesgebiet von Ephraim wohnte. Er gehorchte den Anordnungen Gottes und zog mit seiner Familie Jahr für Jahr nach Silo, wo die Stiftshütte stand, um dem Herrn zu opfern (2. Mose 34,23.24).
Obwohl Elkana ein gottesfürchtiger Mann war und diese Gottesfurcht sicher auch für die Seinen wünschte, war seine Familie nicht glücklich. Wo lag die Ursache? Er hatte zwei Frauen! Obwohl Gott im Alten Testament Polygamie zuliess, gibt es in der Bibel keine Familie mit mehreren Frauen, die wirklich glücklich gewesen wäre. Gott hatte die Einehe eingesetzt. Das war und ist nach seinen Gedanken.
Peninna, die eine Frau Elkanas, hatte Kinder, die andere, Hanna, war kinderlos. Die Kränkungen Peninnas verletzten Hanna zutiefst. Sie war darüber so traurig, dass auch die gut gemeinten Trostworte ihres Mannes, der sie wirklich liebte, nicht halfen.
Hanna betet
Konnte Elkana wirklich nachempfinden, wie betrübt Hanna war? Warum hatte er eine zweite Frau genommen? Geschah es, um nicht kinderlos zu bleiben?
Hanna scheint niemand gehabt zu haben, der sie verstand und ihr helfen konnte. Doch sie konnte ihre Zuflucht zu Gott nehmen. So stand sie nach dem Essen auf und schüttete ihre Not vor dem Herrn aus. «Sie betete zu dem Herrn und weinte sehr.»
Der Wunsch Hannas nach einem Sohn war überaus gross. Doch sie wünschte sich nicht einfach ein Kind für sich selbst, sondern einen Sohn, der ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes werden konnte. Darum wollte sie ihn ganz dem Herrn weihen.
Der Hohepriester Eli beobachtete Hanna beim Gebet. Obwohl er Priester Gottes war, fehlte ihm das nötige Unterscheidungsvermögen. Er meinte, Hanna sei betrunken. Warum übersah er die Betrübtheit dieser Frau?
Eli war ein Vater, der seiner eigenen Familie schlecht vorstand. Er wusste um das böse, gottlose Tun seiner beiden Söhne, wehrte ihnen aber nicht. Er richtete nur einige ermahnende Worte an sie, mehr nicht (1. Samuel 2,17.22-25). Sein Mangel an Entschiedenheit für Gott und seine Rechte nahm ihm das gesunde Urteilsvermögen.
Trotzdem blieb Eli der Hohepriester, durch den Gott einer Hanna die Erhörung ihres Flehens ankündigen konnte, nachdem ihm sein Irrtum bewusst geworden war. Welch eine Gnade vonseiten Gottes, der das Vertrauen der Seinen nie enttäuscht (Psalm 34,5)!
Samuel wird geboren
Der Trost Gottes war ins Herz von Hanna gefallen. Man konnte es ihr am Gesicht ablesen (Vers 18). Dann kehrte Elkana mit seiner Familie nach Rama zurück.
Nun heisst es so schön: «Der Herr gedachte ihrer.» Der Sohn, den Hanna gebar, war wirklich die Antwort auf ihre Gebete. Darum gab sie ihm den Namen Samuel (= von Gott erhört).
Während einigen Jahren machte Hanna die jährliche Reise der Familie nach Silo nicht mehr mit. Sie blieb mit dem kleinen Samuel zu Hause. Elkana war damit einverstanden. Nur hoffte er, dass seine Frau ihr Versprechen gegenüber Gott auch einhalten würde.
Dann kam die Zeit, da Hanna ihr Gelübde einlöste. Sie brachte ihren noch kleinen Jungen nach Silo zu Eli. Den Sohn, den sie einst vom Herrn erbeten hatte, wollte sie Ihm nun zurückgeben. «Alle Tage, die er lebt, ist er dem Herrn geliehen.» Die grosse Opfergabe, die sie bei dieser Gelegenheit mitbrachte, zeugt sicher von der grossen Dankbarkeit ihres Herzens. Wie glücklich muss Hanna gewesen sein! Das Kapitel endet damit, dass sie den Herrn anbeteten.
In den kommenden Kapiteln werden wir nun den Werdegang Samuels vom Knaben zum Propheten und Fürsprecher des Volkes Gottes verfolgen können. Wenn wir dabei bedenken, wie gottlos die Söhne Elis waren, in deren Nähe er jetzt lebte, dann müssen wir sagen: Der Einfluss einer gottesfürchtigen Mutter und ihre Gebete sind von unschätzbarem Wert für die Kinder.
Buchtipp: Samuel – der Mann Gottes
Hanna lobt
Wir wissen nicht, was Hanna zum Herrn gesagt hat, als sie ihre Seele vor Ihm ausschüttete und weinte. Aber jetzt hat der Geist Gottes uns ihre Worte des Dankes und des Lobes, die sie zu Gott betete, in ihrem Wortlaut aufbewahrt. Ihr Gebet ist ein herrliches Zeugnis ihres Glaubens.
Dabei rühmt sie nicht nur die Hilfe und Rettung, die sie erfahren hat. Sie denkt auch daran, wer Gott ist, der sich zu ihr geneigt hat. Er ist heilig, d.h. Er verabscheut das Böse (Habakuk 1,13). Er ist ein Fels, der durch die Umstände der Menschen und durch alles, was auf der Erde geschieht, nicht erschüttert wird. Wer sich auf Ihn stützt, ist wirklich in Sicherheit. Aber Er ist auch ein Gott des Wissens, dem nichts entgeht und der all unser Tun und Lassen beurteilt.
Der achte Vers findet eine wunderbare Erfüllung in der Zeit, in der wir leben. Denken wir doch daran, was wir vor unserer Bekehrung waren und aus welchem Kot der Sünde uns der Heiland errettet hat (Epheser 2,1-8; Titus 3,3-7)! Zu welch einer herrlichen Höhe sind wir nun erhöht. Wir sind Kinder und Söhne Gottes, mit jeder geistlichen Segnung überschüttet, und das Ziel vor uns ist das Vaterhaus droben.
Vers 10 weist prophetisch auf den Herrn Jesus hin. Er ist der Gesalbte Gottes, wie dies in den Worten «Messias» (hebräisch Gesalbter) und «Christus» (griechisch Gesalbter) ausgedrückt wird.
Hophni und Pinehas
Als Elkana mit seiner Familie nach Rama zurückkehrte, blieb der Knabe Samuel allein bei Eli, dem Hohenpriester, zurück. Sein Dienst für den Herrn begann vor Eli, dem Priester. Obwohl bei Eli die Gottesfurcht sehr zu wünschen übrig liess, versuchte der junge Samuel zunächst vom alten Priester zu lernen und im Dienst von ihm unterwiesen zu werden.
In der Umgebung, in der dieser Knabe nun lebte, wurden schlimme Sünden verübt. Die Söhne Elis, die Priester Gottes hätten sein sollen, werden vom Heiligen Geist als «Söhne Belials» bezeichnet. Belial bedeutet Nichtswürdigkeit, Bosheit. «Sie kannten den Herrn nicht.»
Das Gesetz bestimmte, welche Teile der verschiedenen Opfer dem Priester gehörten. Aber diese beiden Männer, Hophni und Pinehas, stellten sich über Gottes Wort, missbrauchten ihre Autoritätsstellung als Priester und nahmen sich, was sie wollten. Sie bestahlen nicht nur das Volk, sondern auch Gott. Noch bevor das Fett, das Gott allein gehörte, geräuchert wurde, nahmen sie die besten Teile des Opfers für sich. Welch eine Beleidigung Gottes!
Die Folgen eines solch respektlosen und sündigen Verhaltens blieben nicht aus. «Die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn.» Sie fragten sich wohl: Wozu sollen wir überhaupt noch Opfer bringen?
Wenn heute ein Diener des Herrn sündigt oder es mit dem, was gegen Gottes Wort ist, nicht so genau nimmt, wird es verheerende Folgen für das Volk Gottes haben (vergleiche 1. Timotheus 5,19.20).
Samuel dient vor dem Herrn
Wie schön ist das geistliche Wachstum Samuels! Im Gegensatz zu Vers 11 heisst es jetzt: «Samuel diente vor dem Herrn.» Er muss wohl gemerkt haben, dass es in der Familie Elis manches Verkehrte gab. Für Samuel wurden die Anweisungen Gottes entscheidend. Nach ihnen wollte er sich richten. Eine solche Haltung führt zu weiterem Wachstum, wie dies die Verse 21 und 26 beschreiben. Das registrierten auch die Menschen.
Gott bleibt nie unser Schuldner. Wenn wir Ihm etwas weihen – z.B. unser Leben –, wird Er es uns reich vergelten. Das sehen wir auch bei Hanna. Nachdem sie ihren Erstgeborenen Gott geweiht hatte, schenkte Er ihr noch drei Söhne und zwei Töchter.
Die Verse 22-25 sind eine ernste Warnung an alle gottesfürchtigen Väter. Wir haben eine Verantwortung vor Gott. Er möchte, dass wir entschieden gegen das Böse, das in unsere Familien eindringen will oder vielleicht schon eingedrungen ist, vorgehen.
Das Verhalten der Söhne Elis war bereits so gravierend, dass ermahnende Worte nicht mehr genügten. Zudem sagte Eli nur: «Nicht so, meine Söhne! Denn nicht gut ist das Gerücht, das ich höre.» Als Hoherpriester und Vater hätte er die Sünden seiner Söhne klar beim Namen nennen und ihr Tun eindeutig verurteilen müssen. In diesem schweren Fall wären sogar weitere Massnahmen nötig gewesen. Eli unterliess sie.
Eine Gerichtsankündigung
Nun kommt ein Mann Gottes zu Eli, um ihm eine ernste Botschaft des Herrn zu überbringen und das Gericht über seine Familie anzukündigen. Gott erinnert ihn zuerst an die Gnade und Gunst, die Er dem Stamm und der Familie Elis erwiesen hatte (Levi, Aaron). Er und seine Söhne aber hatten diese Vorrechte verachtet und die Opfer Gottes mit Füssen getreten. Die ganz persönliche Schuld Elis vor dem Herrn wird mit den Worten ausgedrückt: «Du ehrst deine Söhne mehr als mich!»
Ab Vers 30 haben wir das göttliche Gericht, das der Mann Gottes über die Priesterfamilie aussprechen musste. Es betraf nicht nur Eli und seine Söhne, sondern seine ganze Nachkommenschaft. Es sollte keinen Greis mehr in seinem Haus geben. Sie würden alle vor der Zeit sterben (siehe 1. Samuel 4,11; 22,11-23; 1. Könige 2,26.27).
Eli gehörte zur priesterlichen Linie Ithamars, des einen der beiden übrig gebliebenen Söhne Aarons. Doch diese Linie würde durch die Linie Eleasars, des anderen Sohnes Aarons, ersetzt werden. Gott wollte sich einen treuen Priester erwecken, der vor seinem Gesalbten stehen würde. Vers 35 erfüllte sich, als Zadok aus der Linie von Eleasar unter der Regierung Salomos Hoherpriester wurde (1. Chronika 29,22). Doch die Prophezeiung geht bis zum Tausendjährigen Reich. Dann wird Christus der Gesalbte des Herrn sein, und die Söhne Zadoks werden den Priesterdienst in jenem zukünftigen Tempel ausüben (Hesekiel 44,15).
Der HERR ruft Samuel
Das dritte Kapitel beginnt mit einer positiven und einer negativen Bemerkung. Von einer Reaktion Elis auf die ernsten Worte des Mannes Gottes lesen wir leider nichts. Wenn der alte Priester versagte, so diente doch der junge Samuel in Treue weiter dem Herrn. Weil aber das Priestertum in seinem Mittlerdienst zwischen Gott und dem Volk versagt hatte (Maleachi 2,7), war das Wort des Herrn selten in jenen Tagen.
Der Mensch in seiner Verantwortung hat versagt. Aber Gott in seiner Gnade steht im Begriff, einen gewissen Neuanfang zu machen. Weil das Priestertum versagt hat, will Gott nun durch Propheten zu seinem Volk reden. Samuel, zu dem Gott hier zum ersten Mal direkt spricht, soll Prophet einer langen Reihe von Propheten werden, durch die Gott die Verbindung mit seinem Volk aufrechterhalten will (Vers 20; Apostelgeschichte 3,24; 13,20).
Nicht zum alten Priester, sondern zum jungen Samuel, der Gott in Treue diente, wollte der Herr reden. Doch der Knabe kannte Ihn noch nicht so nah, und Eli war träge im Verstehen, dass Gott redete. Wie langmütig ist der Herr! Wie viel Geduld hat Er mit uns, wenn wir träge im Hören und Verstehen sind!
Dreimal hört Samuel seinen Namen rufen, steht auf und läuft zu Eli, um ihm zu dienen. Erst beim dritten Mal merkt der alte Mann, dass Gott den Knaben ruft. Nun unterweist er ihn über das weitere Verhalten, sollte die Stimme noch einmal ertönen.
Der HERR spricht zu Samuel
Ein viertes Mal hört Samuel seinen Namen rufen. Dieses Mal wiederholt ihn Gott sogar: «Samuel, Samuel!» Bereit, auf Gott zu hören und Ihm zu gehorchen, antwortet der Knabe: «Rede, denn dein Knecht hört!»
In den Versen 1 und 8 wird Samuel zum letzten Mal als Knabe bezeichnet. In Vers 15 heisst es: «Samuel blieb bis zum Morgen liegen.» Die Botschaft, die Gott ihm mitteilte, war fast zu schwer für sein junges Alter. Aber der Ernst der Lage liess ihn geistlich reifer werden. So sagt Vers 19: «Und Samuel wurde gross.» Da war er geistlich erwachsen.
Die Mitteilung, die Samuel in jener Nacht erhielt, zeigt, dass das Gericht über Eli und seine Familie fest beschlossen war. Er hatte alles gewusst und doch seinen Söhnen nicht gewehrt. Nun gab es keine Sühnung mehr für ihr Verhalten. Vater und Söhne konnten dem Gericht nicht mehr entfliehen. Die tragischen Begleitumstände würden das ganze Volk erschrecken.
Wir verstehen, dass Samuel über das Gehörte lieber nicht gesprochen hätte. Aber Eli wollte alles wissen. Dann beugte sich der Priester demütig unter Gott und sein Tun. Er lehnte sich nicht dagegen auf. Besser wäre gewesen, er hätte vorher Energie und Entschiedenheit des Glaubens gezeigt.
Nun wird Samuel zum Propheten des Herrn für das Volk, indem Gott fortfährt, ihm zu erscheinen und sich ihm durch sein Wort zu offenbaren. So wird Samuel zum Sprachrohr Gottes für das Volk. Seine Worte bekommen durch die Tatsache: «Der Herr war mit ihm», das nötige Gewicht.
Niederlage gegen die Philister
Unter Simson, dem letzten Richter im Buch der Richter, hatte Gott sein Volk in die Hand der Philister gegeben. Diese Feinde scheinen unter Eli immer noch stark gewesen zu sein. Jedenfalls zieht Israel zur Zeit, da Samuel seinen Prophetendienst unter dem Volk beginnt, in den Krieg gegen sie. Aber Israel erleidet eine empfindliche Niederlage. 4000 Israeliten verlieren ihr Leben.
Die Führer des Volkes halten Kriegsrat und fragen: «Warum hat der Herr uns heute vor den Philistern geschlagen?» Doch wir hören und sehen nichts von einer Selbstprüfung vor Gott. Keiner kommt auf die Idee zu fragen: Liegt der Grund für die Niederlage vielleicht bei unserem Verhalten gegenüber Gott? Konnte Er uns keinen Sieg schenken, weil es bei uns ungerichtete Sünden gibt?
Ohne eine Antwort abzuwarten, beschliessen sie, die Bundeslade ins Lager zu holen. Dann wird Gott bei ihnen sein, und es kann nichts mehr schief gehen. Das ist reiner Aberglaube!
Als die Lade ins Lager kommt, ist der Jubel so gross, dass die Erde dröhnt. Der Himmel aber bleibt still. Die ebenfalls abergläubischen Philister werden durch diese Wendung der Dinge bestärkt, noch mutiger und tapferer zu kämpfen. Dann folgt Gottes Antwort: Es gibt eine noch empfindlichere Niederlage, die beiden Priester werden getötet und die Bundeslade fällt in die Hände der Feinde.
Eli stirbt
Ein Mann kann aus der Schlacht fliehen. Er bringt die Nachricht der Niederlage Israels nach Silo. Der 98-jährige Eli sitzt auf einem Stuhl am Wegrand und wartet mit grosser Sorge auf Nachricht. «Sein Herz war bange wegen der Lade Gottes.»
Der Bote kommt auch zu ihm und berichtet ihm von der Niederlage Israels, vom Tod seiner beiden Söhne und vom Verlust der Bundeslade. Was der Mann als Letztes erwähnt, ist für Eli das Wichtigste. Am Ende seines Lebens ist ihm die Ehre Gottes doch wichtiger als seine Söhne, denn diese letzte Mitteilung trifft ihn am härtesten. Das Schicksal der Lade nimmt ihn so her, dass er vom Stuhl fällt, das Genick bricht und stirbt.
Noch eine Person wird erwähnt, die die Nachricht von der gestohlenen Lade besonders schwer nimmt: die Frau von Pinehas. So wie der Geist Gottes von ihr berichtet, bekommt man den Eindruck, dass sie im Gegensatz zu ihrem gottlosen Mann gottesfürchtig war.
Sowohl in Vers 19 als auch in Vers 21 wird die Lade Gottes zuerst erwähnt und der Tod ihres Mannes an letzter Stelle. Der Schock löst bei ihr die Wehen aus. Sie gebar einen Sohn, konnte sich darüber aber nicht freuen. Zu gross scheint der Schmerz über den Verlust der Bundeslade gewesen zu sein. Sie starb an den Folgen der Geburt. Der Name ihres Sohnes, Ikabod (= Nicht-Herrlichkeit), erinnerte stets an jenen traurigen Tag, als die Herrlichkeit Gottes von Israel gewichen war.
Die Bundeslade bei den Philistern (1)
Wenn die Philister meinten, mit dem Sieg über Israel und der Erbeutung der Bundeslade auch den Gott Israels bezwungen zu haben, täuschten sie sich gewaltig. Der einzig wahre Gott gibt seine Ehre keinem anderen (Jesaja 48,11). Wer es mit Ihm aufnimmt, wird immer den Kürzeren ziehen. Auch wenn Gott sein Bundesvolk wegen dessen Untreue in die Hand seiner Feinde gab, durften diese sich doch nicht über Ihn erheben (vergleiche Daniel 4,25-30; 6,27.28).
Die siegreichen Philister stellten ihre Trophäe in den Götzentempel neben ihren Götzen Dagon. In der Nacht wurde das Götzenbild von unsichtbarer Hand umgeworfen. Da lag Dagon auf seinem Gesicht vor der Bundeslade, als beuge er sich vor dem Gott Israels. In der zweiten Nacht geschah noch Schlimmeres: Dem Götzenbild, das erneut auf der Erde lag, waren Kopf und Hände abgehauen worden. Nun begann sich der Triumph der Philister in eine Niederlage zu verwandeln. Aus ihrem Hochmut wurde eine Schmach.
Diese Ereignisse hätten jenen Heiden klar machen müssen, wie nichtig Götzenbilder sind, die von Menschen hergestellt werden (Jesaja 40,18-20; 1. Korinther 8,4; 10,19.20). Aber hinter diesen Götzen verbergen sich Dämonen, d.h. satanische Mächte. Sie haben die Menschen, die Götzenkult betreiben, in ihrer Gewalt. Nur so können wir Vers 5 verstehen. Anstatt sich vor dem wahren Gott zu beugen, verstrickten sich jene Götzenpriester noch mehr in ihrem Aberglauben.
Die Bundeslade bei den Philistern (2)
Gott schlug nicht nur Dagon, den Gott der Philister. Er schlug auch die Menschen mit einer tödlichen Krankheit und verdarb ihr Land durch eine Mäuseplage (1. Samuel 6,5). Die Bewohner von Asdod versuchten zunächst, die Unheil bringende Lade des Gottes Israels nach Gat abzuschieben. Doch die Hand des Herrn kam auch über jene Stadt. Schliesslich wollte niemand mehr die Lade haben, die nur Unheil brachte.
Die Bestürzung unter den Philistern war so gross, dass die Menschen ihre Fürsten aufforderten, die Lade Gottes nach Israel zurückzuschicken. Gezwungenermassen beugten sich diese dem wahren Gott, dem Gott Israels. Das Geschrei der leidenden Bevölkerung – es war ein Notschrei – stieg zum Himmel empor. Aber Gott konnte sie erst erhören, nachdem sie die für sie demütigende Tat auch ausführten und die Lade nach Israel zurücksandten (1. Samuel 6,3).
Können wir hier nicht eine Parallele zu unserer Zeit ziehen? Gott lässt im Leben eines Menschen manchmal äussere Not zu, um ihn zum Bewusstsein seiner Sünden und zur Umkehr zu bringen. Denken wir an den verlorenen Sohn im Gleichnis von Lukas 15. Nachdem er sein Vermögen vergeudet hatte, liess Gott eine Hungersnot zu, die ihn bis an den Schweinetrog brachte. Da kam er zur Besinnung. Doch der Einsicht über seine Sünden musste die Umkehr zum Vater folgen, sonst hätte sich seine Situation nicht geändert.
Der Plan zur Rückführung
Es ist klar, dass die Philister den Gott Israels nicht für sich anerkennen wollten. Nach siebenmonatiger Leidenszeit der Bevölkerung waren sie bereit, die Lade nach Israel zurückzuschicken, um endlich der Hand des Herrn zu entrinnen. Sie erinnern uns an die Gadarener, die den Herrn Jesus einst baten, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Seine Anwesenheit war ihnen äusserst unangenehm (Markus 5,17).
Die politischen Führer berieten sich mit den Götzenpriestern und Wahrsagern. Gemäss ihren heidnischen Vorstellungen dachten sie, sie müssten Gott mit einem Opfer beschwichtigen. Sie empfahlen den Fürsten der Philister, fünf goldene Beulen und fünf goldene Mäuse, die an ihre Plagen erinnerten, mit der Lade zurückzuschicken. «Und gebt dem Gott Israels Ehre.» Das war das Wichtigste.
Da diese Heiden Gottes Anordnung nicht kannten, hatte Er Nachsicht mit ihnen, als sie die Lade auf einen neuen Wagen luden. Dieser wurde von zwei säugenden Kühen gezogen, deren Kälber sie zu Hause einsperrten. Wenn diese Kühe sich von ihren Kälbern trennen liessen und den Weg zur Grenze Israels gehen würden, war dies für die Philister die Bestätigung, dass die ganze Not von Gott kam.
Mit den Unwissenden konnte der Herr Nachsicht haben. Als aber David, der die Anweisung Gottes hätte kennen müssen, die Lade auf einen neuen Wagen lud, griff Gott mit Gericht ein (2. Samuel 6,3-7).
Die Lade kommt nach Beth-Semes
Die ganze Not, unter der das Volk der Philister während Monaten zu leiden hatte, war kein Zufall. Die Hand Gottes hatte sie geschlagen. Das wurde klar, als die Kühe geradewegs zur Grenze liefen und weder nach rechts noch nach links abwichen.
Noch einmal wurden die Philister Zeugen eines klaren Zeichens Gottes, denn die säugenden Kühe wären nach ihrem Instinkt, den sie vom Schöpfer bekommen hatten, zu ihren Kälbern zurückgekehrt.
Die Rückkehr der Bundeslade nach Israel löste bei den Bewohnern von Beth-Semes Freude aus. War das Eintreffen der Bundeslade nicht ein grosser Beweis der Gnade Gottes? Ohne dass wir von einer Veränderung im Volk Gottes oder von Buße lesen, kam Gott gewissermassen zurück.
Die Dankbarkeit der Bewohner von Beth-Semes über die erfahrene Barmherzigkeit des Herrn zeigte sich in der spontanen Opferung der Kühe. Indem sie an jenem Tag dem Herrn Brandopfer opferten und Schlachtopfer schlachteten, priesen sie Ihn für seine Gnade.
Die Fürsten der Philister betrachteten dies alles. Doch dann kehrten sie zu ihrem Gott Dagon zurück. Alle Erfahrungen, die sie mit dem einzig wahren Gott gemacht hatten, brachten sie nicht dazu, sich vor Ihm zu beugen und an Ihn zu glauben. Vermutlich waren sie froh, als sie die Bundeslade und damit den Gott Israels endlich los waren.
Bestrafung der Leute von Beth-Semes
Warum gab es unter den Leuten von Beth-Semes solche, die in die Bundeslade schauen wollten? Wir wissen es nicht mit Bestimmtheit. Jedenfalls waren sie neugierig, ja, verwegen und missachteten die Heiligkeit Gottes, der ihnen in Gnade begegnet war. Das göttliche Gericht traf 70 Mann von ihnen, die auf der Stelle starben.
Die Bundeslade ist ein Bild von unserem Erlöser, der in einer Person wahrer Gott und wirklicher, aber sündloser Mensch ist. Der Sühndeckel spricht mehr von seinem Erlösungswerk. Wenn wir Menschen versuchen, diese einzigartige Person und ihr Werk verstandesmässig zu erfassen, handeln wir gegen Gottes Wort. Dann wollen wir in die Bundeslade schauen. Aber «niemand erkennt den Sohn als nur der Vater» (Matthäus 11,27).
Anstatt ihre Sünde einzusehen, sagten die Leute von Beth-Semes: «Wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen?» Nun handelten sie ähnlich wie die Philister: Sie sandten die Bundeslade weiter nach Kirjat-Jearim. Wieder müssen wir an jene Gadarener denken, die den Herrn Jesus aus ihrem Gebiet vertrieben. Warum? Das Wunder der Heilung jenes Besessenen führte für sie zum Verlust von 2000 Schweinen. Die unreinen Geister, von denen der Herr Jesus den armen Mann befreite, fuhren in die Schweine, sodass die ganze Herde sich in den See stürzte und ertrank. Für jene Leute als Juden waren dies zwar unreine Tiere. Aber mit den Römern und anderen Fremden konnten sie damit gute Geschäfte machen. Darum fanden sie es besser, wenn der Herr ihre Gegend wieder verliess!
Umkehr zu Gott
Die Bundeslade kam nicht mehr nach Silo zurück. Wegen der Untreue des Volkes scheint Gott jenen Ort, wo das Zelt der Zusammenkunft gestanden hatte, aufgegeben zu haben (Psalm 78,60). Die Lade blieb 20 Jahre im Haus von Abinadab in Kirjat-Jearim.
Und wie sah der geistliche Zustand des Volkes aus? Die Mehrheit von ihnen hatte sich von ihrem Gott abgekehrt und sich den sichtbaren Götzen zugewendet. Darum liess der Herr zu, dass die Philister stark wurden und das Volk bedrückten. Und Samuel? Er selbst konnte das Herz des Volkes nicht zu Gott zurückführen, aber er konnte für die Menschen beten (1. Samuel 7,5.8; Psalm 99,6).
Nach 20 Jahren kam Israel endlich zur Einsicht seiner verkehrten Wege und seines sündigen Verhaltens. «Das ganze Haus Israel wehklagte dem Herrn nach.» Auf diesen Moment hatte Samuel wohl schon lange gewartet. Jedenfalls war er als Prophet und Richter sofort zur Stelle, um den Menschen zu sagen, was sie tun sollten.
Daraufhin gab es eine Umkehr der Leute zum Herrn. Sie schafften die Götzen ab, dienten dem Herrn allein und versammelten sich in echter Buße nach Mizpa. Durch das Wasser, das sie schöpften und vor dem Herrn ausgossen, bezeugten sie ihre Kraftlosigkeit. Das Fasten zeigt, dass ihre Herzen über die geschehenen Sünden betrübt waren. Schliesslich lesen wir auch von einem Bekenntnis ihrer Sünden. Nun konnte sich Gott ihnen wieder zuwenden.
Sieg über die Philister
Als Israel sich in Mizpa zur Buße versammelte, vermuteten die Philister kriegerische Absichten. Diesen wollten sie zuvorkommen und zogen sofort mit ihrer Armee nach Mizpa. Solange Israel den Götzen diente, wurde es in Ruhe gelassen. Aber jetzt, da sich eine echte Umkehr zu Gott zeigte, griff Satan an.
Wir können die Angst der Israeliten verstehen, die sich doch zur Buße und nicht zum Kampf versammelt hatten, und nun angegriffen wurden. Sie bitten Samuel, den Propheten, für sie als Mittler und Fürsprecher vor Gott einzustehen. Er verbindet seine Fürbitte mit der Opferung eines Brandopfers. Dieses erinnert an die Tatsache, dass eine Beziehung zwischen uns Menschen und Gott nur aufgrund eines Opfers überhaupt möglich ist. Welch ein schöner Hinweis auf den Herrn Jesus, der sowohl Mittler als auch Opfer geworden ist (1. Timotheus 2,5.6)!
Gott erhörte seinen Knecht und kämpfte selbst gegen die Feinde seines Volkes, sodass die Männer von Israel die Philister nur noch verfolgen konnten. Ein Gedenkstein mit Namen Eben-Eser (= Stein der Hilfe) erinnerte fortan an Gottes wunderbares Eingreifen. Der Herr schenkte seinem Volk einen vollständigen Sieg. Welch eine gnädige Antwort auf ihre Herzensumkehr!
Die Verse 15-17 zeigen, dass Samuel nicht nur Prophet war, sondern auch als letzter Richter amtete, und zwar in Bethel, Gilgal, Mizpa und Rama. Aber zu Hause in Rama baute er dem Herrn einen Altar, was von seiner Gemeinschaft mit Gott redet.
Israel wünscht einen König
Die Jahre, in denen Samuel das Volk Israel richtete, waren eine Zeit des Friedens für die Menschen (1. Samuel 7,14). Nun macht die biblische Berichterstattung einen Sprung. In Kapitel 8 sehen wir einen alt gewordenen Samuel. Als seine Kräfte nachliessen, setzte er, ohne den Herrn zu fragen, seine Söhne als Richter über Israel ein. Wenn Gott uns einen Dienst anvertraut, ist dieser Auftrag auf unsere Person begrenzt. Der Herr will nicht, dass wir unsere Nachfolger bestimmen. Das tut Er.
Die Söhne Samuels lebten nicht in der Gottesfurcht ihres Vaters. «Sie wandten sich dem Gewinn zu» und liessen sich bestechen. Der Glaube und die Gottseligkeit sind etwas Persönliches. Wir können sie nicht an unsere Kinder weitervererben.
Als Folge des schlechten Verhaltens der Söhne Samuels fordern die Ältesten Israels einen König «gleich allen Nationen». Tief betrübt über diese Worte bringt Samuel seine Not vor den Herrn. Dieser macht ihm keine Vorwürfe über sein eigenes Fehlverhalten, sondern erklärt ihm: «Nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll.»
Gott kannte das Herz seines Volkes durch und durch. Die Menschen wollten eine sichtbare Autorität über sich haben. Um an einer unsichtbaren Autorität (Gott) festzuhalten, wäre Glauben nötig gewesen. Und dieser fehlte ihnen. Samuel sollte trotz seiner Bedenken auf ihre Stimme hören.
Die Weise des Königs
In der Forderung des Volkes nach einem König ihrer Wünsche kommt ihre Undankbarkeit gegenüber Gott, ihr Verlangen nach Unabhängigkeit von Ihm und das Streben nach menschlicher Sicherheit anstelle von Gottvertrauen zum Ausdruck. Samuel sollte auf ihre Stimme hören, aber ihnen auch die Weise des Königs vorstellen. Er tut dies in den Versen 10-18.
Dabei sagt Samuel sechsmal: «Er wird nehmen.» Auch heute glaubt der Mensch, er würde freier sein, wenn er die Autorität Gottes verwirft. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Der Mensch ist ein Sklave seiner sündigen Natur. Wenn er Gott verwirft, kommt er unter das Diktat der Welt, hinter der Satan steht. Wie ernst sind die Schlussworte in Vers 18.
Doch das Volk ist entschlossen, seine Forderung nicht aufzugeben. Es «weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören». Sie wollen sich als Volk Gottes ganz der Welt anpassen. Welch eine Gefahr auch für uns Christen!
Samuel bringt die Worte des Volkes im Gebet vor Gott. Was soll er den Leuten antworten? Der Herr weist ihn an: «Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein.» Und Samuel gehorcht.
Einige Jahrhunderte später kommt der Prophet Hosea auf die Zeit zurück, da das Volk einen König forderte, und sagt, dass Gott ihnen in seinem Zorn einen König gegeben habe (Hosea 13,10.11).
Saul sucht die Eselinnen
Nun wird der Mann eingeführt, der der erste König in Israel werden soll. Er weist alle Vorzüge auf, die man sich von einem König nur wünschen kann. Er ist der Sohn eines reichen Mannes, ist jung und ausnehmend schön, zudem gross gewachsen, sodass er «alles Volk überragte», und trägt den Namen Saul (= Erbetener). Wie dieser Mann aber persönlich zu Gott steht, darüber schweigt die Bibel an dieser Stelle.
Die Geschichte selbst beginnt mit den Eselinnen von Kis, dem Vater Sauls, die verloren gegangen waren. Zusammen mit einem Knecht sollte Saul die verirrten Tiere suchen. Doch die Suchaktion blieb erfolglos. Als Saul unverrichteter Dinge umkehren wollte, machte sein Begleiter den Vorschlag, zu Samuel, dem Mann Gottes, zu gehen und ihn um Auskunft zu bitten.
Es befremdet, dass nicht Saul auf die Idee kam. Kannte er Samuel überhaupt? Jedenfalls scheint Saul bis dahin kein Verlangen nach Gott gehabt zu haben. Aber jetzt, wo es darum geht, einen Gefallen vom Propheten und damit von Gott zu erbitten, denkt er an Bezahlung. Wie viele Menschen denken heute ähnlich! Man will Gott für die Gnade, die Er einem erweisen soll, mit guten Werken, einem anständigen Leben usw. entschädigen. Doch der Mensch muss einsehen, dass er vor Gott ein armer, mittelloser Sünder ist. Die Gnade, die Gott anbietet, ist unverdient und umsonst (Römer 3,22-24). Aber das zu akzeptieren und im Glauben anzunehmen, fällt dem stolzen Herzen des Menschen überaus schwer.
Saul trifft mit Samuel zusammen
Die Mädchen, die aus der Stadt herauskommen, um Wasser zu schöpfen, können Saul und seinem Knaben eine gute Antwort geben. Samuel ist an jenem Tag in die Stadt gekommen. Sie würden ihn direkt treffen. Alles klappt wunderbar.
Diese Mädchen sind ein Bild von freudigen Zeugen für den Herrn Jesus. Möchten wir ihnen nacheifern.
- Sie schöpften das Wasser, was auf das Wasser des Lebens hinweist, das uns erfrischt.
- Sie kennen den Mann Gottes sehr gut. Sie wissen, wo er ist, was er macht und was er vorhat. Wie gut kennen wir den Herrn Jesus?
- Wenn sie nach dem Mann Gottes gefragt werden, freuen sie sich, von ihm zu reden. Möchten auch wir unseren Herrn und Heiland freudig bekennen.
- Sie weisen den Weg zu ihm. So dürfen auch wir Wegweiser zum Herrn Jesus und zum Himmel sein.
Der Herr hatte Samuel gesagt: «Setze einen König über sie ein» (1. Samuel 8,22). Nun zeigt Er seinem Diener, welchen Mann er zum Fürsten über das Volk Israel salben soll. Er informiert Samuel einen Tag zuvor über das Eintreffen von Saul, einem Mann aus Benjamin.
Obwohl Gott sagen muss: «Sie haben mich verworfen» (1. Samuel 8,7), zieht Er seine Gnade nicht zurück. Er spricht von meinem Volk. Und der König, den das Volk verlangte, sollte die Menschen, die unter der Bedrückung der Philister litten und dieserhalb zum Herrn schrien, aus der Hand der Feinde retten. Wie gross ist Gottes Liebe zu seinem Volk (5. Mose 7,7.8)!
Saul isst mit Samuel
Im Tor der Stadt trifft Saul auf Samuel. Er weiss nicht, wer dieser Mann ist und fragt ihn nach dem Seher. Samuel, der wohl weiss, wen er vor sich hat, antwortet nicht nur: «Ich bin der Seher.» Er ladet Saul zum Opferfest ein und erklärt ihm: «Morgen werde ich dich entlassen; und alles, was in deinem Herzen ist, werde ich dir kundtun.» Trug wohl Saul den geheimen Wunsch im Herzen, König zu werden? Weiter beruhigt Samuel den Sohn von Kis über die verirrten Eselinnen: «Sie sind gefunden.»
Die Antwort Sauls zeugt von einem edlen Charakter und von menschlicher Demut. Doch auf eine Herzensbeziehung zu Gott lassen seine Worte nicht schliessen. Saul nahm einen Ehrenplatz unter den 30 Geladenen ein, ohne dass diese wussten warum.
Der Schlusssatz von Vers 24 und Vers 25 deuten auf den Anfang einer Beziehung zwischen Samuel und Saul hin. Sie dauerte lange, verlief jedoch nicht sehr glücklich. Es war für Samuel ein grosser Schmerz, dass der erste König in Israel auf einem Weg des Eigenwillens verharrte, sodass Gott ihn verwerfen musste (1. Samuel 15,35; 16,1).
Am nächsten Morgen wurde Saul früh geweckt. Samuel wollte ihn ein Stück weit begleiten. Als sie die Stadt hinter sich hatten und der Begleiter Sauls vorausgeschickt worden war, sprach Samuel das bemerkenswerte Wort zu Saul: «Du aber steh jetzt still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse.» Wie wichtig ist dies auch für uns! Möchten wir vor jeder Entscheidung zuerst auf Gottes Wort hören.
Samuel salbt Saul zum König
Saul wurde aus einer Ölflasche zum König gesalbt. Als Samuel David zum König salben sollte, sagte der Herr zu ihm: «Fülle dein Horn mit Öl.» Die Flasche ist zerbrechlich, und so zerbrach auch das Königtum Sauls. Das Horn hingegen spricht von Bestand. Als der Engel Gabriel die Geburt von Jesus Christus, dem wahren Sohn Davids, ankündigte, sagte er zu Maria: «Der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben … und sein Reich wird kein Ende haben.»
Was der Prophet für den Heimweg von Saul voraussagte, sollte diesem beweisen, dass Samuel wirklich ein Mann Gottes war und das Wort des Herrn weitergab. Die vorausgesagten Ereignisse waren aber auch eine Bestätigung für Saul, dass das Wort Samuels eintreffen und er König werden würde.
König über das Volk Gottes zu werden und zu sein, war eine grosse Ehre und ein grosses Vorrecht. Doch die Königswürde brachte auch eine sehr grosse Verantwortung mit sich. Ob Saul dieser auch nachkommen wird? Auf jeden Fall sagte Samuel: «Gott ist mit dir», und fügte dann einen Test an, durch den der Glaube Sauls erprobt werden sollte.
Gott kann nur mit dem sein, der auch sein Vertrauen auf Ihn setzt. Er kann sich unmöglich zu jemand bekennen, der im Eigenwillen seinen Weg geht und nicht bereit ist, auf Ihn zu warten und seine Anweisungen zu befolgen. «Sieben Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme, und ich werde dir mitteilen, was du tun sollst.» Würde Saul diesen Test bestehen?
Die drei Zeichen treffen ein
Als sich Samuel und Saul trennten und der frisch gesalbte König mit seinem Knaben auf dem Weg nach Hause weiterzog, traf alles ein, wie Samuel es vorausgesagt hatte. Eine Bestätigung des Wortes des Herrn!
Was bedeutet der Ausdruck in Vers 9: «Da verwandelte Gott sein Herz.»? Durch diese Veränderung, die Gott bewirkte, befähigte Er ihn, als König zu regieren. Das bedeutet aber nicht, dass Saul neues Leben empfangen hätte. Eine geistliche Veränderung ist im Leben Sauls nicht zu erkennen. Vielmehr heisst es, dass er wegen seiner Treulosigkeit starb, ohne Vergebung (1. Chronika 10,13.14).
Als ihnen die Schar der Propheten entgegenkam, geriet der Geist Gottes tatsächlich über Saul, aber nur für eine begrenzte Zeit (Vers 13). Doch die Veränderung, die sich in jenen Augenblicken zeigte, war für die, die ihn von früher kannten, verblüffend. So kannten sie Saul nicht. Er scheint allem Göttlichen fremd gegenüber gewesen zu sein. Sein Leben muss völlig losgelöst von Gott verlaufen sein. Anders kann man sich die ungläubig tönende Frage: «Ist auch Saul unter den Propheten?» nicht erklären.
Das Neue Testament erwähnt in Hebräer 6,4 Menschen, die «geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes» und doch kein Leben aus Gott hatten. Sie kamen unter den Einfluss des Christentums, genossen seine Vorrechte, glaubten aber nie persönlich an Christus.
Saul wird König
Nun sollte der König, den Gott bestimmt und den Samuel gesalbt hatte, dem Volk vorgestellt werden. Zu diesem Zweck berief Samuel die Menschen aus Israel nach Mizpa. In der Nähe jenes Ortes stand der Stein Eben-Eser, der von der beständigen Treue Gottes für das Volk zeugte (1. Samuel 7,12). Jetzt wurde dieser Ort zum Zeugen für ihre Verwerfung des treuen Gottes. Noch einmal hielt Samuel durch das Wort des Herrn dem Volk seine Untreue vor: «Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Unglück und euren Drangsalen gerettet hat.»
Dann wurde der König durch das Los bestimmt. Im Alten Testament war das Losen vor dem Herrn der Weg, um seinen Willen zu erfahren (Sprüche 16,33). Im Christentum tut Gott seinen Willen durch sein geschriebenes Wort und durch den Heiligen Geist kund. Vor Beginn unserer Zeitperiode wurde das Los ein letztes Mal für die Wahl des zwölften Apostels anstelle von Judas Iskariot benutzt (Apostelgeschichte 1,26).
Das Los fällt auf Saul, den Sohn des Kis, aus Benjamin. Warum versteckte er sich? Wollte er seine Demut zeigen? Die Bibel teilt uns den Grund nicht mit. Die Freude über den König, den der Herr erwählt hat, ist gross, denn er ist wirklich eine imponierende Persönlichkeit.
Samuel schrieb das Recht des Königtums in ein Buch. Es beinhaltete wohl die Worte aus 1. Samuel 8,11-17. Vielleicht hat er auch noch den Text aus 5. Mose 17,14-20 dazu geschrieben.
Der Angriff der Ammoniter
Obwohl Israel nun einen König hatte, änderte sich vorläufig noch nichts. Das ganze Volk und auch Saul gingen nach Hause und lebten weiter wie bisher (1. Samuel 10,26). Dann aber wurde Jabes-Gilead, eine Stadt auf der Ostseite des Jordan – sie lag vermutlich im Stammesgebiet von Gad –, von den Ammonitern angegriffen und belagert.
Angesichts dieser Bedrohung waren die Bewohner von Jabes bereit, mit dem Feind einen Bund zu schliessen. Wie traurig! Wo blieb das Vertrauen auf ihren Gott?
Als die Belagerer jedoch übermässige Forderungen stellten und eine Schmach auf das ganze Volk Israel bringen wollten, erbaten sich die Führer von Jabes eine siebentägige Schonfrist. In dieser Zeit wollten sie sehen, ob ihnen nicht irgendjemand aus Israel zu Hilfe käme.
Jetzt war der neue König gefordert, und er reagierte sofort. Er weinte nicht mit dem Volk, sondern handelte in der Energie des Geistes Gottes, der für diese Tat über ihn gekommen war. Aber zeugten solche Drohungen, die das Volk in Schrecken versetzten, von einer weisen Regierung? Der Befehl entsprang dem menschlichen Zorn dieses Mannes.
Um seinen Worten zusätzliches Gewicht zu geben, verband er seinen Namen mit dem Namen Samuels, von dem er wusste, dass das Volk ihn schätzte. Daraufhin zog Israel aus wie ein Mann. Ein Heer von 330 000 Mann war in Kürze beisammen.
Saul besiegt die Feinde
Die Boten aus Jabes brachten eine gute Botschaft zurück, sodass sich die eingeschlossenen Bewohner freuten und neuen Mut schöpften. Durch einen taktisch klugen Überraschungsangriff in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages errang Saul einen Sieg über Ammon.
Der militärische Erfolg des neuen Königs beeindruckte das Volk. Nun wollten sie jene bestrafen, die sich in Mizpa verächtlich über den neuen König geäussert hatten. Aber Saul, der die Rettung an jenem Tag Gott zuschrieb, liess nicht zu, dass Rache geübt wurde.
Bemerkenswert ist, dass in Vers 12 das Volk zu Samuel kam und dass er die Menschen aufforderte, nach Gilgal zu gehen, um das Königtum zu erneuern. Das bedeutet, dass der Prophet, der die Verbindung zwischen Gott und dem Volk darstellte, die höchste moralische Autorität war.
Aus dem Buch Josua lernen wir, dass Gilgal der Ort des Selbstgerichts und des Urteils über das Fleisch in uns ist (Josua 4,19.20; 5,2-9). Die Friedensopfer, die sie dort schlachteten, reden von der Gemeinschaft mit Gott und untereinander, denn von diesem Opfer bekam sowohl Gott als auch der Priester und der Opfernde und jeder Reine in Israel seinen Teil. Friedensopfer in Gilgal bedeuten: Wahre Gemeinschaft mit Gott ist nur nach vorausgegangenem Selbstgericht möglich. Ob Saul dies damals erfasste?
Ein treuer Mann
Samuel war der letzte Richter. Aber er war auch Prophet, und zwar im Sinn eines Mittlers zwischen Gott und dem Volk, wie es in der Folge die übrigen Propheten unter den Königen in Israel und Juda waren. Jetzt stand ein König an der Spitze des Volkes. Das Richteramt Samuels war zu Ende. Nun hält er seine Abschiedsrede als Richter, während er weiter als Prophet Gottes unter dem Volk lebt.
Wie schön sind die Worte von Vers 2 im Blick auf seine Söhne! Früher hatte er sie, ohne den Herrn zu fragen, als Richter über Israel eingesetzt (1. Samuel 8,1). Er hat seinen Fehler vor Gott eingesehen und korrigiert, denn jetzt sagt er: «Meine Söhne, siehe, sie sind bei euch.»
Samuel hatte ein gutes Gewissen vor Gott und Menschen (vergleiche Apostelgeschichte 24,16). Er hatte niemand übervorteilt und seine amtliche Autorität als Richter in keiner Weise missbraucht. Auf seine diesbezügliche Frage an das Volk stellten sie ihm ein gutes Zeugnis vor Gott aus. Dieses korrekte Verhalten gab nicht nur seiner amtlichen Autorität das nötige Gewicht. Dadurch wurde er auch zu einer sittlichen Autorität.
So ist es heute noch. Wenn der Herr einen Gläubigen in einen bestimmten Dienst ruft, z.B. als Evangelist oder als Lehrer, der das Wort verkündigt, dann ist es überaus wichtig, dass er sich in den täglichen Umständen richtig verhält. Erst sein Verhalten gibt seinen Worten das nötige Gewicht.
Ein klarer Rückblick
In der Fortsetzung seiner Abschiedsrede als Richter nimmt Samuel nun das Wort für Gott. Er erinnert das Volk an die wunderbare Errettung aus Ägypten unter Mose und Aaron. Aber er spricht auch von ihrem Abweichen vom Herrn, nachdem sie ins verheissene Land gekommen waren.
Doch Gott in seiner Barmherzigkeit liess nicht nur zu, dass die Feinde sie bedrückten. Sobald sie sich demütigten und zu Ihm um Hilfe schrien, sandte Er ihnen Richter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten.
Drei Feinde werden besonders erwähnt: Sisera, der Heeroberste von Hazor, die Philister und der König von Moab. Diese drei symbolisieren die drei Feinde, mit denen wir es als Glaubende zu tun haben: Satan (Sisera), die Sünde in uns (die Philister) und die Welt (Moab). Doch der Herr will uns helfen, ein sieghaftes Christenleben zu führen. Dem Teufel müssen wir widerstehen, der Sünde sollen wir uns für tot halten und wenn die Versuchung von aussen an uns herantritt, gilt es zu fliehen (Jakobus 4,7; 1. Petrus 5,8.9; Römer 6,11; 1. Korinther 6,18; 1. Timotheus 6,11; 2. Timotheus 2,22).
Als die Bedrohung durch Nahas, den König der Ammoniter, auftauchte, hätten sie an Gottes Rettungen denken und ganz auf Ihn vertrauen sollen. Doch es fehlte ihnen an Gottvertrauen, und so forderten sie einen König, den Gott ihnen auch gab. Doch sowohl der König als auch das Volk wahren verantwortlich, dem Herrn nachzufolgen.
Ein letzter Appell
Die ernsten Worte Samuels, die er in seiner Abschiedsrede als Richter dem Volk mitteilte, fanden die Bestätigung Gottes. Das geschah durch den Donner und den Regen, den Gott auf das Gebet Samuels hin gab (vergleiche Markus 16,20).
Diese Zeichen bewirkten, dass die Worte Samuels das Gewissen der Menschen wirklich erreichten. Nun fürchteten sie sich vor dem Herrn, weil ihnen ihre Sünde – die Forderung nach einem König – bewusst wurde. Daraufhin konnte Samuel sie wohl mit einem «Fürchtet euch nicht!» beruhigen. Doch die Sache selbst war nicht mehr rückgängig zu machen. Das Einzige, wozu das Volk jetzt aufgefordert wurde, war, auf dem gottgemässen Weg dem Herrn nachzufolgen und Ihm mit ganzem Herzen zu dienen.
Wie sehr kam Gott ihnen in der neuen Situation entgegen! Er würde sein Volk nicht verlassen (Vers 22). Das ist seine Gnade. Samuel wollte als Prophet niemals aufhören, für sie zu bitten. Wie wertvoll war die Fürbitte eines solchen Mannes Gottes! Zudem wollte er sie den guten und richtigen Weg lehren. Sie hatten also das Wort Gottes als Wegweisung.
Die letzten Verse des Kapitels zeigen die geheime Sorge des Propheten. Aufgrund der negativen Erfahrungen, die er schon mit dem Volk gemacht hatte, warnte er sie: «Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet sowohl ihr als auch euer König weggerafft werden.»
Die Philister greifen an
Nun ist Saul als König etabliert. Nach dem Sieg über Nahas behält er eine persönliche Garde von 3000 Mann für sich. Die übrigen Soldaten werden nach Hause entlassen. Rein zahlenmässig gesehen ist diese Garde reichlich gross für den persönlichen Schutz des Königs, aber viel zu klein, um den Feind zu schlagen.
Jonathan, der Sohn Sauls, hat im Gegensatz zu seinem Vater einen echten Glauben. Das wird im nächsten Kapitel noch deutlicher erkennbar. Doch auch hier sehen wir, wie er mit einer begrenzten Zahl Soldaten im Glauben gegen den Feind vorgeht, der sich im Land befindet, und einen Sieg erringt.
Saul, der keinen Glauben hat, versucht den Erfolg seines Sohnes zu seinem Vorteil auszunützen. Auf einmal heisst es: «Saul hat die Aufstellung der Philister geschlagen.» Ohne Gott zu fragen, ohne Gebet versucht der ungläubige Saul den Kampf gegen die Philister aufzunehmen. Es wird ein Misserfolg.
Angesichts des riesigen Heeres, das die Feinde auf die Beine stellen, bekommen es die Israeliten, die ohne Glauben einem König folgen wollen, der ebenfalls kein Gottvertrauen hat, mit der Angst zu tun. Sie verstecken sich vor dem Feind.
Und Saul? Er ist in Gilgal mit einem zitternden Volk, von dem schliesslich noch 600 Mann übrig bleiben (1. Samuel 13,7.15). Dort muss er auf Samuel warten, der kommen und ihm mitteilen würde, was er tun soll. Wird er den Test bestehen?
Saul kann nicht warten
Menschlich gesehen war die Lage für Saul nicht einfach: Das Volk lief ihm davon und das Heer der Philister stand zum Angreifen bereit. Aber Gott lässt manchmal solch extreme Situationen zu, bei denen jede Hoffnung auf menschliche Stützen schwindet. Er möchte dadurch unser Gottvertrauen wecken und unseren Glauben dahin führen, sich auf Ihn, den unsichtbaren Gott, und auf sein Wort zu stützen. «Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung des Herrn» (Klagelieder 3,26).
Doch Saul kann nicht warten. Er verliert die Geduld und begeht eine Sünde. Er, der weder Priester noch Levit ist, nimmt das Opfern vor. Nachdem er das Brandopfer geopfert hat, erscheint Samuel. Als ob nichts geschehen wäre, geht Saul ihm entgegen, um ihn zu begrüssen. Der König hat in der von Gott bewirkten Erprobung völlig versagt.
Die Entschuldigungen, mit denen er sein Tun rechtfertigen möchte, gelten vor Gott nicht. Sein Ungehorsam besiegelt sein Königtum. Ja, so ernst beurteilt Gott den Ungehorsam gegenüber seinen Geboten. Ist uns das immer bewusst?
Der Nachfolger Sauls als König über Israel wird ein Mann nach dem Herzen Gottes sein, im Gegensatz zu Saul, der den Vorstellungen der Menschen entsprach, aber ungläubig war. Dann trennten sich die Wege von Samuel und Saul wieder. Wie schwer muss es für den Propheten gewesen sein, die negative Entwicklung im Leben Sauls zu sehen!
Eine traurige Situation in Israel
Saul gibt uns in seiner Geschichte bis zu diesem Punkt das Bild eines Mannes, bei dem nichts auf einen echten Glauben hindeutet. Bei ihm hat die alte Natur die Oberhand, denn er hat keine andere. Ihm fehlt das Unterscheidungsvermögen. Er handelt in Unabhängigkeit von Gott, und das führt schliesslich zu Ungehorsam gegenüber den klaren Geboten Gottes.
Und das Volk? Unter einem solchen Führer konnte es den Menschen nicht gut gehen. So sehen wir, wie die Philister die Oberhand gewannen. Ihre Vernichtungszüge bewegten sich in alle Richtungen, sodass sie schliesslich das ganze Land Israel im Griff hatten. Zudem sorgten sie dafür, dass es im ganzen Gebiet von Israel keinen Schmied mehr gab. Eine erneute Aufrüstung und Bewaffnung war damit unterbunden. Welch eine raffinierte Taktik des Feindes!
Bis heute wirkt der Teufel in dieser Richtung. Denken wir z.B. an das Mittelalter. Da brachte er es fertig, dass es nur noch in den Klöstern Bibeln gab. Dem Volk war das Schwert des Geistes weggenommen worden. Und heute gehen seine Bestrebungen dahin, das geschriebene Wort Gottes abzuschwächen, zu verwässern und auszuhöhlen, bis es keine Kraft mehr hat und die Herzen und Gewissen unberührt lässt.
Lassen wir uns das reine, untrügliche Wort Gottes nicht nehmen! Halten wir es fest! Wie? Indem wir uns auf eine möglichst grundtextgenaue Übersetzung stützen.
Jonathan besiegt die Philister
Während Saul sich mit dieser demütigenden Situation abzufinden scheint, dachte sein Sohn Jonathan anders. Für ihn waren die Philister die Feinde des Volkes Gottes, die es im Glauben zu überwinden galt. Und wenn er und sein Waffenträger die einzigen waren, die sich auf Gott stützten und auf Ihn vertrauten, dann wollten sie es eben allein wagen. Hätte er seinem ungläubigen Vater von seinem Vorhaben erzählt, dann hätte ihm dieser abgeraten, so etwas Gewagtes zu unternehmen.
Wenn wir an die damalige Situation denken, dann hatte der Feind alle Vorteile auf seiner Seite. Die Philister befanden sich in der Höhe; sie waren gut bewaffnet und zahlreich. Aber Jonathan und sein Waffenträger stützten sich auf den Herrn. Sie waren überzeugt, dass es für Ihn keinen Unterschied machte, durch viele oder durch wenige zu retten. Der Glaube schaut einfach auf Gott.
Dann suchten sie den Willen des Herrn zu erfahren, denn sie wussten noch nicht genau, wie sie nach seinen Gedanken vorgehen sollten. Sobald sie jedoch vom Weg des Herrn überzeugt waren, zogen sie im festen Glauben los: «Steige hinauf, mir nach; denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben.»
Gott gibt eine wunderbare Rettung
Aus diesen Versen wollen wir uns zwei Punkte merken. Der erste betrifft König Saul. Nachdem seine Wächter im Lager der Philister eine grosse Unruhe und ein Durcheinander feststellten, liess der König untersuchen, wer von seinen Soldaten fehlte. Jonathan und sein Waffenträger wurden vermisst. Was hatte dies zu bedeuten? Saul beschloss, Gott zu fragen. Aber während er mit dem Priester redete, verstärkte sich das Getümmel im Lager der Philister. Nun änderte Saul seine Meinung. Eine Antwort von Gott schien überflüssig zu sein. Er meinte, die Situation hätte sich geklärt, und es sei jetzt wichtig, so schnell wie möglich den Feind zu verfolgen. Saul hatte tatsächlich keine Beziehung zu Gott und suchte sie auch nicht wirklich.
In diesem Abschnitt sehen wir aber auch die Ergebnisse des Glaubens von Jonathan und seinem Gefährten. Das ist der zweite Punkt, den wir nicht übersehen wollen. Sobald sich bei den Philistern eine Niederlage abzeichnete, hervorgerufen durch die mutige Tat Jonathans, verliessen die zum Feind übergelaufenen Israeliten ihren Platz und stellten sich auf die Seite ihres Volkes. Und all die furchtsamen Männer, die sich vor dem Feind versteckt hatten, kamen nun hervor und verfolgten die fliehenden Philister ebenfalls.
Ein mutiger Glaube wirkt auch heute ansteckend auf solche, die verzagt sind oder die es aufgegeben haben, für die Wahrheit Gottes einzustehen. Möchten wir unseren Mitchristen auf dem Glaubensweg ein Ansporn sein!
Jonathan isst vom Honig
In Vers 24 finden wir den tragischen und folgenschweren Befehl eines egoistischen Königs. Saul auferlegte seinen Soldaten etwas völlig Unvernünftiges. Sie durften nichts essen, «bis ich mich an meinen Feinden gerächt habe». So lautete seine Begründung. Gesetzlichkeit und Selbstsucht behindern das Werk und den Sieg Gottes.
Die Verse 25 und 26 machen die Tragik der Lage deutlich. In seiner Gnade liess Gott sein Volk zur Stärkung Honig finden. Doch die Menschen fürchteten den Schwur des Königs und gingen an der Fürsorge Gottes vorbei.
Jonathan, der vom Befehl seines Vaters nichts wusste, aber ein Leben des Glaubens mit dem Herrn führte, ass von dem Honig und wurde neu belebt. Als er von der törichten Anordnung seines Vaters hörte, reagierte er entrüstet. Aber es schmerzte ihn auch, dass dem Feind nicht die Niederlage beigefügt werden konnte, die Gott eigentlich schenken wollte.
Noch schlimmer aber war die Folge des unsinnigen Befehls des Königs für das Volk: Weil die Menschen derart ausgehungert waren, fielen sie über die Beute her und assen das Fleisch mit dem Blut. Der König hatte das Volk zur Sünde verleitet (1. Mose 9,4).
Vers 35 erinnert an Vers 18. Der religiöse Saul wollte wieder einen Anfang mit Gott machen. Doch es blieb erneut ein Anfang, der im Sand verlief. Es gab in seinem Leben nie eine ganze Entscheidung für Gott.
Das Volk rettet Jonathan
Bevor Saul die Philister weiterverfolgte, sollte Gott befragt werden. Doch Er gab dem König keine Antwort. Wie hätte der Herr antworten können, wo doch so vieles ungeregelt war? Der König hatte einen törichten Befehl gegeben. Das Volk hatte Blut gegessen. Weder die eine noch die andere Sünde war vor Gott eingesehen und bekannt worden.
Wie reagierte Saul auf das Schweigen Gottes? Er dachte nur an die Übertretung seines Befehls und verdächtigte wohl bereits seinen Sohn (Vers 39). Gott bewirkte, dass das Los auf Jonathan fiel. Sollte dieser treue Glaubensmann nun sterben? Saul zeigte überhaupt keine Einsicht über seine eigene Schuld. Er hätte Jonathan umgebracht, wenn das Volk nicht Partei für den Sohn des Königs ergriffen hätte. Das Volk hatte mehr Einsicht als der ungläubige König. Sie sagten von Jonathan: «Er hat mit Gott gehandelt an diesem Tag.» Dafür hatte er wirklich nicht den Tod verdient!
In den Schlussversen 47-52 haben wir eine Zusammenfassung des Königtums von Saul. Mit Vers 52 endet die Geschichte seiner Regierung. Das nächste Kapitel beschreibt eine Sache im Detail, die in Vers 48 kurz angetönt wird: sein militärisches Vorgehen gegen Amalek. Mit dieser Erzählung als Anhang zur Zusammenfassung des Königtums wird gezeigt, dass Saul auch den letzten Test von Gott nicht bestanden hat und darum von Ihm endgültig als König über Israel verworfen wurde.
Der Kampf gegen Amalek
Der von Gott bestimmte und durch Samuel gesalbte König bekommt einen klaren Auftrag. Er soll die Amalekiter schlagen und völlig ausrotten. Dieses Volk hatte Israel einst in der Wüste angegriffen, besonders die Schwachen unter ihnen. Nachdem Josua Amalek siegreich bekämpft hatte, redete der Herr bereits von einer Vernichtung dieses Volkes (2. Mose 17,14; 4. Mose 24,20; 5. Mose 25,17-19).
Amalek ist ein Bild von Satan, der durch das Fleisch (die alte Natur) in uns wirkt, um dem Geist zu widerstehen. Das Neue Testament zeigt uns, dass es im Gläubigen kein friedliches Nebeneinander vom Fleisch (der alten Natur) und dem Geist gibt (Galater 5,17). Wir werden aufgefordert, gegen alle Auswüchse der alten Natur radikal vorzugehen (Kolosser 3,5-11). Das wird uns in dieser Begebenheit bildlich vorgestellt.
Obwohl der Auftrag klar war, führte ihn Saul nicht konsequent aus. Er nahm den König der Amalekiter lebend gefangen. Das war die Sünde des Königs. Weil er mit dem schlechten Beispiel voranging, verwundert es nicht, dass auch das Volk ungehorsam war. Sie wollten das Beste vom Vieh nicht verbannen.
Wie ernst redet dies zu uns! Obwohl das Neue Testament sagt: «Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind», stehen wir in Gefahr, gewisse Neigungen der alten Natur zu tolerieren. Kommt es nicht vor, dass wir gegen gewisse «Lieblingssünden» in unserem Leben nicht so radikal vorgehen, wie wir eigentlich sollten? (Römer 13,14).
Gehorchen ist besser als Schlachtopfer
Gott konnte diesen Ungehorsam des Königs nicht tolerieren. Wenn Er zu Samuel sagte: «Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe», dann bedeutet das nicht, dass Gott seine Meinung änderte (vergleiche Vers 29). Diese Aussage drückt vielmehr die Trauer Gottes über den Ungehorsam des gesalbten Königs aus. Wenn es heisst: «Er hat meine Worte nicht erfüllt», dann wird klar, dass vor Gott ein halber Gehorsam ein ganzer Ungehorsam ist.
Samuel ist so erschüttert, dass er die ganze Nacht zu Gott schreit. Doch dann steht er auf, um dem fehlbaren König entgegenzutreten und ihm das Urteil des Herrn mitzuteilen.
Und Saul? Nachdem er zu seinem eigenen Ruhm ein Denkmal aufgestellt hat, begegnet er Samuel mit einem frommen Gruss und den Worten: «Ich habe das Wort des Herrn erfüllt.» Auf die Frage Samuels bezüglich der lebenden Tiere schiebt er die Schuld dem Volk zu. Er will die Sache beschönigen, indem er von Opfern für Gott spricht.
Nun teilt Samuel ihm die ernsten Worte des Herrn mit. Doch Saul pocht immer noch auf seinen Gehorsam und schiebt dem Volk die Schuld zu. Aber Gottes Urteil lautet: «Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst.» – Die Verse 22 und 23 wollen wir auch auf unsere Gewissen wirken lassen. Gott schätzt den Gehorsam der Seinen über alles, aber Er verurteilt jeden Eigenwillen. Wir können Ihn niemals mit Opfern beschwichtigen, wenn wir nicht gehorchen wollen.
Kein aufrichtiges Bekenntnis
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als habe Saul seine Sünde eingesehen. Betrachtet man aber die Sache etwas genauer, dann wird klar, dass Saul erst unter dem Druck der Umstände seine Sünde bekannte. Als er realisierte, welch weitreichende Folgen sein Ungehorsam hatte, sagte er: «Ich habe gesündigt.» Aber er hängte dem Bekenntnis noch eine Entschuldigung an, um seine Schuld abzuschwächen. So etwas gilt vor Gott nicht. Weiter bat er Samuel, mit ihm umzukehren, um anzubeten. Doch jetzt ging es nicht um Anbetung, sondern um das Ordnen der Schuld vor Gott. Das ist aber nur durch ein aufrichtiges, schonungsloses Bekenntnis möglich, nicht durch Worte, wie Saul sie äusserte.
In Vers 30 macht Saul nochmals einen Versuch und wiederholt: «Ich habe gesündigt.» Doch es wird klar, dass er mit seinem Bekenntnis der Strafe entgehen wollte und die Folgen seines Fehltritts zu mindern suchte. Ein solches Bekenntnis ist vor Gott wertlos. Ebenso nutzlos war die Anbetung Sauls in Vers 31. Wie kann man anbeten, wenn ungerichtete Schuld vorliegt? Das akzeptiert Gott nicht.
Das Gericht über den König der Amalekiter, das Saul hätte ausführen müssen, vollstreckte nun Samuel. Dann trennten sich die Wege des Propheten und des Königs endgültig. So weit wird es immer kommen, wenn der eine Gottes Willen tun möchte und der andere dem eigenen Willen folgen will. Für Samuel war es ein tiefer Schmerz, dass Gott so handeln musste. Er trauerte mit dem Herrn über den ungehorsamen König.
Einleitung
In seinen beiden Briefen hat der Apostel Petrus vorwiegend die christliche Lebenspraxis vor Augen.
- Im ersten Brief unterweist er uns zu einem Verhalten, das Gott ehrt. Er stellt uns Jesus Christus als das vollkommene Beispiel vor und fordert uns auf, seinen Fussspuren zu folgen.
- Im zweiten Brief warnt uns Petrus vor Verführern in der Christenheit. Ein lebendiges Glaubensleben in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus bewahrt uns vor ihrem schädlichen Einfluss.
Das himmlische Erbteil
Der Apostel Petrus schrieb diesen Brief an gläubige Christen mit jüdischer Herkunft, die als Fremde in verschiedenen Provinzen des Römischen Reiches lebten. Als Teil des inspirierten Wortes Gottes ist dieser Brief auch für uns verbindlich. Sind wir als Himmelsbürger nicht auch Fremde in dieser Welt? Wir sind jedoch Auserwählte Gottes, die durch den Heiligen Geist in eine Beziehung zu Gott gekommen sind. Als Erlöste, deren Sünden durch das Blut des Herrn Jesus abgewaschen sind, leben wir jetzt für Gott und gehorchen Ihm, und zwar nach dem Vorbild des Herrn Jesus, der uns diesen Gehorsam vorgelebt hat.
Nach der Anrede beginnt Petrus seinen Brief mit einem Lobpreis, in dem er die grosse Barmherzigkeit Gottes rühmt. Unser Gott und Vater hat uns durch die Neugeburt ein neues Leben geschenkt und gleichzeitig eine lebendige Hoffnung gegeben. Wir gehen als Pilger einer herrlichen Zukunft entgegen, wo unser himmlisches Erbteil – der ganze christliche Segen – für uns aufbewahrt ist. Wir geniessen heute schon «die Zinsen» davon, indem wir uns an diesem geistlichen Reichtum freuen.
Vers 5 zeigt, dass Gott nicht nur das Erbteil im Himmel für uns aufbewahrt, Er wird auch uns ans himmlische Ziel bringen. Wie? Durch seine Macht. Unser Glaube ergreift diese Tatsache, so dass wir mit Gottvertrauen dem Ziel entgegengehen.
Die Errettung der Seele
Zu wissen, dass wir durch Gottes Barmherzigkeit das Ziel sicher erreichen werden, macht uns froh, selbst wenn die gegenwärtigen Umstände nicht immer angenehm sind. Aber Gott schickt uns diese Erprobungen des Glaubens, weil sie nötig sind. Er verfolgt mit ihnen ein Ziel. Unser Gottvertrauen soll sich als echt erweisen, damit alles zur Verherrlichung des Herrn Jesus ausschlägt. Ja, wenn Er in Herrlichkeit wiederkommen wird, wird Er in all denen bewundert werden, die ihr ganzes Vertrauen auf Ihn gesetzt haben (2. Thessalonicher 1,10).
Unseren Herrn und Heiland haben wir noch nie gesehen. Trotzdem vertrauen wir auf Ihn, ja, wir lieben Ihn, der uns erlöst hat und jetzt in seiner Güte für uns sorgt. Weil wir in einer Glaubensbeziehung zu Ihm leben, freuen wir uns an Ihm.
Das Ende oder Ziel unseres Glaubens ist die Errettung unserer Seele. Jeder Erlöste der Gnadenzeit besitzt sie seit seiner Bekehrung. Die Propheten des Alten Testaments haben diese Errettung angekündigt. Aber sie kannten das volle Heil, das wir seit dem Kreuz besitzen, noch nicht. Doch sie wiesen auf Christus und seine Leiden hin (Psalm 22; Jesaja 53), prophezeiten aber auch seine zukünftige Herrlichkeit als König Israels und Universalherrscher (Psalm 2; Psalm 8). Heute, in der Zeit der Gnade, wird das volle Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes den Menschen auf der ganzen Welt gepredigt.
Der heilige Wandel
Jeder Mensch, der an den Herrn Jesus als seinen Erlöser glaubt, ist für die Ewigkeit gerettet. Während er noch hier lebt und auf dem Weg zur Herrlichkeit ist, soll er sich als Kind des Gehorsams erweisen. Gehorsam ist die Antwort der Liebe, die wir Gott und unserem Herrn und Heiland geben dürfen (Johannes 14,15.21.23).
Doch wir werden nicht nur zum Gehorsam aufgefordert, Gottes Wort gibt uns in diesen Versen auch drei Motive, die uns anspornen, Gott zu gehorchen:
Der erste Beweggrund ist seine Heiligkeit. Weil Gott heilig ist, sollen auch wir, die Ihm angehören, uns von allem Bösen trennen und nicht sündigen – und zwar «in allem Wandel», d.h. in jedem Bereich unseres Lebens.
Das zweite Motiv finden wir in Vers 17. Gott, unser Vater, beurteilt unser Verhalten während unseres Lebens hier und handelt entsprechend mit uns: Wir werden ernten, was wir säen. Befolgen wir sein Wort, so ernten wir Segen. Wenn wir Ihm aber nicht gehorchen, erfahren wir seine Erziehung. Deshalb wollen wir uns als Fremde von der Welt trennen und in Gottesfurcht leben.
Das dritte Motiv zum Gehorsam ist das kostbare Blut des Herrn Jesus, durch das wir erlöst worden sind. Weder Silber noch Gold genügten zu unserer Erlösung. Ein unendlich höherer Preis war dazu nötig: das Blut des vollkommenen Lammes Gottes. Unser Heiland hat ihn mit seinem Tod bezahlt.
Der Glaube an Gott
Dieses Lamm, das zu unserer Erlösung am Kreuz gestorben ist, ist «zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt». In der Ewigkeit vor der Zeit wusste Gott schon, dass sein geliebter Sohn einst als Mensch für andere sterben würde. So konnte die Erfüllung seines ewigen Vorsatzes nicht durch den Sündenfall verhindert werden. Der Tod des Lammes Gottes geschah «am Ende der Zeiten», d.h. als die Zeit der Erprobung des Menschen mit dem Kommen von Jesus Christus zu Ende ging. Er kam wegen uns und starb für uns.
Ab Vers 22 bis Kapitel 2,10 behandelt der Apostel die gemeinsame Bestimmung der Christen. Er beginnt wieder bei der Bekehrung. Damals haben wir persönlich an den Heiland geglaubt. Doch als bekehrte Menschen gehören wir zum himmlischen Volk Gottes. Und was prägt das gemeinsame Leben der Glaubenden? Die Bruderliebe. Sie soll herzlich sein und aus reinem Herzen kommen, d.h. sich im göttlichen Licht entfalten.
Bei unserer Bekehrung, als wir Buße taten und an den Erlöser glaubten, geschah in uns ein Werk der Gnade Gottes: Wir wurden von neuem geboren, und zwar durch die Wirkung des Wortes Gottes (Vers 23). Vor unserer Bekehrung waren wir wie Gras und Blumen. Unser Leben hatte keinen Wert für die Ewigkeit. Doch seitdem wir unser Herz dem Herrn Jesus geöffnet haben, besitzen wir ewiges Leben. Wir haben es durch den Glauben an das ewige Wort Gottes empfangen und werden es nie verlieren. Es hat Ewigkeitswert.
Die heilige Priesterschaft
Auf die Bekehrung (1. Petrus 1,22-25) folgt das praktische Glaubensleben im Volk Gottes. In 1. Petrus 2,1-3 werden wir aufgefordert, uns einerseits von allem in Vers 1 aufgezählten Bösen abzuwenden. Anderseits sollen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und uns durch nichts davon abhalten lassen, diese geistliche Nahrung regelmässig aufzunehmen. Dadurch werden wir innerlich wachsen und unseren gütigen Herrn immer besser kennen lernen.
Die Verse 4 und 5 beschreiben unseren Platz und unseren Dienst im Haus Gottes. Einerseits ist jeder Erlöste ein lebendiger Stein am geistlichen Haus Gottes, das von allen Gläubigen zusammen gebildet wird. Anderseits ist jeder Mensch, der sich bekehrt hat, auch ein heiliger Priester. Gemeinsam bilden wir die priesterliche Familie und bringen Gott geistliche Schlachtopfer in Form von Lob, Dank und Anbetung dar, die aus unseren Herzen zu Ihm aufsteigen.
Die königliche Priesterschaft
Als Eckstein ist der Herr Jesus das Mass und die Grenze von allem, sowohl in unserem persönlichen Leben als auch im gemeinsamen der Kinder Gottes (Epheser 2,20). Für die ungläubigen Menschen aber, die Ihn und das Evangelium ablehnen, wird Er zum Stein des Anstosses und zum Fels des Ärgernisses.
Als königliche Priester sind wir vor den Menschen, die uns umgeben, durch unser Verhalten und Reden ein Licht und ein Zeugnis für den Herrn. Wir dürfen durch ein Leben, in dem wir Jesus Christus nachahmen, den Menschen zeigen, dass Gott Licht und Liebe ist.
Das Verhalten als Staatsbürger
Ab Kapitel 2,11 beginnt im ersten Petrus-Brief ein neuer Abschnitt. Nun erklärt der Apostel, wie wir in unserem täglichen Leben für die Mitmenschen ein Zeugnis vom Herrn Jesus sein können (königliche Priesterschaft). Er zeigt, dass wir dies in jeder Stellung, in der wir uns befinden, in jeder Lebenssituation und in jedem Lebensbereich verwirklichen sollen.
Zuerst ermahnt er uns als Fremde auf der Erde. Weil wir Himmelsbürger sind, engagieren wir uns in der Welt nur so weit es nötig ist. Zudem enthalten wir uns der fleischlichen Begierden, die in der Welt in jeder Hinsicht angeregt werden. Den ungläubigen Mitmenschen gegenüber gilt es, korrekt zu sein, damit sie keinen berechtigten Grund haben, gegen uns zu reden. Weil sie uns nicht verstehen, werden sie manchmal trotzdem schlecht über uns reden. Aber Gott wird dies einmal klarstellen.
Zur königlichen Priesterschaft gehört auch, dass wir uns als Staatsbürger gegenüber der Regierung korrekt verhalten. Die «Unwissenheit der unverständigen Menschen» äussert sich oft in der Kritik über die gewählten oder eingesetzten Amtspersonen. Als Glaubende wollen wir uns nicht gegen die von Gott gegebene Regierung auflehnen. Beachten wir die vier Aufforderungen in Vers 17 und verwirklichen wir sie! Dann steht unser Verhalten in der Welt in einem guten Gleichgewicht.
Das Verhalten am Arbeitsplatz
Was können wir aus dem, was zu den Hausknechten gesagt wird, für uns ableiten? Einerseits finden wir hier Anweisungen für unser Verhalten am Arbeitsplatz, anderseits allgemeine Belehrungen für unser Verhalten in schwierigen Situationen. Nicht jeder von uns hat einen angenehmen Chef. Doch als Glaubende sollen wir uns auch den «verkehrten» Vorgesetzten unterordnen. Es kann vorkommen, dass wir ungerecht behandelt werden, weil wir dem Herrn Jesus treu bleiben wollen. Bitten wir Ihn um Kraft, dies geduldig zu ertragen. Gott übersieht eine solche Haltung nicht und gibt seine Zustimmung dazu.
Hatte unser Herr und Heiland ein leichtes Leben, als Er hier war? Nein. Sein Weg des Gehorsams zu Gott war ein Weg vielfältiger Leiden. Er ist unser grosses Vorbild. Im «Sand der Wüste» dieser Erde hat Er uns seine Fussspuren hinterlassen. Ihnen dürfen wir nun nachfolgen. Er tat keine Sünde. Seine Worte waren ohne Trug. Wenn Er ungerecht getadelt wurde, schwieg Er. Als die Menschen Ihn quälten und Ihm viele Schmerzen zufügten, drohte Er nicht mit dem Gericht. Alles erfahrene Unrecht übergab der Herr Jesus als Mensch seinem Gott.
Den Weg zum Kreuz, wo Er unsere Sünden sühnte, ging Er ganz allein. Darin können und müssen wir Ihm nicht nachfolgen. Aber sein Erlösungswerk hat Konsequenzen für unser Glaubensleben: Es bewahrt uns davor, leichtfertig zu sündigen (Vers 24).
Das Verhalten in der Ehe
Petrus gibt in diesen Versen Anweisungen zum Verhalten im Eheleben. Das ist der engste Bereich, in dem verheiratete Christen etwas von den Eigenschaften Gottes verwirklichen können.
Zuerst wird die Ehefrau angesprochen. Sie soll sich ihrem eigenen Mann unterordnen und ein Leben führen, das von Gottesfurcht und Reinheit statt von vielen Worten geprägt ist. Das wird nicht ohne Einfluss auf den Ehemann bleiben. Ein bis dahin noch ungläubiger Mann kann dadurch für den christlichen Glauben gewonnen werden.
Frauen schmücken sich gern. Gott möchte aber nicht, dass sie durch äusseren Schmuck die Aufmerksamkeit der Männer auf sich ziehen. Für Ihn ist der innere Schmuck – der durch den Heiligen Geist gewirkte sanfte und stille Geist – bedeutsam und wertvoll.
In Vers 7 geht es um das Verhalten des Ehemannes. Er wird aufgefordert, so viel wie möglich bei seiner Ehefrau zu sein und sie mit Verständnis zu behandeln. Die Frau ist das schwächere Gefäss. Darum erwartet Gott vom Mann, dass er seiner Frau mehr gibt, als er von ihr bekommt. Verwirklichen wir dies? Bringen wir Männer unseren Ehefrauen immer die nötige Achtung und Ehre entgegen? Das unkorrekte Verhalten der gläubigen Ehemänner zieht ernste Folgen nach sich: Ihre Gebete werden nicht erhört.
Das Verhalten unter den Gläubigen
Die Verse 8-12 beziehen sich auf unser Verhalten unter den Gläubigen. Es soll durch Wohlwollen geprägt sein. Dies zeigt sich anhand der folgenden fünf Merkmale: Seid gleichgesinnt; seid mitleidig; seid voll brüderlicher Liebe; seid barmherzig; seid demütig. Die Briefempfänger wussten, dass es unter dem Gesetz hiess: Auge um Auge, Zahn um Zahn (Matthäus 5,38; 2. Mose 21,24). Jetzt gilt es, nach dem Grundsatz der Gnade zu handeln und Böses nicht mit Bösem zu vergelten.
Die Verse 10-12 sind ein Zitat aus Psalm 34. Sie zeigen uns, wie wir als Christen leben sollen und wie wir auf der Erde gute Tage haben können. Dabei müssen wir Folgendes beachten: Die Zunge im Zaum halten, Gutes statt Böses tun und Energie für Frieden aufwenden. Die Augen des Herrn sehen und begleiten uns. Wenn wir das tun, was in seinen Augen recht ist (praktische Gerechtigkeit), wird Er uns segnen und uns seine Güte erweisen. Verüben wir als Christen aber Böses, wird Er uns widerstehen.
Das Verhalten in der Welt
Ab Vers 13 geht es um unser Verhalten in der Welt. Normalerweise sind die Leute recht mit uns, wenn wir uns für das Gute einsetzen und es auch tun. Aber es kann vorkommen, dass wir um der Gerechtigkeit willen zu leiden haben, wenn Ungläubige etwas von uns wünschen, was gegen Gottes Wort ist, und wir es nicht tun.
In solchen Situationen kann es vorkommen, dass Menschen Rechenschaft von uns fordern. Sie möchten wissen, weshalb wir so fromm leben und nichts Unrechtes tun wollen. Dann lasst uns den Mut, aber auch die Sanftmut haben, für unseren Herrn zu zeugen.
Christus – das stärkste Argument
Das Wörtchen «denn» am Anfang von Vers 18 verbindet seine Aussage mit dem, was in den vorangehenden Versen steht. Weil der Herr Jesus einst für unsere Sünden gelitten hat und am Kreuz gestorben ist, wollen wir als Glaubende nicht mehr Böses tun und sündigen, sondern ein Gott wohlgefälliges Leben führen.
Christus ist als Mensch von anderen umgebracht worden. Doch Er blieb nicht im Tod. Er ist auferweckt worden und lebt jetzt in der Herrlichkeit. Obwohl Er nicht mehr auf der Erde lebt, ist der Herr Jesus für uns eine Realität. Wenn wir das Wort Gottes lesen, macht der Geist Gottes Ihn in unseren Herzen lebendig. Wir glauben an Ihn und lieben Ihn, obwohl wir Ihn mit unseren natürlichen Augen nicht sehen (1. Petrus 1,8).
Dass der Herr durch den Geist auf der Erde ist und wirkt, ist nicht neu. Schon vor der Flut predigte Er durch den Geist zu den damals lebenden Menschen, als Noah sie vor der kommenden Flut warnte. Gott hatte lange Geduld. Doch die meisten hörten nicht auf seine Warnung. Dann kam die Flut und brachte sie um. Nur Noah und die Seinen wurden durch die Wasser, in denen die Gottlosen umkamen, gerettet. Noah und seine Familie waren nicht besser als die übrigen Menschen. Auch sie hatten das Gericht verdient. Aber sie nahmen im Glauben in der Arche Zuflucht und überlebten. Uns ging es ebenso. Wir hatten das Gericht verdient. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, der für uns ins Gericht ging, wurden wir gerettet.
Gott ehren
Der erste Vers knüpft an 1. Petrus 3,18 an. Christus hat für uns gelitten, denn als Sündloser lebte Er in einer sündigen Welt. Lieber wollte Er sterben, als Gott ungehorsam sein. Doch diese Entschiedenheit brachte Ihm Leiden bis zum Tod am Kreuz ein. Nun sollen auch wir ein Leben führen, in dem wir lieber leiden als sündigen. Es geht darum, den Forderungen der in uns wohnenden Sünde nicht nachzugeben. Das bedeutet zwar zu leiden, aber dann ruhen wir von der Sünde.
Die «im Fleisch noch übrige Zeit» ist das Leben nach unserer Bekehrung. Die «vergangene Zeit» ist die Zeit, bevor wir an den Herrn Jesus glaubten. In unserem Leben als gläubige Christen soll der Wille Gottes massgebend sein. Das alte Leben, das wir vor der Bekehrung geführt haben, sollen wir ganz aufgeben. Das werden unsere ungläubigen Mitmenschen nicht nachvollziehen können. Vielleicht klagen sie uns sogar an, wir wollten besser sein als sie, nähmen aber die gesellschaftliche Verantwortung in der Welt nicht wahr. Sie lästern uns, indem sie uns falsche Beweggründe unterschieben.
Ungläubige Menschen, die sich den Glaubenden gegenüber so verhalten, müssen einmal dem Herrn Jesus dafür Rechenschaft ablegen.
Den Toten in Vers 6 wurde zu ihren Lebzeiten die gute Botschaft verkündigt, wie sie heute noch gepredigt wird. Wer sie im Glauben annimmt, empfängt neues Leben und damit die Fähigkeit, Gott gemäss zu leben. Wer sie ablehnt, wird von Gott gerichtet.
Einander dienen
Diese Verse spornen uns an, im Kreis der Glaubenden das Gute zu wirken. Das Erste, was wir dabei bedenken müssen, ist, dass alles Sichtbare und Materielle vergehen wird, vielleicht schon sehr bald. Das hilft uns, die richtige Einstellung zum Irdischen zu bekommen. Weil alles vergehen wird, sollen wir durch das Gebet den Kontakt mit dem Himmel suchen und pflegen. Wir dürfen zu unserem himmlischen Vater und zum Herrn Jesus beten.
Diese Gebetsgemeinschaft mit Gott wird unsere Liebe zu den Mitgläubigen fördern. – «Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden» bedeutet nicht Toleranz gegenüber dem Bösen. Wenn Böses unter den Gläubigen vorkommt, muss es Gott gemäss verurteilt und geordnet werden, aber es soll uns nicht auseinander bringen. Gott möchte uns helfen, unsere Glaubensgeschwister trotz Versagen und fleischlichem Benehmen zu lieben.
Die Gastfreundschaft fördert die Bruderliebe. Aber sie bringt Aufwand und Verzicht mit sich. Daher: «Seid gastfrei ohne Murren!»
Jeder Erlöste hat vom Herrn eine Gnadengabe empfangen, mit der er den anderen dienen darf. Wichtig ist, dass wir diesen Dienst in Abhängigkeit vom Herrn tun. Dann werden wir gute Verwalter sein. In Vers 11 werden zwei Aufgabenbereiche unterschieden: das Reden und das Dienen. Das Reden soll unter der Leitung des Heiligen Geistes geschehen. Weil das Dienen viel Geduld und Selbstverleugnung erfordert, kann es nur in der Kraft, die Gott gibt, ausgeübt werden.
Verschiedene Leiden
Durch den ganzen Brief hindurch macht Petrus klar, dass das Glaubensleben Leiden mit sich bringt: Leiden um der Gerechtigkeit und um des Gewissens willen, Leiden für Gutestun und für Bösestun. Leiden, weil wir nicht sündigen wollen, Leiden in der Nachfolge und Leiden als Christ. Wie verhalten wir uns in den verschiedenen Leiden, in die wir kommen können?
Einst sagte der Herr Jesus zu seinen Jüngern: «Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen.» So erfahren wir Verachtung, Spott, vielleicht sogar Verfolgung, wenn wir uns klar zu Ihm bekennen. Doch das soll uns nicht niederdrücken. Denken wir daran, dass wir bald mit unserem geliebten Heiland verherrlicht werden, und freuen wir uns auf diese Zukunft!
Vers 15 spricht von Leiden, die wir uns durch ein verkehrtes Verhalten selbst einbrocken. Der Herr zeigt uns, dass wir zu solchen Handlungen fähig sind, aber Er möchte nicht, dass sie bei uns vorkommen.
In den Schlussversen finden wir das richterliche Handeln Gottes mit uns Menschen. Es fängt bei denen an, die Ihm am nächsten stehen, wird aber auch die Ungläubigen treffen. Doch es gibt einen grossen Unterschied:
- Der Glaubende erfährt die Wege Gottes mit sich in seinem irdischen Leben, wenn Gott ihn erzieht.
- Der Ungläubige, der das Evangelium Gottes in seinem Leben ablehnt, wird von Gott ewig gerichtet werden und in die Hölle kommen.
Ältere und Jüngere
In diesen Versen geht es um die Beziehung zwischen älteren und jüngeren Gläubigen. Petrus wendet sich zuerst an die Älteren. Sie haben die grössere Verantwortung als die Jüngeren. Darum hat er ihnen mehr zu sagen.
Die älteren Brüder werden – weil sie in ihrem Glaubensleben viele Erfahrungen gesammelt haben – beauftragt, die Herde Gottes zu hüten. Es ist nicht ihre, sondern Gottes Herde. Hüten beinhaltet ernähren, beschützen und führen. Die Glaubenden brauchen geistliche Nahrung. Sie müssen vor Gefahren gewarnt und den rechten Weg gewiesen werden. Wie sollen die Ältesten ihre Aufgabe wahrnehmen? Freiwillig, ohne Zwang, nicht um Geld oder Ehre zu erlangen, nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Ihre Aufgabe ist nicht einfach, aber Gott hat ihnen eine besondere Belohnung zugedacht: die Krone der Herrlichkeit.
In Vers 5 spricht Petrus die Jüngeren an. Sie werden einfach ermahnt: Ordnet euch den Älteren unter! Mehr nicht. Aber denken wir daran: Unterordnung heilt, Rebellion hingegen zerstört!
Der zweite Teil von Vers 5 richtet sich an alle Christen. Uns alle soll in den gegenseitigen Kontakten Demut kennzeichnen. Dadurch erschliessen wir die Gnadenquellen Gottes für uns.
Und wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn sich das alles nicht so leicht verwirklichen lässt? Dann wollen wir uns demütig unter Gottes Hand beugen und alle Nöte und Sorgen im Gebet vor Ihn bringen.
Der Gott aller Gnade
Die Probleme im Glaubensleben wollen uns mutlos machen. Wie gut, dass wir alle unsere Sorge auf Gott werfen dürfen, der ein Interesse an uns hat (1. Petrus 5,6.7)!
Was ist das Ziel des Feindes, wenn er als brüllender Löwe auftritt? Er will uns einschüchtern. Doch wir werden aufgefordert, ihm im Glauben zu widerstehen. Denken wir daran: Er ist ein besiegter Feind, und der Herr möchte uns beistehen, wenn Satan uns einschüchtern will (2. Timotheus 4,17).
Zum Schluss richtet Petrus unseren Blick auf Gott selbst. Er ist der Gott aller Gnade. Das bedeutet, dass der Umfang seiner Gnade unerschöpflich ist und dass Gott für jede Situation und jede Not der Seinen eine besondere Art von Gnade bereit hat.
Dieser wunderbare Gott hat uns zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Unser Ziel ist das Haus des Vaters, der ewige Wohnort Gottes. Wenn wir das vor Augen haben, werden wir ermutigt, trotz Schwierigkeiten vorwärts zu gehen, und zwar mit einem Herzen voll Lob und Dank (Vers 11).
Silvanus war der Überbringer dieses Briefes. Die Miterwählte in Babylon ist wohl die Frau von Petrus, denn wir wissen, dass er verheiratet war (1. Korinther 9,5). Markus nennt er seinen Sohn. Wie schön, wenn Alt und Jung in einer guten geistlichen Beziehung miteinander leben. Der Brief endet mit Liebe und Frieden.
Merkmale des Glaubenslebens
Wie der erste Brief des Petrus so ist auch sein zweiter ein Hirtenbrief. Der inspirierte Schreiber ist für das Wohl der Schafe des Herrn Jesus besorgt. Er gibt ihnen Hilfestellungen für das tägliche Glaubensleben und warnt sie vor den drohenden Gefahren. Der Apostel Petrus richtete seine beiden Briefe an die gleichen Empfänger (2. Petrus 3,1). Es waren Menschen mit jüdischer Herkunft, die durch den Glauben an den Herrn Jesus das christliche Glaubensgut empfangen hatten.
Gott hat uns bei unserer Bekehrung alles geschenkt, was wir nötig haben, um als Christen in Gottesfurcht zu leben. Er möchte, dass wir hier zu seiner Ehre sind. Weil wir dies nicht aus uns selbst vermögen, hat Er uns mit allem Nötigen ausgestattet. Bei unserer Bekehrung haben wir durch die Neugeburt ewiges Leben empfangen und besitzen seither den Heiligen Geist, der die Kraft des neuen Lebens ist.
Ab Vers 5 bis Vers 7 spricht Petrus unsere Verantwortung an. Als reich Beschenkte sollen wir nun allen Fleiss anwenden, um mit Gottes Hilfe täglich ein reines Leben, getrennt von der Welt, zu führen. Dieser geistliche Fleiss soll durch acht Merkmale gekennzeichnet sein: Am Anfang steht die Glaubensbeziehung zu Gott und dem Herrn Jesus und am Schluss die göttliche Liebe, die sich in unserem Leben entfalten soll. Doch es gilt, alle acht Merkmale zu beachten und zu verwirklichen, damit unser Glaubensleben ausgewogen bleibt.
Erinnern und befestigen
Die in den Versen 8 bis 10 erwähnten «Dinge» sind die acht Merkmale, die unseren geistlichen Fleiss kennzeichnen sollen: Glauben, Tugend (Entschiedenheit), Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe, Liebe. Wenn sie sich in unserem praktischen Leben zeigen und zunehmen, sind wir im Glauben gesund. Wo sie fehlen, offenbart sich bei einem Gläubigen ein schlechter geistlicher Zustand. Jener Christ hat sowohl den Herrn Jesus als auch das Erlösungswerk aus den Augen verloren. Darum fordert Petrus uns in Vers 10 auf, «diese Dinge» zu tun. Je konsequenter wir im Alltag für Gott leben, umso eher werden wir vor einem Fall bewahrt. Ist es nicht unser aller Wunsch, als Christen zu leben und nicht zu sündigen?
In den Versen 12 und 15 erwähnt Petrus noch zweimal «diese Dinge». Wieder sind es die acht Merkmale, die in 2. Petrus 1,5-7 erwähnt werden. Er erinnert die Briefempfänger an das, was ihr praktisches Glaubensleben auszeichnen soll, und ermuntert sie, dies zu verwirklichen anstatt geistlich einzuschlafen.
Der Märtyrertod von Petrus stand nahe bevor. Doch er wollte bis zuletzt für seinen Herrn arbeiten. Es lag ihm vor allem am Herzen, dass die Schafe der Herde des Herrn Jesus geistlich auf eigenen Füssen standen, wenn er, Petrus, als Hirte nicht mehr da war. – Dazu ist es nötig, dass wir regelmässig die Bibel lesen, um uns so die Glaubenstatsachen in Erinnerung zu rufen.
Der Blick in die Zukunft
Petrus war zusammen mit Jakobus und Johannes auf dem heiligen Berg gewesen, wo die drei einen Blick auf die zukünftige Herrlichkeit des Herrn Jesus werfen durften. Damals hörten sie aus der Wolke, die hier die prachtvolle Herrlichkeit genannt wird, die Stimme Gottes, des Vaters, der bezeugte: «Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.» So wurden diese drei Jünger sowohl Augen- als auch Ohrenzeugen von dem, was die Propheten des Alten Testaments angekündigt hatten. Alles, was die Jünger den Glaubenden über die Macht und Ankunft des Herrn Jesus und über die weitere Prophetie sagten, waren bestätigte Mitteilungen. Sie selbst hatten es gesehen und gehört.
Das prophetische Wort gleicht einer Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. So zeigt uns die Prophetie der Bibel den tatsächlichen Zustand der uns umgebenden Welt. Sie zeigt uns aber auch einen gangbaren Weg, den wir im Glauben gehen können. Das prophetische Wort beleuchtet zudem das Ziel, das vor uns liegt. Es ist einerseits der Herr Jesus selbst, den wir als Morgenstern erwarten, aber anderseits auch der Tag des Herrn, der mit seiner Erscheinung anbrechen wird.
Wie wichtig ist Vers 21! Alles, was in der Bibel steht, wurde durch den Geist Gottes inspiriert, und zwar wörtlich (2. Samuel 23,2; 1. Korinther 2,12.13). Die Bibel ist göttlichen Ursprungs, auch wenn Menschen ihre Worte niedergeschrieben haben.
Falsche Lehrer
So wie es zur Zeit des Alten Testaments falsche Propheten gab, so treten auch in der christlichen Zeitperiode falsche Lehrer auf. Sie verkünden verkehrte Lehren und verführen damit viele Menschen. Unmoral und Habsucht kennzeichnen ihr Leben. Doch Gott wird diese Verführer einmal richten.
Petrus beweist das soeben Gesagte mit drei Beispielen aus dem Alten Testament. Zuerst nennt er Engel, die gesündigt haben. Sie haben ihren Zustand in der Schöpfung verlassen und sich mit den Menschen verbunden (1. Mose 6,1.2; Judas 6). Gott hat sie in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt, wo sie für das endgültige Gericht aufbewahrt werden. Das zweite Beispiel ist die Sintflut, in der die alte Welt untergegangen ist. Nur Noah und seine Familie überlebten in der Arche. Das dritte Gericht ist der Untergang von Sodom und Gomorra. Lot – als einziger Gerechter in jenen gottlosen Städten – wurde mit knapper Not, zusammen mit zwei Töchtern, gerettet.
Gott bewahrt die Seinen, wenn Er das Gericht bringt. Aber welch ein Unterschied zwischen Noah und Lot! Noah war gerecht und gottesfürchtig, so dass sein Leben eine Predigt an seine Mitmenschen war. Lot hingegen lebte in Sodom und passte sich äusserlich der Welt an. Er quälte zwar seine gerechte Seele durch das, was er jeden Tag sah. Doch er trennte sich nicht von der Welt und konnte daher kein Zeugnis für Gott sein (1. Mose 19,14).
Merkmale der Gottlosen
Petrus beschreibt nun die Merkmale der falschen Lehrer in der Christenheit, damit wir diese Verführer erkennen können. Sie sind verwegen und verachten jede Form von Autorität. Ist das nicht ein Merkmal unserer Tage? Im Weiteren sind diese Menschen hemmungslos. Sie sündigen, ohne sich irgendwie zu schämen. Petrus vergleicht sie mit unvernünftigen Tieren. Damit unterstreicht er, dass diese Menschen keine Gläubigen sind, auch wenn sie sich zu den Christen halten und mit ihnen Feste feiern. Sie versuchen, unbefestigte Seelen anzulocken, um sie zum gleichen sündigen Treiben zu verführen. Zudem lieben diese Verführer das Geld.
Petrus vergleicht die falschen Lehrer in der Christenheit mit Bileam, diesem falschen Propheten, der das Volk Israel hätte verfluchen sollen (4. Mose 22 – 24):
- Der Weg Bileams war eigenwillig und krumm und führte schliesslich ins Gericht (4. Mose 31,8). So ist es auch mit den Verführern heute.
- Der Lohn der Ungerechtigkeit weist auf die Habsucht Bileams hin, der sich für seine Weisheit bezahlen liess. Dieser Beweggrund leitet auch die falschen Lehrer (2. Petrus 2,3.13.14).
- Der Esel, der mit Menschenstimme redete, erinnert an die Torheit Bileams. Der falsche Prophet glaubte, Gott für seine habsüchtigen Ziele gewinnen zu können. Da wies ihn seine Eselin zurecht. Sie machte ihm klar, dass er auf diesem eigenwilligen Weg Gott gegen sich hatte. So wird Gott auch die Verkehrtheit der Verführer in der Christenheit entlarven (2. Timotheus 3,9).
Verführen und verführt werden
Mit einigen Vergleichen beschreibt Petrus in Vers 17 den Charakter der falschen Lehrer. Sie versprechen etwas, aber der Durst der Seelen wird nicht gestillt. Der Nebel deutet an, dass man bei ihnen nicht weiss, woran man ist. Das Dunkel der Finsternis weist darauf hin, dass für sie, die ungläubig sind, das Gericht aufbewahrt ist.
Die Verse 18 und 19 beschreiben die Tätigkeit dieser Verführer. Ihre Reden sind beeindruckend, aber sie nähren die Herzen der Glaubenden nicht. Sie verführen andere zur Sünde. Sie versprechen Freiheit, indem sie sagen: Sündigen ist erlaubt. Aber sie und ihre Anhänger sind Sklaven der Sünde (Johannes 8,34).
Die Verse 20 und 21 machen klar, um was für Menschen es sich hier handelt. Es sind solche, die einmal mit dem christlichen Glauben in Kontakt gekommen sind. Sie haben etwas von Jesus Christus erkannt. Sie sind äusserlich den Befleckungen der Welt entflohen, d.h. sie unterlassen die groben Sünden und übernehmen manches Gute, das sie im Leben des Herrn Jesus sehen. Aber durch die Verführung fallen sie wieder in ihr früheres sündiges Leben zurück. Weil sie sich nie bekehrt haben und nicht aus Gott geboren sind, werden sie aufs Neue von der Macht der Sünde überwältigt. Jetzt sind sie schlimmer dran als vorher, denn sie kennen den richtigen Weg und gehen doch den falschen.
Mit einem Sprichwort macht Petrus das Verhalten dieser ungläubigen Menschen deutlich. Weil sie sich nur äusserlich angepasst haben, aber kein neues Leben besitzen, bleiben sie, was sie waren.
Der Wert des Wortes Gottes
In diesem Kapitel redet Petrus die Briefempfänger viermal mit «Geliebte» an. Als Hirte der Schafe des Herrn Jesus hat er ihnen noch Wichtiges zu sagen. In den ersten sieben Versen will er den «Geliebten» den Wert des Wortes Gottes gross machen. Mit den «von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worten» ist das Alte Testament gemeint. «Das Gebot des Herrn und Heilandes durch eure Apostel» verweist auf das Neue Testament. Beide Teile der Bibel sind für uns Christen wichtig.
Doch es wird immer Spötter geben, die das Wort Gottes infrage stellen und lächerlich machen wollen. Unter ihnen sind viele, die mit wissenschaftlichen Argumenten und intellektuellen Schlussfolgerungen die Bibel angreifen. Doch wegen ihres Eigenwillens bekommen diese Menschen keine Klarheit über Gottes Gedanken (Vers 5). Wie entscheidend ist doch die innere Einstellung, mit der wir die Bibel lesen!
Zur Zeit Noahs ging die Welt im Wasser unter. In der Zukunft wird das Gericht in Form von Feuer über die jetzige Schöpfung kommen. Es wird auch die gottlosen Spötter treffen.
Gott ist treu
Doch den «Geliebten» sagt Petrus weiter, dass Gott treu ist und zu seinem Wort steht. Nur ist seine Zeitrechnung eine andere als die unsere (Vers 8). In seiner Langmut hat Er bis heute das Gericht noch zurückgehalten. Er möchte nicht, dass Angehörige der Seinen verloren gehen.
Ab Vers 10 spricht der Apostel vom Tag des Herrn. Dieser beginnt mit dem Erscheinen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Er endet, wenn alles im Brand aufgelöst werden wird (Vers 12). Für die ungläubigen Menschen wird dieser Tag überraschend kommen. Sie werden alles verlieren, wofür sie gelebt haben. Uns soll das Wissen um den bevorstehenden Tag des Herrn und die Aussicht auf den ewigen Zustand (Vers 13) heute zu einem Leben in Absonderung von der Welt und in Gottesfurcht anspornen. Täglich dürfen wir unseren Herrn erwarten. Wie sehr wird diese Hoffnung die Entscheidungen in unserem Leben beeinflussen!
Der in Vers 13 beschriebene ewige Zustand weist einen Unterschied zum Tausendjährigen Reich auf. Unter der Regierung des Herrn wird Gerechtigkeit herrschen (vergleiche Jesaja 32,1), im ewigen Zustand wird Gerechtigkeit wohnen, weil es dann keinen inneren Widerstand gegen Gott mehr geben wird.
Letzte Appelle
Noch zweimal werden die Briefempfänger als Geliebte angeredet. Vers 14 fordert uns auf, mit Fleiss ein gottgefälliges Leben zu führen. Durch die praktische Gemeinschaft mit Gott realisieren wir, wie langmütig Er gegenüber den noch unerretteten Menschen ist. Das spornt uns an, das Evangelium zu verbreiten.
In den Versen 17 und 18 geht es nochmals um eine Warnung vor dem Bösen. Aber dann werden unsere Blicke auf unseren Herrn und Heiland gerichtet. Mit Ihm sollen wir uns beschäftigen. Ihn möchten wir immer besser kennen lernen. Ihm gebührt alle Ehre.
Buchtipp: Für Gott leben – nach dem Beispiel unseres Herrn
Einleitung
Lukas schreibt, wie der Heiland in Bethlehem geboren wurde. Er erzählt auch, dass Jesus Christus den Menschen in Gnade begegnet ist und unzählige Kranke geheilt hat. Beim Lesen seines Evangeliums begleiten wir den Herrn, wie Er in Israel durch die Städte und Dörfer zog, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Leider lehnten Ihn viele Menschen ab. Aber es gab einige, die an Ihn glaubten und Ihm nachfolgten.
Von Anfang an
Lukas war unter den von Gott inspirierten Schreibern des Neuen Testaments der einzige Nichtjude. Er durfte den Herrn Jesus als den Sohn des Menschen, der die Gnade Gottes allen Menschen offenbarte, beschreiben. Der Kernvers dieses Evangeliums steht in Lukas 19,10: «Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist.» Zu diesen Verlorenen zählen alle Menschen von Natur. Auch das Heil, das Jesus Christus am Kreuz von Golgatha erwirkt hat, wird nun allen angeboten (Lukas 24,46.47). Welch eine herrliche Botschaft!
Lukas, von Beruf Arzt, schrieb seinen Bericht an Theophilus, einen gläubigen Griechen. Zu Beginn der christlichen Zeitperiode kursierten manche Erzählungen über das Leben unseres Erlösers. Aber nur vier Berichte sind von Gott inspiriert. Einer davon ist die Arbeit von Lukas, der allem von Anfang an genau gefolgt war. Was wir vor uns haben, ist ein göttlicher Bericht über Jesus Christus. Gott liess ihn durch einen von Ihm ausgewählten Diener niederschreiben.
Als Arzt durfte Lukas ausführlich über die Menschwerdung des Sohnes Gottes berichten (seine Geburt, seine Kindheit, sein Wachstum). Weiter stellt er Ihn als den sündlosen Menschen vor, der Tag für Tag im Gehorsam und in Abhängigkeit von seinem Gott hier lebte. Wie zutreffend war das Zeugnis des römischen Hauptmanns, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war: «Wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht!»
Gabriel bringt Zacharias eine Botschaft
Es war eine traurige Zeit in Israel. Herodes, ein Edomiter, regierte als König in Judäa. Das Volk Gottes lebte unter fremder Herrschaft. Zudem hatte sich Gott während 400 Jahren nicht mehr direkt bezeugt. Maleachi war der letzte Prophet gewesen, den Gott als seinen Boten zu Israel gesandt hatte. Aber so, wie es zur Zeit Maleachis einige gab, die inmitten des ungläubigen Volkes den Herrn fürchteten, so finden wir es auch zu Beginn des Lukas-Evangeliums. Es gab noch eine geringe Zahl Gottesfürchtiger in Israel, die in Treue vor Gott lebten und den Messias erwarteten. Zu ihnen gehörte das alte Priesterehepaar Zacharias und Elisabeth.
Vermutlich hatten die beiden während längerer Zeit um ein Kind gebetet. Doch ihre Bitte war bis dahin nicht erhört worden. Wir können die Bestürzung und die Furcht von Zacharias verstehen, als plötzlich, während seines Priesterdienstes im Tempel, ein Engel vor ihm stand und ihm mitteilte, seine Frau würde einen Sohn bekommen. Er nannte ihm weiter den Namen des Kindes und erklärte ihm, was für eine besondere Person dieser Sohn werden würde: Johannes durfte der Vorläufer des Messias sein, auf den das Volk schon so lange wartete. Die in Vers 14 angekündigte Freude können wir gut verstehen. Wenn der Herold erschien, würde auch der Messias folgen.
Johannes sollte von Mutterleib an ein Nasir, ein Gottgeweihter sein (4. Mose 6). Sein Dienst für Gott würde darin bestehen, die Menschen und ihre Herzen für das Kommen des Messias vorzubereiten.
Zacharias ist kleingläubig
Anstatt sich über diese Nachricht zu freuen, zweifelte Zacharias an der Erfüllung der göttlichen Zusage. Ungläubig fragte er: Wie soll das gehen, da wir ein altes Ehepaar sind? Aus Vers 19 spürt man förmlich die Entrüstung des Engels über den Unglauben von Zacharias, nachdem Gabriel ihm eine so gute Nachricht überbracht hatte. Eine zeitlich begrenzte Strafe war die Antwort auf die Haltung des Priesters. – Zweifeln nicht auch wir manchmal, anstatt dem Wort Gottes einfach zu vertrauen?
Die Menschen, die lange auf den diensttuenden Priester warten mussten, merkten, dass im Tempel etwas Besonderes geschehen war. Sie wussten aber nicht was, und Zacharias konnte es ihnen nicht sagen. Als stummer Mann kehrte er nach Ablauf seiner Dienstzeit nach Hause zurück.
Und was geschah weiter? Elisabeth wurde schwanger, wie es der Engel angekündigt hatte. Die Worte von Vers 25 lassen erkennen, was für eine grosse Freude diese Gebetserhörung für sie war.
Der stumme Priester ist ein Bild des Volkes Israel heute. Die Juden haben ihren Messias im Unglauben abgelehnt und sind daher unfähig, Gott für sein Erbarmen zu loben.
Aber ist nicht jeder, der noch nicht an den Herrn Jesus als seinen Erlöser glaubt, ebenso stumm, wenn es um das Lob Gottes geht? Nur der Erlöste kann wirklich loben.
Gabriel bringt Maria eine Botschaft
Einige Monate später wurde der Engel Gabriel wieder mit einer Botschaft Gottes auf die Erde gesandt, dieses Mal zu einer jungen, gottesfürchtigen Frau. Die Jungfrau Maria, zu der Gabriel kam, war aus dem Stamm Juda und wie Joseph, ihr Verlobter, aus der Nachkommenschaft Davids.
Der Engel begrüsste sie mit der Anrede «Begnadete». Welch eine grosse, einmalige Gnade wurde dieser jungen Frau zuteil: Sie durfte die Mutter unseres Erlösers werden. Ihrer Bestürzung begegnete der Engel mit dem tröstlichen «Fürchte dich nicht!» Sie, die von Natur aus auch eine Sünderin war wie alle Menschen, hatte bei Gott Gnade gefunden. Sie war eine Gläubige, die wusste, dass auch sie einen Heiland nötig hatte (Lukas 1,47).
Dann hörte sie die herrlichste Botschaft, die je einer Frau mitgeteilt worden ist. Sie durfte die Mutter des Messias werden. Ihren Sohn sollte sie Jesus (= der Herr ist Rettung) nennen. Weil sie nicht wusste, wie dies gehen sollte, stellte sie die Frage in Vers 34. Das war nicht Unglaube wie bei Zacharias (Lukas 1,18).
Aus der Antwort des Engels wird klar, dass Jesus Christus nicht nur wahrer, sündloser Mensch (das Heilige) war. Infolge der Zeugung durch den Heiligen Geist war Er auch der Sohn Gottes. Der ewige Sohn Gottes, wie Johannes Ihn uns vorstellt (Johannes 1,1.14) wurde Mensch, blieb aber Gott. Gott und Mensch in einer Person – ein für uns unergründliches Geheimnis! – Demütig, aber voll Vertrauen sagte Maria schliesslich: «Mir geschehe nach deinem Wort.»
Maria besucht Elisabeth
Als Maria vom Engel erfahren hatte, dass Elisabeth, ihre Verwandte, ebenfalls schwanger war, machte sie sich auf den Weg zu ihr. Als sie dort ankam und Elisabeth begrüsste, zeigte Gott der Frau des Priesters auf besondere Weise, wen sie vor sich hatte: die Mutter ihres Herrn! Diese beiden im Alter so unterschiedlichen Frauen hatten die gleiche gottesfürchtige Herzenseinstellung. Voll Vertrauen freuten sie sich über das, was Gott im Begriff stand, für sein irdisches Volk und im Weiteren für alle Menschen zu tun. Ist ihre Freude, die von einem festen Glauben genährt wurde, nicht nachahmenswert?
In einem Gedicht oder Lied rühmte Maria Gott, den Herrn. Sie blieb demütig, erkannte aber die grosse Gunst und Barmherzigkeit, die Gott ihr erwies. Doch sie rühmte nicht nur die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, sie vergass auch seine Heiligkeit nicht.
Barmherzigkeit, die in diesem Kapitel fünfmal erwähnt wird (Lukas 1,50.54.58.72.78), und Gnade werden uns in diesem Evangelium auf jeder Seite begegnen, aber nie auf Kosten der Heiligkeit. Das Leben Jesu in Gnade gegenüber den Menschen trägt die Überschrift: «Ausgenommen die Sünde» (Hebräer 4,15).
Nachdem diese beiden frommen Frauen einander im Glauben gestärkt hatten, trennten sie sich wieder, damit jede ihre Aufgabe an dem Platz erfüllen konnte, wo Gott sie haben wollte.
Johannes wird geboren
Dann kam für Elisabeth der Zeitpunkt der Geburt. Sie gebar einen Sohn, wie der Engel es ihrem Mann vorausgesagt hatte. Alle Nachbarn und Verwandten freuten sich mit Elisabeth und rühmten die Barmherzigkeit des Herrn, die Er diesem alten, treuen Ehepaar erwiesen hatte.
Es scheint, dass man in jener Zeit im Zusammenhang mit der Beschneidung, die nach dem Gesetz am achten Tag nach der Geburt zu erfolgen hatte, dem Neugeborenen den Namen gab (Vers 59; Lukas 2,21; 3. Mose 12,3). Dabei war es gebräuchlich, dass der Sohn den Namen des Vaters bekam. Doch hier lag die Sache anders. Der Engel hatte Zacharias klar gesagt: «Du sollst seinen Namen Johannes (= der Herr ist gütig) nennen (Lukas 1,13). Das wusste auch Elisabeth, und sie verlangte es so. Doch die Verwandten waren nicht einverstanden. Als der stumme Vater Zacharias die Sache schriftlich bestätigte: Johannes ist sein Name, wurde seine Zunge gelöst. Die zeitlich begrenzte Züchtigung Gottes war vorüber.
Nun konnte er mit Worten den Willen Gottes bekräftigen. Aber dann öffnete er seinen monatelang stummen Mund zum Lob Gottes. Aus dem zweifelnden Priester war ein Anbeter geworden, der Gott lobte.
Das alles blieb nicht ohne Wirkung auf die Menschen, die davon hörten. Herzen wurden aufgerüttelt. Sie merkten, dass Gott am Werk war. So klein wie Johannes war – erst ein neugeborenes Baby –, so heisst es doch: «Die Hand des Herrn war mit ihm.» Wirklich, ein aussergewöhnliches Kind!
Zacharias lobt Gott
Nachdem die zeitliche Züchtigung Zacharias vorüber war, konnte Gott ihn als Werkzeug für eine prophetische Aussage benutzen. Dazu wurde er mit Heiligem Geist erfüllt. Mit seinen Worten lobte er Gott, der im Begriff stand, seinem irdischen Volk die früher gemachten Verheissungen über den Messias wahr zu machen.
Das Kommen von Christus (= Messias) beinhaltete Erlösung, Heil und Rettung für Israel. Dass dies aber nur durch den Kreuzestod des Heilands möglich wurde, wird hier nicht erwähnt. Warum wohl nicht? Weil der Tod des Herrn Jesus auch eine Folge der Ablehnung, des Hasses und der Verwerfung durch sein Volk war, und dies zeigte sich erst im Lauf seines Lebens.
Was Zacharias unter der Leitung des Geistes Gottes prophezeite, wird sich aber vollständig erfüllen. Rettung von ihren Feinden erlebten die Juden damals nicht. Aber sie werden es in der Endzeit erfahren. Die Erkenntnis des Heils in Vergebung ihrer Sünden blieb auf eine kleine Anzahl aus dem Volk beschränkt: nur die, die an den Herrn Jesus glaubten. Am Anfang der Apostelgeschichte ist von 120 Personen die Rede. Das Volk als Ganzes war nicht bereit, den Sohn des Höchsten zu empfangen. Sie merkten nicht, wie sehr sie in Finsternis und Todesschatten sassen und dieses Licht aus der Höhe so nötig gehabt hätten.
Johannes wurde ein Prophet des Höchsten. Die Zeit bis zu seinem öffentlichen Auftreten verbrachte er in den Wüsteneien. Als Nasir lebte er abgesondert von allen, erstarkte aber im Geist.
Jesus wird geboren
Ein halbes Jahr nach der Geburt von Johannes wurde der Heiland geboren. Die Anfangsverse zeigen uns etwas vom Wirken Gottes, der im Verborgenen alle Fäden in seiner Hand hält – für jeden Glaubenden ein überaus tröstlicher Gedanke!
Der Prophet Micha hatte vorausgesagt, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Aber Maria lebte mit Joseph, ihrem Verlobten, in Galiläa. Nun lenkte allmächtige Gott die Weltereignisse so, dass der römische Kaiser eine Verordnung erliess, die von jedem seiner Untertanen verlangte, sich in seiner Herkunftsstadt einschreiben zu lassen (vermutlich in ein Steuerregister oder in eine ähnliche Liste). Diese äusseren Umstände zwangen Joseph mit seiner verlobten Frau, die schwanger war, nach Bethlehem zu reisen. Als sie dort waren, kam der Geburtstermin. Der Geist Gottes beschreibt die Geburt unseres Herrn Jesus Christus mit einfachen Worten. Für die damalige Welt war dieses Ereignis nichts Besonderes, eher etwas Nebensächliches. Aber für Gott war «die Fülle der Zeit» gekommen, in der sein Sohn als Mensch von einer Frau geboren wurde (Galater 4,4).
Im Weiteren unterstreicht der Heilige Geist die Armut der Eltern Jesu. Sie fanden keinen Raum in der Herberge. Kein Platz für so arme Leute! Nun musste Maria ihren erstgeborenen Sohn irgendwo in einem Tierunterstand zur Welt bringen. Da lag der Schöpfer und Erhalter des Universums in Windeln gewickelt in einer Krippe! Wie arm ist Er, der doch unendlich reich war, für uns geworden (2. Korinther 8,9)!
Die Engel bei den Hirten
Wem teilte Gott zuerst mit, dass sein Sohn als Mensch in diese Welt hineingeboren worden war? Einfachen Hirten, die in jener Nacht auf freiem Feld über ihre Herden Wache hielten! Bestimmt gehörten sie zu den wenigen Gottesfürchtigen in Israel, die bewusst auf den Messias warteten.
Aber als der Engel des Herrn zu ihnen trat und die Herrlichkeit des Herrn sie umleuchtete, da fürchteten sie sich doch mit grosser Furcht. Doch der Engel hatte eine frohe Botschaft für sie, die sich ihres Zustands vor Gott bewusst waren. Christus, der Heiland, der Erretter und Helfer, war geboren. Darum brauchten sie sich nicht zu fürchten. Sie durften Ihn im Glauben annehmen.
Die Menge des himmlischen Heeres, die plötzlich bei dem Engel erschien, rühmte die Folgen des Kommens von Christus in diese Welt. Durch Ihn sollte Gott verherrlicht werden und schliesslich Frieden auf der Erde herrschen. Doch dazu musste Jesus Christus am Kreuz sterben (Kolosser 1,19.20). Nur auf der Grundlage dieses Opfers können sündige Menschen mit Gott versöhnt werden, und nur auf dieser Basis wird Christus sein Friedensreich errichten können.
Die Hirten sehen das Kind in der Krippe
Die Hirten glaubten dem Wort des Engels, machten sich auf den Weg und fanden alles bestätigt. Doch sie behielten die Sache nicht für sich. Mit glücklichen, dankbaren Herzen lobten sie Gott und erzählten weiter, was sie vom Heiland wussten.
Acht Tage nach der Geburt wurde der Sohn der Maria beschnitten, wie es das Gesetz vorschrieb. «Da wurde sein Name Jesus genannt.» Jesus: ein Name, der das Herz jedes Glaubenden froh macht! Was bedeutet er für dich?
In Vers 22 geht es um die Reinigung der Maria, wie dies in 3. Mose 12 vorgeschrieben war. Doch Maria und Joseph konnten kein Lamm aufbringen. So brachten sie das dar, was Gott im Gesetz für die Armen vorgesehen hatte: zwei Tauben (3. Mose 12,8). Unser Heiland war ein Kind armer Eltern!
Simeon und Anna
Um alles zu erfüllen, was das Gesetz verlangte, mussten Maria und Joseph mit ihrem einige Wochen alten Kind in den Tempel nach Jerusalem gehen. Dort wartete ein alter gottesfürchtiger Mann auf den Trost Israels. Gott hatte ihm durch den Heiligen Geist bezeugt, dass er vor seinem Tod den verheissenen Christus sehen würde. Welch eine Freude muss es für Simeon bedeutet haben, dieses Kind auf die Arme nehmen zu dürfen! Doch er wusste, dass sich die Menschen an dieser Person scheiden würden: Die einen glauben an Ihn, die andern – leider sehr viele – verwerfen Ihn.
In Jerusalem gab es noch andere Herzen, die vom verheissenen Erlöser erfüllt waren. Zu ihnen gehörte die Prophetin Anna, eine alte Witwe. Der Tempel war sozusagen ihr Wohnort geworden. Auch sie durfte Dem begegnen, auf den sie wartete. Dafür lobte sie Gott für seine Gnade. Dann aber redete sie von Ihm zu all denen, die wie sie zu den Wartenden gehörten.
Jesus als Zwölfjähriger im Tempel
Seine Kindheit verbrachte Jesus in Nazareth. Der Geist Gottes bezeichnet diesen Ort als «ihre Stadt», d.h. die Stadt Josephs und Marias. Von dort reiste dieses gottesfürchtige Ehepaar alljährlich zum Passahfest nach Jerusalem. Als ihr erstgeborener Sohn zwölf Jahre alt war, nahmen sie Ihn mit.
Nach dem Fest kehrten die Eltern zusammen mit vielen anderen nach Galiläa zurück und merkten nicht, dass ihr Junge in Jerusalem geblieben war. Am Abend des ersten Reisetages suchten sie Ihn erfolglos unter den Verwandten und Bekannten. Wo war Er? Nach dreitägigem Suchen in Jerusalem fanden sie Ihn, «wie er inmitten der Lehrer sass und ihnen zuhörte und sie befragte».
Welch ein schönes Bild: Jesus Christus – die Hauptperson – aber noch ein Junge, der demütig zuhörte und mit Interesse Fragen stellte! Der nächste Vers zeigt, wer Er wirklich war: der Gott seines Wortes. Als solcher war Er allen Lehrern überlegen (Psalm 119,99.100).
Die Worte Marias beweisen, dass sie noch nicht wirklich erkannt hatte, wer ihr Sohn war – der Sohn Gottes, der im Haus seines Vaters sein wollte, ja, sein musste, denn Er war gekommen, um Gottes Wohlgefallen zu tun (Psalm 40,8.9).
Doch wie schön sind die Schlussverse! Obwohl Er der Sohn Gottes war, blieb Er der unterwürfige Mensch, der sich in seinem jungen Alter seinen menschlichen Eltern unterordnete. Zudem erkennen wir, wie Er als Mensch ein ganz normales Wachstum aufwies. Er war in jeder Hinsicht der Mensch nach Gottes Gedanken.
Johannes ruft zur Buße auf
Die Verse 1 und 2 illustrieren den traurigen äusseren und inneren Zustand des irdischen Volkes Gottes. Das Land Israel war nicht frei, sondern in verschiedene Herrschaftsgebiete aufgeteilt. Regenten aus den Nationen bestimmten über die Juden. Über allem stand der römische Kaiser. Auch um das von Gott eingesetzte Priestertum stand es nicht gut. Es gab zwei Hohepriester statt nur einen!
Unter diesen Umständen sandte Gott den letzten Propheten des Alten Bundes zu seinem Volk. Dieser rief die Menschen nicht zum Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes auf – das war der Dienst seiner Vorgänger gewesen –, sondern zur Buße. Buße ist eine tiefgehende Herzenssache, die zum Bekennen der Sünden und zur Vergebung (Markus 1,5), aber auch zu einer Umkehr im Leben führt. Die Predigt von Johannes hatte zum Ziel, die Herzen für das Kommen des Messias bereit zu machen.
Johannes musste seinen Zuhörern ernst ins Gewissen reden, denn viele dachten, ihre Abstammung von Abraham genüge vor Gott. Nein, die äussere Zugehörigkeit zum Volk Gottes genügte nicht. Mit dieser Einstellung gingen sie dem Gericht entgegen (Vers 9).
Auf die Fragen der Menschen erklärte ihnen Johannes, wie sich echte Buße zeigt. Durch die der Buße würdige Frucht sollte die Umkehr sichtbar werden. Wer mehr besass als andere, sollte den Armen helfen. Die Zöllner sollten nicht mehr fordern, als festgesetzt war. Und die Söldner sollten sich mit ihrem Sold begnügen und sich nicht gewaltsam bereichern.
Johannes kündigt Christus an
Wenn Johanns der Täufer in seiner Predigt Jesaja 40,3-5 zitierte, sprach er auch vom Kommen des Messias (Vers 6). Wir können daher die Überlegungen seiner Zuhörer verstehen, wenn sie sich fragten, ob er wohl der Christus sei. Der Prophet verneinte diesen Gedanken klar und zeigte dann, wie viel grösser und stärker der nach ihm Kommende war. Verglichen mit Jesus Christus war Johannes nicht einmal wert, Ihm den geringsten Sklavendienst zu tun (Vers 16). Welch eine demütige Gesinnung offenbarte dieser Mann!
Vom Messias, der nach ihm kommen würde, sagte er: Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Die Taufe mit Heiligem Geist war die Folge der Rückkehr des Herrn Jesus in den Himmel und geschah damals zu Pfingsten (Apostelgeschichte 2). Die Taufe mit Feuer spricht von Gericht, wie Vers 17 deutlich macht. Sie findet statt, wenn Christus zum zweiten Mal auf die Erde kommt, dann nicht mehr in Niedrigkeit, sondern in Macht und Herrlichkeit.
Die Verse 18-20 behandeln das Ende des Dienstes von Johannes. Sie geben auch die Gründe an, warum Herodes ihn ins Gefängnis einschloss und später enthaupten liess (Markus 6,17-29). Er hatte den gottlosen König wegen der unrechtmässigen Heirat der Frau seines Bruders und wegen alles Bösen zurechtgewiesen. Das Ende des Dienstes des Vorläufers des Messias wird hier vorweggenommen, weil mit dem nächsten Vers der Dienst des Herrn Jesus beginnt. Dieser war ein Dienst der Gnade.
Jesus wird getauft
Unter den vielen Menschen, die zu Johannes kamen, um Buße zu tun und sich taufen zu lassen, war auch Jesus. Als sündloser Mensch hatte Er nicht nötig, Buße zu tun. Doch in seiner Gnade stellte Er sich neben seine Landsleute, die die Taufe zur Buße brauchten. Da öffnete Gott den Himmel über Ihm. Mit einer für Menschen verständlichen Stimme bezeugte Er, dass dieser demütige Mensch, der durch das Gebet seine Abhängigkeit von Ihm ausdrückte, sein geliebter Sohn war. An Ihm fand Er sein Wohlgefallen. In der Ewigkeit hatte Gott, der Vater, seine Wonne am Sohn seiner Liebe. Nun ruhte sein Wohlgefallen auch auf dem Sohn des Menschen, der gekommen war, um Gottes ewige Ratschlüsse auszuführen.
Bei der Taufe Jesu geschah noch etwas anderes: Der Heilige Geist fuhr in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf Ihn hernieder. Dadurch wurde Er für seinen öffentlichen Dienst gesalbt, den Er unter der Leitung und in der Kraft dieses Geistes ausübte (Lukas 4,1; Apostelgeschichte 10,38).
Warum steht das Geschlechtsregister in diesem Evangelium am Anfang seines öffentlichen Dienstes und nicht am Anfang seines Erdenlebens? Hier geht es nicht um den Beweis, dass der Herr Jesus in Wahrheit der Messias ist, sondern dass Der, den Gott soeben als seinen Sohn bekannte, wahrer Mensch ist. Es ist eigentlich das Geschlechtsregister der Maria. Er war, «wie man meinte», ein Sohn Josephs. In Wahrheit war Er Mensch, nicht aufgrund seiner Beziehung zu Joseph, sondern zu Maria.
Jesus in der Wüste
Bevor der Herr Jesus öffentlich auftrat (Lukas 4,14.15), führte Ihn der Geist in die Wüste, wo Er vom Teufel versucht wurde. Diese Zeit der Erprobung oder Versuchung dauerte 40 Tage und brachte seine Vollkommenheit auf besondere Weise zum Vorschein.
Zunächst müssen wir festhalten, dass unser Heiland nicht versucht wurde, um zu sehen, ob Er standhaft bleiben würde. Er konnte nicht sündigen. Diese Zeit erbrachte vielmehr den Beweis, dass der Teufel bei Ihm keinen Anknüpfungspunkt finden konnte (Johannes 14,30). Vergleichen wir den Herrn mit Adam, dem ersten Menschen, dann sehen wir einen grossen Unterschied. Adam lebte unter den günstigsten Umständen. Als er von Satan versucht wurde, fiel er. Jesus, der zweite Mensch vom Himmel, blieb unter den schwierigsten Umständen (Wüste, Hunger) siegreich.
Der Teufel versuchte den Herrn durch natürliches Verlangen, durch weltliche Begierden und durch geistliche Versuchungen zu Fall zu bringen. Doch der von Gott abhängige Mensch liess sich in keine Diskussion mit dem Teufel ein. Seine Antworten stützten sich immer auf das geschriebene Wort Gottes. Da wich der Teufel für eine Zeit von Ihm. In Gethsemane war er wieder da, um den Heiland durch die Schrecken des Kreuzestodes, die vor seiner Seele standen, vom Weg des Gehorsams und der Hingabe an Gott abzubringen (Lukas 22,40-46). Doch der Herr blieb Sieger, sowohl in Gethsemane als auch am Kreuz (Hebräer 2,14.15).
In der Synagoge von Nazareth
Der Herr Jesus begann seinen öffentlichen Dienst in Galiläa, indem Er in den Synagogen lehrte. Dabei kam Er auch nach Nazareth, wo Er auferzogen worden war und wo Ihn daher alle gut kannten. Er las eine Stelle aus dem Propheten Jesaja vor (Jesaja 61,1.2), hielt aber mitten im Satz inne. In Jesaja 61 werden das Jahr des Wohlgefallens des Herrn und der Tag der Rache unseres Gottes zusammen genannt. Jesus sprach aber nur vom angenehmen Jahr des Herrn. Das war die Zeit damals. Er, von dem diese Jesajastelle redet, war gekommen, um seinem Volk die Gnade zu bringen.
Obwohl sie sich über seine Worte der Gnade verwunderten, regte sich Widerstand. War dieser nicht der Sohn von Joseph, den sie alle kannten? Er konnte doch nicht der Messias sein! Die Wunder, die Er an anderen Orten gewirkt hatte, hätten sie angenommen, wenn Er sie auch in Nazareth getan hätte. Aber als Messias lehnten sie Ihn ab.
Der Herr Jesus war nicht der erste Prophet, der von seinen nächsten Landsleuten abgelehnt wurde. Aber diese Ablehnung im Unglauben würde dazu führen, dass Gott seine Gnade anderen zukommen liess.
Beispiele aus dem Alten Testament zeigten, dass dies mehr als einmal der Fall war. Doch das wollten die Leute von Nazareth nicht hören. Ihre Wut gegen Ihn steigerte sich so weit, dass sie Ihn vom Berg hinunter zu Tode gestossen hätten, wenn es ihnen gelungen wäre. Aber die Stunde seines Todes war noch nicht gekommen.
In Vollmacht lehren und wirken
Auch in Kapernaum, einer Stadt am See Genezareth, lehrte Er an den Sabbaten. Er sprach anders als die Schriftgelehrten. Das merkten seine Zuhörer bald. Sein Wort predigte Er mit Vollmacht. Wie hätte es anders sein können, wenn Gott selbst, in der Person seines Sohnes, der Mensch geworden war, sein Wort verkündigte?
In der Synagoge war ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte. Vermutlich hatte er sich bis dahin ruhig verhalten. Aber als der Herr Jesus in die Synagoge kam, regte sich der Dämon. Er wusste, dass der Sohn Gottes den bösen Geistern befehlen konnte und sie gehorchen mussten. Er konnte sie sogar verderben. Wenn die Menschen den demütigen Mann aus Nazareth verkannten, die Dämonen wussten ganz genau, mit wem sie es zu tun hatten.
Mit der gleichen göttlichen Vollmacht, mit der Jesus Christus das Wort verkündigte, gebot Er dem bösen Geist zu schweigen und von dem Menschen auszufahren. Der Dämon musste gehorchen. Erschreckt fragten die Anwesenden: «Was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern, und sie fahren aus.»
Die Menschen waren erstaunt und beeindruckt. Sie erzählten das Erlebte weiter. Aber glaubten sie auch an Ihn? Erkannten sie die Person, die unter ihnen lebte und wirkte? Es war ihr Messias (= Christus), Gott, der Sohn, als wahrer, vollkommener Mensch.
Der Herr heilt Kranke
Von der Synagoge kam der Herr Jesus in das Haus von Simon. Dieser Mann hatte Christus bereits kennengelernt (Johannes 1,41.42). Damals hatte der Heiland ihm einen zweiten Namen gegeben: Kephas oder Petrus. Der Herr hatte ihn auch schon in seine Nachfolge gerufen, wie wir dies aus Markus 1,16.17 erkennen können. Nun war der Heiland zu Gast im Haus von Petrus, dessen Schwiegermutter aber von einem starken Fieber befallen war. Auf die Bitte der Anwesenden heilte Er sie. – Die fieberkranke Frau gibt uns das Bild eines unbekehrten Menschen. Er hat keinen Frieden, ist beunruhigt durch sein belastetes Gewissen. Ruhelos lebt er in einer Welt voll Unruhe, Hast und Eile. Nur Einer kann ihm Ruhe und Frieden geben: der Heiland, der für sündige Menschen am Kreuz gestorben ist. Und was ist die Folge, wenn jemand Frieden und Ruhe beim Herrn Jesus gefunden hat? Er darf Ihm dienen (Vers 39).
Das Elend im Volk Gottes war gross. Es gab nicht nur viele Kranke; manche waren auch in den Bann Satans geraten und von Dämonen besessen. Aber Christus, der Sohn Gottes, heilte in seiner Gnade alle, die zu Ihm gebracht wurden.
Als wahrer, abhängiger Mensch brauchte auch der Herr Jesus das Alleinsein mit Gott. Daher suchte Er einen öden Ort auf. Doch die Menschen liessen Ihn nicht in Ruhe. Sie wollten Ihn bei sich behalten. Er aber war für das ganze Volk gekommen. Darum zog Er weiter.
Ein wunderbarer Fischfang
Viele Menschen drängten sich um den Herrn Jesus, um seine Worte zu hören. Um von allen besser gehört zu werden, bat Er Simon (Petrus), Ihn mit seinem Schiff ein wenig hinauszufahren. Von hier aus lehrte Er dann die am Ufer stehende Menge.
Warum war der Herr gerade in das Schiff von Petrus gestiegen? Er wollte auch sein Herz erreichen. Wäre Simon weiter mit seinen Netzen beschäftigt geblieben, hätte er wohl nicht so aufmerksam zugehört, wie jetzt, wo er untätig beim Herrn im Schiff sass.
Der Herr verlangt von den Seinen nichts, ohne es in reichem Mass zu erstatten. Das sehen wir auch hier. Für die Zeit und das Schiff, die Petrus dem Herrn zur Verfügung stellte, wurde er reich entschädigt. Dabei lernte er sowohl seinen Herrn und Meister als auch sich selbst besser kennen.
Der wunderbare Fischfang zeigte Petrus, dass Der, den er Meister nannte, auch Herr über die Fische, also Gott, der Schöpfer, ist. Doch im gleichen Moment erkannte Petrus sich auch im Licht Gottes. Ihm wurde seine ganze Sündhaftigkeit bewusst. Da dachte er: Wir zwei – der Heilige Gottes und ich –, wir passen nicht zusammen. Doch wie wunderbar lautet die Antwort des Herrn: «Fürchte dich nicht!» Das konnte Er Petrus sagen, weil Er an seinen eigenen Tod am Kreuz dachte. Dann würde Er nicht nur für die Sünden von Petrus, sondern auch für dessen sündige Natur sterben. Als Glaubender, der dem Wort des Herrn vertraute, konnte Petrus nun ein Menschenfischer werden.
Heilung des Aussätzigen und des Gelähmten
Der Aussätzige, der vor Jesus auf sein Angesicht fiel, glaubte, dass der Herr ihn heilen könne, aber er wusste nicht, ob die Gnade sich auch ihm zuwenden würde. Er wurde in seinem Vertrauen nicht enttäuscht.
Dadurch, dass er die Reinigungsvorschriften eines geheilten Aussätzigen erfüllte, musste der Priester erkennen, dass Gott unter ihnen war, denn der Aussatz war aus der Sicht der Menschen unheilbar.
Wenn die Gnade sich bei der Heilung des Aussätzigen in ihrer reinigenden Wirkung zeigte, so sehen wir bei dem Gelähmten, wie die Gnade vergibt. Das war die Antwort des Herrn Jesus auf die grossen Bemühungen des Glaubens dieser vier Männer. Trotz der Hindernisse brachten sie ihren kranken Freund, der ebenfalls glaubte, vor Ihn.
Nicht alle hörten dem Herrn Jesus aufrichtig zu. Pharisäer und Gesetzeslehrer waren mit kritischer Einstellung aus Jerusalem gekommen, um zu hören, was dieser unbekannte Lehrer zu sagen hatte. Als Er von Sündenvergebung sprach, fragten sie sofort: «Wer kann Sünden vergeben, ausser Gott allein?» Darin hatten sie recht. Aber als der Herr Jesus ihnen durch die Heilung des Gelähmten bewies, dass Er Gott, der Herr, war, wie Ihn Psalm 103,3 beschreibt, wollten sie nicht an Ihn glauben. Der Geheilte aber hatte nicht nur die Vergebung seiner Sünden empfangen, sondern auch die Kraft, um aufzustehen und nach Hause zu gehen. Diese wunderbare Entfaltung der Gnade führte zur Verherrlichung Gottes durch den Geheilten und all jene, die das Ganze mit Staunen verfolgt hatten.
Gnade kontra Gesetz
In der nächsten Begebenheit sehen wir, wie der Herr Jesus in seiner Gnade zum Anziehungspunkt für Levi wurde. Die Aufforderung: «Folge mir nach!», beantwortete der Zöllner sofort, indem er alles verliess, aufstand und dem Herrn nachfolgte.
«Alles verlassen» heisst hier nicht, dass er nicht mehr in sein Haus zurückkehrte. Es bedeutet, dass Levi nun alles, was er war und besass, seinem Herrn und Meister zur Verfügung stellte. In diesem Sinn gehörte es nicht mehr ihm. Er hatte es verlassen.
Dass er seinen Besitz in den Dienst Jesu stellte, sehen wir aus Vers 29. Levi nahm die Gelegenheit wahr, ein grosses Mahl zu machen und viele Kollegen und andere einzuladen, damit auch sie den Herrn Jesus kennenlernten. Wieder regte sich der Widerstand der religiösen Führer der Juden, die den Jüngern Jesu vorwarfen, mit Sündern zu essen. Wie schön ist die Antwort des Herrn! Er war für die gekommen, die wussten, dass sie einen Heiland brauchten. Die Selbstgerechten standen sich selbst im Weg.
Der Schluss des Kapitels zeigt, dass die Zeitperiode des Gesetzes ihrem Ende zuging und etwas Neues begann: die Zeit der Gnade. Gesetz, das vom Menschen nur fordert, und Gnade, die unverdientermassen gibt, sind unvereinbar. Das wollte der Herr mit den Illustrationen in den Versen 36-38 deutlich machen.
Warum wird der alte Wein (das Gesetz) von vielen vorgezogen? Weil das Gesetz vom natürlichen Menschen etwas fordert und er sich lieber bemühen will, als zuzugeben, dass er Gott nicht gefallen kann.
Die Sabbatfrage
Als die Jünger am Sabbat Ähren abpflückten und die Körner im Gehen assen, betrachteten die streng religiösen Leute dies als Übertretung des Sabbatgebots. Der Herr musste ihnen klarmachen, dass es nicht um das peinlich genaue Einhalten unbiblischer Sabbatgebote ging, sondern um die Anerkennung des Sohnes des Menschen. Er, der vor ihnen stand, war auch Herr des Sabbats. Doch sie verwarfen Ihn, von dem David ein schwaches Vorausbild war. Obwohl dieser zum König über Israel gesalbt war, wurde er verworfen und verfolgt.
Ein weiteres Mal suchten die Feinde Jesu eine Anschuldigung gegen Ihn, als sie Ihn am Sabbat in der Synagoge belauerten. Jesus Christus, der wirklicher Mensch geworden ist, hat seine Gottheit nie aufgegeben. Das ist das Geheimnis seiner Person: Gott und Mensch in einer Person. Deshalb kannte Er auch die Überlegungen der Schriftgelehrten und Pharisäer.
Er forderte den Mann auf, den die Feinde als Testobjekt betrachteten, in die Mitte zu treten. Dann fragte Er sie, ob es erlaubt sei, am Sabbat Gutes oder Böses zu tun. Keine Antwort, obwohl Er sie alle anschaute! Da heilte Er den Mann mit der verdorrten Hand.
Welche Wirkung hatte diese Heilung auf die Anwesenden? «Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten.» Miteinander gegen Ihn! Und das alles, weil Gott in einer Welt, die durch die Sünde des Menschen und die Listen Satans ruiniert war, Gutes tun wollte!
Berufung der Apostel
Als Mensch stand der Herr hier vor einer grossen Aufgabe: die Berufung seiner zwölf Jünger, die Er auch Apostel nannte. Seine Abhängigkeit von Gott und seine Unterordnung unter dessen Willen kommt hier sehr schön zum Ausdruck: «Er verharrte die Nacht im Gebet.»
Am andern Tag rief Er dann die Zwölf herzu, die seine Apostel werden sollten. Der letzte Name erstaunt uns vielleicht: Judas Iskariot, der auch sein Verräter wurde. Hatte der Herr bei der Berufung von Judas einen Fehler gemacht? Nein, unmöglich! Als Mensch beging Er nach einer Nacht des Gebets keinen Fehler, und als Gott wusste Er, wer Judas war. Doch Er gab ihm eine einmalige Chance. Die ganze Zeit des Dienstes des Heilands durfte dieser Mann in seiner Nähe sein und alles direkt miterleben. Leider verharrte Judas im Unglauben.
Als der Herr vom Berg herunterkam, war Er sogleich wieder der Mittelpunkt des Interesses von vielen. Sogar aus dem Ausland waren die Menschen mit ihren Bedürfnissen nach Körper und Seele zu Ihm gekommen. Keiner wurde enttäuscht. Er heilte alle.
Aber diesen zentralen Platz unter den Menschen gönnten Ihm die Obersten des Volkes nicht. In ihrer Eifersucht versuchten sie Ihn zu beseitigen. Auch heute will man dem Herrn Jesus nicht den Platz geben, der Ihm zusteht. Aber welchen Platz geben wir Ihm in unserem persönlichen Leben? Hat Er da wirklich den ersten und zentralen Platz?
Die Feinde lieben
Die Belehrungen des Herrn Jesus in diesem Abschnitt richten sich ausdrücklich an seine Jünger, nicht nur an die Zwölf, sondern an alle Glaubenden, die Ihm nachfolgen wollen. Vergleicht man diese Verse mit den ähnlich lautenden Aussagen in der Bergpredigt (Matthäus 5 – 7), fällt auf, dass sie hier viel direkter sind. Der Herr spricht im Lukas-Evangelium seine Zuhörer persönlich an. Im Weiteren werden hier nicht Juden, Zöllner und Nationen unterschieden. Es geht einfach um Menschen, um Sünder. Wir dürfen diese Verse direkt auf uns anwenden. Möchten wir sie beherzigen und ausleben!
Als Glaubende, die den Fussstapfen unseres Herrn nachfolgen wollen, sollen wir uns nicht wie die Allgemeinheit verhalten. Sie möchte für ihr Gutestun entschädigt werden. Wir sollen etwas von der empfangenen Gnade ausleben. Alles, was wir von Gott bekommen haben, war unverdient. Und so sollen wir barmherzig sein, «wie auch unser Vater barmherzig ist» und sogar unsere Feinde lieben. Auf diese Weise zeigen wir, zu welcher Familie wir gehören. Unser Verhalten wird uns als Söhne des Höchsten kennzeichnen.
Es wird nicht immer leicht sein, die Gnade in dieser Weise auszuleben, d.h. zu lieben, Gutes zu tun, zu leihen, nicht zu richten, nicht zu verurteilen, loszulassen, zu geben. Doch der Gott aller Gnade will uns dafür reich belohnen, d.h. ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Mass geben. Was wollen wir noch mehr?
Demut und Gehorsam
Die Grundsätze, die der Herr Jesus in diesen Versen vorstellt, gelten auch für die Zeit, in der wir leben, und für uns persönlich. Gibt es in der Christenheit nicht manche Menschen, die anderen auf religiösem oder seelsorgerlichem Gebiet helfen wollen, ohne dass sie eine persönliche Glaubensbeziehung zum Herrn Jesus haben? (Vers 39).
Wir alle neigen dazu, die Fehler beim anderen zu sehen. Bei uns aber übersehen wir sie. Und wenn wir zugeben, dass auch wir Fehler machen, sehen wir sie dann wirklich als Balken gegenüber dem Splitter im Auge des Nächsten? Ohne ernstes Selbstgericht werden wir dem Bruder nicht helfen können.
Die Äusserungen im Leben zeigen, wie es in unserem Inneren aussieht. Aus unseren Taten (Früchte) und Worten können die Menschen auf unseren Herzenszustand schliessen. Der «gute» Mensch ist einer, der an den Herrn Jesus als seinen Heiland glaubt. Erkennen die Menschen, dass wir Dem gehorchen wollen, der für uns gestorben ist und den wir als unseren Erlöser, aber auch als unseren Herrn bekennen?
Das Hören erfolgt meistens ohne grosse Anstrengung; aber das Tun verlangt einiges an Energie. Der Mann, der sein Haus auf die Erde baute, ohne Grundlage, wählte den Weg des geringsten Aufwandes. Sein Haus hielt den Fluten nicht stand. Wie viel geistliche Energie wenden wir auf, um das, was wir aus der Bibel gelernt haben, auch zu tun? Lasst uns unser Lebenshaus auf Felsengrund bauen!
Der Hauptmann und sein Knecht
Der Hauptmann, dessen Sklave so schwer krank war und im Sterben lag, war ein römischer Offizier, also kein Jude von Geburt. Aber er glaubte an den Gott Israels, denn er hatte den Juden eine Synagoge erbaut. Und er setzte sein Vertrauen auf Den, der von Gott gekommen war und als wahrer Mensch hier lebte und die Gnade Gottes offenbarte.
Aber welch eine Demut zeigte er! Er fand sich nicht würdig genug, selbst zum Heiland zu gehen. So sandte er zunächst Älteste der Juden zu Ihm mit der Bitte, seinen Knecht gesund zu machen. Als der Herr unterwegs zu seinem Haus war, sandte er Freunde zu Ihm, um Ihm sagen zu lassen, er sei nicht würdig, dass Er unter sein Dach trete. Er war von der Autorität des Herrn überzeugt. Ein Wort von Ihm würde genügen, um seinen Sklaven zu heilen. Er wusste, wovon er sprach, denn er selbst hatte einen kleinen Autoritätsbereich, in dem sein Wort Macht hatte.
Der Herr Jesus bezeichnet den Glauben dieses Römers als gross, ja, er war grösser als das, was Er in Israel gefunden hatte. Können auch wir einen grossen Glauben haben? Ja, wenn wir den Herrn einfach bei seinem Wort nehmen, ohne Rücksicht auf Urteile, Gefühle oder Erfahrungen.
Wir hören nicht, dass der Herr ein besonderes Wort gesprochen hätte. Doch der grosse Glaube des Hauptmanns wurde beantwortet: Die Abgesandten fanden zu Hause einen gesunden Knecht vor.
Ein Toter wird auferweckt
Die Verse 11-17 zeichnen uns ein anderes Bild der Gnade, die der Herr Jesus offenbart hat. Hier sehen wir keinen tätigen Glauben, sondern göttliches Mitleid und göttliche Vollmacht. Die Gnade zeigt sich auch auf diese Weise. Der Herr Jesus, umringt von einer grossen Volksmenge, nähert sich der Stadt Nain. Aus der Stadt kommt ebenfalls eine zahlreiche Volksmenge. Sie begleitet eine Witwe, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trägt. Die eine Volksmenge hatte das Leben in ihrer Mitte, die andere den Tod.
Ohne Bitte, ohne irgendeine äussere Veranlassung übernimmt der Herr die Initiative. Voll tief empfundenem Mitleid tröstet Er die Witwe mit den Worten: «Weine nicht!» Dann ruft Er mit göttlicher Autorität den jungen Mann ins Leben zurück und gibt ihn der trauernden Mutter. Welch einen gütigen und gnädigen Herrn haben wir doch!
Wir können die Frage des im Gefängnis schmachtenden Johannes verstehen. So viele Wunderwerke geschahen durch die Hand des Herrn Jesus, aber er blieb im Gefängnis. Warum? War der nach ihm Gekommene wirklich der Messias? Er war es. Vor den Augen aller erfüllten sich die Verheissungen des Alten Testaments, die den Messias und sein Tun ankündigten. Aber Er konnte seine öffentliche Herrschaft noch nicht antreten. Das Volk, vor allem die Führer, nahmen Ihn nicht an, sondern lehnten Ihn ab und verwarfen Ihn. Sein Weg führte daher nicht zum Thron, sondern zum Kreuz. Glückselig, wer trotzdem an Ihn glaubte!
Johannes der Täufer und Christus
Nachdem die Boten des Johannes weggegangen waren, sprach der Herr Jesus über seinen Vorläufer. Er war der grösste Prophet des alten Bundes, denn er sah den Messias, den er ankündigte. Dieses Vorrecht hatte keiner der Propheten des Alten Testaments.
Aber dann sprach der Herr von einer neuen Zeitperiode, vom Reich Gottes. Es ist die Zeit, in der wir leben. Wir stehen in einer viel engeren Beziehung zu Gott als die Glaubenden unter dem Gesetz. Wir sind Kinder und Söhne Gottes. Darum sagte der Herr: «Der Kleinste aber im Reich Gottes ist grösser als er» – nicht in moralischer Hinsicht, aber in seiner Stellung vor Gott.
Nachdem der Herr von Johannes dem Täufer gesprochen hatte, redete Er auch von der Reaktion der Menschen auf die Predigt zur Buße. Viele waren sich ihres Zustands vor Gott bewusst, taten Buße und liessen sich taufen. Die selbstgerechten Pharisäer und Gesetzgelehrten verwarfen dieses Zeugnis. Indem sie meinten, nicht Buße tun zu müssen, entzogen sie sich dem, was Gott auch für sie bereitet hatte: das Heil, das der Erlöser brachte. Jene aber, die auf die Predigt von Johannes reagierten, waren auch offen für den Herrn Jesus, der für sie gekommen war (Lukas 5,31.32).
Die Verse 31-35 sind eine gleichnishafte Beschreibung der ungläubigen Menschen damals. Sie beugten sich weder unter den herzerforschenden Dienst von Johannes, noch freuten sie sich über die Gnade in Jesus Christus. – Die wenigen, die beide Zeugnisse annahmen, waren die Kinder der Weisheit.
Die weinende Sünderin
Ein Pharisäer, der eigentlich zu den Gegnern des Herrn Jesus gehörte, lud Ihn zum Essen ein. Obwohl der Herr wusste, dass Er nicht herzlich empfangen würde, nahm Er in seiner Gnade die Einladung an.
Eine Frau, die das Wort eine Sünderin nennt, benutzte die Gelegenheit für eine Begegnung mit dem Heiland. In ihrem Herzen war eine tiefe Reue über ihr sündiges Leben. Das zeigen ihre Tränen. Sie war überzeugt, dass der Herr Jesus ihr helfen könne. Darum war sie gekommen. Ja, sie hatte bereits eine brennende Liebe zu Ihm. Das sehen wir an dem kostbaren Salböl, mit dem sie seine Füsse salbte, und an den vielen Küssen, mit denen sie seine Füsse küsste. Was ihr fehlte, war die Heilsgewissheit.
Der Gastgeber betrachtete die Szene und machte sich seine Gedanken. «Wenn dieser ein Prophet wäre …» Er war mehr: der Erlöser. Gerade für solche wie diese sündige Frau war Er auf die Erde gekommen. Doch Er vergass auch seinen Gastgeber nicht. In Liebe und Gnade versuchte Er das Herz des selbstgerechten Mannes zu erreichen, der seine Gnade ebenso nötig hatte (Lukas 7,41.42). Ob er den Herrn Jesus und sein Angebot angenommen hat, wissen wir nicht.
Aber die Frau durfte vom Heiland die Zusicherung hören: «Deine Sünden sind vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet; geh hin in Frieden.» Nicht der Kummer und die Tränen hatten sie gerettet, sondern ihr Glaube an den Erlöser. Nun hatte sie sein Wort, was ihr absolute Sicherheit des Heils gab. Darauf konnte sie sich stützen und mit innerer Ruhe weitergehen.
Der Sämann sät das Wort
Auf seinem Weg durch Stadt und Dorf begleiteten auch einige Frauen den Herrn Jesus. Sie hatten Ihm so viel zu verdanken, denn Er hatte sie von bösen Geistern und Krankheiten geheilt. Nun stellten sie sich ihrem Retter und Wohltäter zur Verfügung, indem sie Ihm mit ihrer Habe dienten.
Das Gleichnis vom Sämann zeigt, dass das verkündigte Wort bei den Menschen, die es hören, auf sehr unterschiedliche Herzenszustände trifft. Das war damals so, und das ist heute nicht anders.
Da gibt es solche, deren Herz so hart wie ein festgetretener Weg ist. Wenn das Evangelium sie erreicht, ist der Teufel sofort zur Stelle, um das Wort wegzunehmen, damit sie es nicht glauben und errettet werden. – Andere stimmen der göttlichen Botschaft freudig zu. Aber das Wort Gottes kann bei ihnen nicht wirklich in Herz und Gewissen dringen. Oberflächliche Menschen haben keinen Bestand. Wenn es schwierig wird, geben sie alles wieder auf. – Der dritte Herzenszustand zeigt, dass sowohl die Sorgen als auch der Reichtum oder die Vergnügungen des Lebens das Herz derart erfüllen können, dass das gehörte Wort erstickt wird. Man ist so von anderem erfüllt, dass das Wort Gottes richtiggehend verdrängt wird.
Wer aber das gehörte Wort aufrichtig und bereitwillig aufnimmt und bewahrt, bei dem kann der Same aufgehen und Frucht bringen, und dies mit Ausharren. Das bedeutet wohl, dass es im Leben eines Glaubenden Schwierigkeiten und Erprobungen geben kann. Doch das soll kein Hindernis für das Fruchtbringen sein.
Mit dem Herrn im Sturm
Die Verse 16 und 17 schliessen direkt an Vers 15 an. Der Herr Jesus möchte, dass alle, die sein Wort in einem redlichen und guten Herzen aufgenommen haben und bewahren, auch ein Zeugnis gegenüber anderen Menschen sind. Sehen meine Mitmenschen zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, dass ich an den Herrn Jesus glaube?
Wie ernst ist Vers 18! Die Menschen, deren Herz dem felsigen oder dornigen Ackerboden gleicht, meinen etwas zu haben. Doch es fehlt ihnen das wahre Leben. Sie werden schliesslich alles verlieren.
Die Mutter Jesu und seine Brüder sind hier ein Bild des jüdischen Volkes. Der Herr löst sich von denen, die Ihn nicht annehmen wollen und wendet sich denen zu, die das Wort Gottes hören und befolgen. Diese bilden nun seine Familie. Seine Mutter gehörte damals schon dazu, und später glaubten auch seine Brüder an Ihn (1. Korinther 9,5; Galater 1,19).
In der Nachfolge des Herrn Jesus läuft nicht immer alles glatt. Das erfuhren auch die Jünger bei ihrer Überfahrt. Zwar hatten sie ihren Meister mit im Boot. Doch Er schlief, auch als der Sturm aufkam und das Schiff voll Wasser lief. – Wir können die Not der Jünger nachvollziehen. Aber lasst uns bedenken: Der Herr hatte sie aufgefordert, ans jenseitige Ufer zu fahren. Sie waren also auf einem gottgewollten Weg. Zudem war Er mit im Schiff. Sie brauchten wirklich nicht zu verzweifeln. Doch sie hätten vertrauen sollen. Daran fehlt es auch bei uns oft. Trotz des Mangels an Glauben lässt Er uns in seiner Gnade nicht im Stich.
Befreiung aus der Macht Satans
Der Mann, der dem Herrn Jesus entgegenkam, war ein Sklave Satans und der Sünde – das eindrückliche Bild eines nicht erlösten Menschen. Die ungläubigen Menschen meinen zwar, sie seien frei, sie könnten tun und lassen, was sie wollten. Dass dies nicht stimmt, illustriert Vers 29. Wie viele versuchten den Menschen zu kultivieren und zu verbessern. Alle Bemühungen sind zum Scheitern verurteilt. Es gibt für uns Menschen nur ein Heilmittel, um aus der Macht Satans, die durch die gefallene Natur des Menschen wirkt, befreit zu werden: den Herrn Jesus im Glauben als Heiland annehmen.
Die Veränderung, die mit einem Menschen geschieht, der an den Herrn Jesus glaubt, illustriert Vers 35. Der Mann, der nackt in den Grabstätten lebte, sitzt bekleidet und vernünftig zu den Füssen Jesu. Auf die Bekehrung übertragen können wir sagen: Befreit von der Knechtschaft der Sünde, mit Kleidern des Heils und dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet (Jesaja 61,10; Lukas 15,22), vernünftig, d.h. fähig zu denken, wie Gott denkt, und beim Heiland zur Ruhe gekommen (sitzend).
Dass der Geheilte wünschte, bei seinem Retter zu bleiben, verstehen wir gut. Doch der Herr hatte eine Aufgabe für ihn. Da die Bewohner jener Gegend Jesus wegwiesen, sollte er als sein Zeuge dort bleiben. Was er zu tun hatte, war einfach: «Erzähle, wie viel Gott an dir getan hat.» Heute sind wir Glaubende in einer Welt zurückgelassen, die den Herrn Jesus hinausgeworfen und gekreuzigt hat. Wir dürfen den Menschen ebenfalls weitersagen, was wir in Ihm gefunden haben.
Heilung vom Blutfluss
Von Jairus, dem Synagogenvorsteher, lernen wir, dass wir mit jeder Not zum Herrn Jesus kommen dürfen. Es gibt nichts, was wir Ihm im Gebet nicht sagen könnten. Aber manchmal kommt die Hilfe, die wir so dringend nötig haben, nicht so schnell. Dann wird unser Glaube und unser Vertrauen zum Herrn auf eine harte Probe gestellt, wie dies bei Jairus der Fall war.
In dieser Volksmenge, die den Herrn auf dem Weg zum Haus von Jairus umdrängte, gab es noch jemand anders, der eine grosse Not hatte. Zwölf Jahre litt diese Frau an ihrer Krankheit, und kein Arzt konnte ihr helfen. Aber wie es in einem Lied heisst: «Wo der Menschen Hilf zu Ende, bleiben mächtig seine Hände», so war es auch hier. Im festen Glauben, dass der Heiland ihr helfen könne, und mit dem Gedanken, dass es genüge, die Quaste seines Gewands anzurühren, kam sie von hinten zu Jesus. Ihr Glaube wurde herrlich belohnt.
Doch warum wollte der Herr wissen, wer Ihn angerührt hatte? Als der Allwissende wusste Er es doch! Es ging Ihm um diese Frau. Sie sollte zu wirklicher Heilsgewissheit kommen. In Römer 10,9 werden der Glaube des Herzens und das Bekenntnis mit dem Mund als Voraussetzungen genannt, um errettet zu werden. So war es hier. Nachdem die Frau alles bekannt hatte, durfte sie mit der Zusicherung des Herrn: «Dein Glaube hat dich geheilt; geh hin in Frieden», nach Hause gehen. Nun konnte sie sich auf sein Wort stützen und musste sich nicht auf ihre gemachte Erfahrung verlassen.
Auferweckung aus dem Tod
Über die Nöte und Ängste im Herzen von Jairus als der Gang des Herrn Jesus zu seinem Haus verzögert wurde, wird uns nichts gesagt. Doch nun kam das Schwerste. Einer brachte ihm die niederschmetternde Nachricht vom eingetretenen Tod seiner Tochter. Für die Menschen war jetzt jede Hoffnung dahin. Nicht aber für den Herrn Jesus, der das Leben ist. Als Erstes tröstet und beruhigt Er das Herz des schwergeprüften Vaters. So handelt Er auch uns gegenüber. Wenn wir Ihm unsere Nöte und Probleme vorbringen, will Er zuerst unsere Herzen mit dem Frieden Gottes erfüllen und uns ruhig machen (Philipper 4,6.7). Welch eine Gnade!
Unabhängig davon, wie die Menschen die Lage beurteilten, ging der Herr den Weg weiter bis zum Haus von Jairus. Dort erlaubte Er nur drei seiner Jünger, dem Vater und der Mutter des Mädchens ins Haus einzutreten, wo die verstorbene Tochter lag. Zu den Klagenden und Weinenden, die nicht dabei sein durften, sagte Er: «Weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft.» Als Herr über Leben und Tod wusste Er, was Er tun wollte. Für Ihn schlief sie. Doch Er wurde von denen verlacht, die Ihn nicht als den Sohn Gottes anerkannten.
Dann rief Er das Mädchen ins Leben zurück und wies die Eltern an, ihr zu essen zu geben. Wie wichtig ist diese Aufforderung für alle, die mit Neubekehrten zu tun haben! Diese brauchen dringend die nötige, ihrem geistlichen Zustand angepasste, geistliche Nahrung, damit ihr neues Leben gedeihen kann.
Der Herr senden zwölf Jünger aus
In Lukas 6, wo der Herr die Zwölf erwählt, werden sie Apostel genannt, was «Gesandte» bedeutet. Jetzt war der Augenblick gekommen, da Er sie als seine Gesandten ausschickte, um das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen. Zu diesem Dienst, der seinem eigenen glich (Lukas 9,11; 8,1.2), rüstete Er sie mit der nötigen Vollmacht aus. Auch heute beruft der Herr Jesus keinen der Seinen in einen Dienst, ohne ihn nicht mit allem dazu Nötigen auszurüsten. Wir haben wirklich den besten Herrn und Meister, dem wir dienen dürfen!
Als Gesandte des Messias, der bei ihnen auf der Erde lebte, brauchten sie sich nicht um die äusseren Belange zu kümmern. Er versorgte sie mit allem. Es fehlte ihnen nichts (Lukas 22,35).
Die Nachricht über das, was durch die Apostel geschah, kam bis an den Hof von König Herodes. Das weckte sein Gewissen auf, weil er Johannes den Täufer enthauptet hatte. War dieser vielleicht auferstanden und drohte ihm nun die Strafe für den begangenen Mord?
Um Klarheit zu bekommen, hätte er gern Näheres über Jesus Christus gewusst. «Er suchte ihn zu sehen.» Er bekam Ihn tatsächlich zu sehen, und zwar als Gefangener der Juden und der Römer (Lukas 23,6-12). Seine Neugier wurde aber nicht gestillt. Weder wirkte der Herr ein Zeichen vor ihm, noch gab Er ihm eine Antwort auf seine vielen Fragen. An jenem Tag regte sich das Gewissen von Herodes nicht mehr. Nun hatte er nur noch Hohn und Spott für Jesus übrig.
Die Speisung der Volksmenge
Jeder Diener des Herrn darf seine im Dienst gemachten Erfahrungen mit seinem Meister besprechen. Wie wichtig und nötig ist dies für jeden von uns! So kamen auch die Apostel zurück und erzählten Ihm alles, was sie getan hatten. Vermutlich waren sie ganz erfüllt von allem, was sie erlebt hatten. Nun nahm der Herr sie mit und zog sich mit ihnen in die Stille zurück.
Dieses Sich-Zurückziehen dauerte nicht lange. Bald war Er wieder von Volksmengen umgeben, die Ihm nachgelaufen waren. In seiner Gnade war der Herr sofort wieder bereit, sie aufzunehmen und ihren geistlichen und körperlichen Bedürfnissen zu entsprechen. Nie dachte Er an sich, immer nur an die anderen!
Gegen Abend sorgten sich die Jünger um das leibliche Wohl der vielen Zuhörer, denn diese waren ihnen an einen öden Ort nachgefolgt. Wie gut, dass sie ihre Sorge ihrem Herrn vorlegen konnten! Doch nun prüfte Er sie. «Gebt ihr – die kurz vorher mit Vollmachten von Ihm ausgestattet worden waren – ihnen zu essen.» Sie bestanden den Test nicht. Anstatt sich auf Ihn, die Quelle aller Kraft, zu stützen, schauten sie auf das Sichtbare; und dieses war völlig unzureichend für den Hunger der grossen Menge. Wie oft machen auch wir diese Erfahrung!
Die Gnade des Herrn aber nahm das vorhandene Wenige und segnete es so, dass alle mehr als genug zu essen bekamen. Und die Jünger, die soeben versagt hatten, durften die Kanäle des Segens werden, der vom Herrn zu allen ausging! Wie gross ist seine Barmherzigkeit!
Dem abgelehnten Herrn nachfolgen
Im Lukas-Evangelium stossen wir immer wieder auf Bibelstellen, die ausdrücklich sagen, dass der Herr betete. Er war wirklicher Mensch, der sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst war und Tag für Tag darin lebte. Welch ein Vorbild für uns alle!
Die Meinungen über seine Person gingen schon damals auseinander. Auch heute kursieren die verschiedensten Ansichten über Jesus Christus. Nur der Glaube erkennt, wer Er wirklich ist. Dieser demütige Mensch, der damals lebte und auf dem Weg zum Kreuz war, wo Er zur Erlösung sündiger Menschen sterben wollte, war und ist der Christus Gottes, d.h. der Messias und der Sohn Gottes (Lukas 1,32.35). Da im Lukas-Evangelium die Betonung auf seiner Menschheit liegt, fährt der Herr fort, von sich als dem Sohn des Menschen zu reden. Gleichzeitig zeigt Er den Jüngern, wohin sein Weg der Leiden und der Verwerfung führen würde: zum Tod am Kreuz von Golgatha. Doch am dritten Tag würde Er auferstehen.
Die Jünger mussten lernen, ihre Hoffnungen nicht länger auf den Messias zu setzen, sondern bereit zu sein, einem von der Welt verworfenen Herrn nachzufolgen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch eine solche Nachfolge verlangt Selbstverleugnung. Aber sie lohnt sich! Denn wer Ihm heute in Treue und Selbstverleugnung nachfolgt, wird dereinst seine Herrlichkeit als Sohn des Menschen mit Ihm teilen. Einige der anwesenden Jünger durften noch vor ihrem Tod einen Blick auf jene Herrlichkeit werfen (Lukas 9,28-36).
Ein Blick in die herrliche Zukunft
Aufs Neue heisst es vom Herrn Jesus, wie Er betete – dort auf dem Berg der Verklärung. Nun sahen die drei Jünger, die Er mitgenommen hatte, wie sich sein Aussehen veränderte. Das war nicht mehr der demütige Sohn des Menschen, den sie bis dahin kennengelernt hatten, sondern eine strahlend herrliche Person.
Die ganze Szene, die sich dort auf dem Berg abspielte, zeigt ein eindrückliches Bild der zukünftigen Herrlichkeit des Reiches Gottes. Mose und Elia, die mit dem Herrn in Herrlichkeit erscheinen, stellen Gläubige dar: Mose die gestorbenen und auferweckten, Elia die entrückten himmlischen. Das Gesprächsthema dieser drei Personen ist der Tod des Herrn in Jerusalem, eine Sache, die die Gedanken von Himmel und Erde beschäftigen. Die drei Jünger stellen den gläubigen Überrest des Volkes Israel in der Zukunft dar. Dieser wird dann unter der Herrschaft des Herrn Jesus auf der Erde leben.
Die zentrale Stellung gehört allein dem Herrn Jesus. Als Petrus einen Vorschlag machte und damit seinen Meister mit Mose und Elia auf die gleiche Stufe stellen wollte, kam die Wolke der Gegenwart Gottes über sie und eine Stimme – es war die Stimme Gottes, des Vaters – bezeugte die Einzigartigkeit seines geliebten Sohnes. Auf diesen Sohn sollten sie und sollen wir hören. Dann verschwanden Mose und Elia. «Jesus wurde allein gefunden.» Vor dieser einmaligen herrlichen Person müssen das Gesetz (Mose) und die Propheten (Elia) zurücktreten.
Hilf meinem Sohn!
Welch ein Gegensatz zur Szene auf dem Berg! Nun befinden wir uns wieder mitten in der Welt, die noch nicht unter der Herrschaft des Herrn Jesus, sondern unter der Macht Satans steht. Aber hatte der Herr seine Apostel nicht mit Vollmacht und Kraft ausgesandt? (Lukas 9,1.2). Wo blieb die «Kraft und Gewalt über alle Dämonen»? Überstieg der Zustand dieses armen Jungen ihre Möglichkeiten? Nein, aber es fehlte ihnen der feste Glaube an die Kraft Gottes, und das betrübte den Herrn sehr. Er stand im Begriff, am Kreuz zu sterben und dann die Jünger zu verlassen, aber es gab noch so viel Unglauben bei ihnen.
Es genügt nicht, mit Jesus zu sein und seine Gaben zu besitzen. Glauben ist nötig, um sie anzuwenden. Der Knabe ist ein Bild der Macht Satans über den Menschen. Nur Gott kann sein Geschöpf davon befreien. Aber die Macht Gottes fand sich im Herrn Jesus und stand dem Glauben derer zur Verfügung, die Er zum Austreiben von Dämonen befähigt hatte.
Und was können wir von diesem Vater lernen? Wir dürfen all unsere Schwierigkeiten und Nöte – ob sie uns persönlich, unsere Familie oder unsere Mitglaubenden betreffen – zum Herrn Jesus bringen und sie Ihm im Gebet sagen. Wenn wir dies im Vertrauen tun, werden wir die Antwort bekommen, die seine Liebe uns zugedacht hat. Lasst uns beim glaubensvollen Gebet nie vergessen: Unsere Schwierigkeiten sind für Gott absolut kein Problem!
Unverständnis und Hochmut
Wenn wir gestern Mangel an Glauben bei den Jüngern gesehen haben, so kommt jetzt noch ein Mangel an Verständnis dazu. Als der Herr Jesus zum zweiten Mal von seinem Tod sprach (vergleiche Lukas 9,22), sagt der inspirierte Text: «Sie aber verstanden dieses Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, damit sie es nicht begriffen.» Warum fanden die einfachen Worte ihres Meisters über das, was Ihn erwartete, keinen Eingang in ihre Herzen? Weil sie von den Vorstellungen über die Herrlichkeit des kommenden Reiches derart erfüllt waren, dass sie keinen anderen Gedanken zulassen wollten. Sie waren nicht bereit, sich mit dem Gedanken seiner Verwerfung zu beschäftigen, denn dann hätten sie ihre eigenen hochtrabenden Vorstellungen begraben müssen.
Die Apostel dachten wohl alle, dass sie im Reich des Messias eine wichtige Position einnehmen würden. Aber wer von ihnen würde der Grösste sein? – Der Herr, der ihre Überlegung sah, belehrte sie anhand eines Kindes, das keine Ansprüche in dieser Welt hat und in der Bewertung der Menschen keinen besonderen Platz einnimmt. Das war eigentlich seine Lage, als sein Volk Ihn verwarf. Nun ging es darum, dass die Jünger Ihn als den Verworfenen aufnahmen. Dann würden sie auch klein in den Augen der Welt, aber gross vor Gott sein.
Die Antwort des Herrn auf den Einwand von Johannes ist bedeutsam. Es zeigte sich damals schon, dass eigentlich die ganze Welt gegen Christus war (sie ist es heute noch). Wer daher etwas im Namen Jesu tat, stellte sich unweigerlich auf seine Seite.
Unterweisungen für Jünger
Ab Vers 51 beginnt in diesem Evangelium der letzte Weg des Herrn Jesus nach Jerusalem, wo Er am Kreuz sterben sollte. Als Er mit Entschiedenheit und ohne sich durch irgendetwas hindern zu lassen, diesen schweren Weg des Willens Gottes ging, musste Er auch die Ablehnung der Samariter erfahren. Jakobus und Johannes, die noch kaum etwas von der Sanftmut und Gnade ihres Meisters gelernt hatten, wollten diese mit Gericht bestrafen.
In den Versen 57-62 wird das Thema der Nachfolge des Herrn Jesus behandelt. Da dieser Abschnitt nach Vers 51 steht, geht es um die Nachfolge eines von den Menschen verworfenen und gekreuzigten Herrn und Meisters. Der Erste, der Ihm nachfolgen wollte, scheint die Kosten der Nachfolge nicht überschlagen zu haben. Wenn er für diese Erde einen Vorteil erwartete, musste der Herr ihm klarmachen: Du folgst einem Meister, der hier kein Zuhause, nicht einmal einen Ort hat, wo Er sein Haupt in Ruhe hinlegen kann. Der Zweite, den der Herr in seine Nachfolge rief, wollte zuerst seinen Verpflichtungen in den natürlichen Beziehungen nachkommen. Der Dritte wollte zuvor in angemessener Weise von seinen Angehörigen Abschied nehmen. Echte Jüngerschaft ist aber nur möglich, wenn der Herr in jeder Hinsicht zuerst kommt, wenn seine Rechte über alles andere gestellt werden. Wer nur mit halbem Herzen nachfolgt, gleicht dem Pflüger, der ständig zurückblickt. Er wird keine gerade Furche ziehen können. Halbherzige sind für das Reich Gottes untauglich. Haben wir das auch schon bedacht?
Buchtipp: Bibel-Auslegung zum Lukas-Evangelium
Einleitung
In den Psalmen 42 – 72 lesen wir von Erfahrungen, die einzelne Gläubige in notvollen Zeiten mit dem Herrn gemacht haben. Ihr Beispiel ermutigt uns, in Schwierigkeiten auf Gott zu vertrauen. Zugleich reden diese Psalmen prophetisch von den Gläubigen aus dem Volk Israel in der Zukunft. Sie werden in grosser Bedrängnis zu Gott rufen und seine Rettung erfahren. Christus wird sie in das Friedensreich einführen.
Der Gläubige sehnt sich nach Gott
Obwohl die Psalmen vorwiegend prophetisch sind, enthalten sie auch für uns Christen praktische Unterweisungen, denn wie jene Gläubigen des Alten Testaments stehen auch wir unter der Regierung Gottes. Zudem ist ihr Gott auch unser Gott, den wir durch den Glauben an Jesus Christus jetzt als unseren Vater kennen dürfen.
Die Psalmen 42 und 43 gehören zusammen und bilden die Einleitung oder das Vorwort zum zweiten Psalmbuch (Psalmen 42 – 72). Der Psalmdichter ist sehr niedergeschlagen und sehnt sich nach Gott, nach Gemeinschaft mit Ihm im Haus des Herrn. Wenn er an früher Erlebtes denkt, als er mit vielen zusammen voll Jubel und Lob zum Tempel zog, dann wird er erst recht niedergeschlagen.
Wir wollen aber vom Gläubigen, der hier spricht, lernen, auch in schweren Zeiten nicht zu verzweifeln. Der Mann nahm seine Zuflucht zu Gott im Gebet und sagte Ihm alle Not, die ihn niederbeugte. Auch den Spott derer, die ihn höhnend fragten: «Wo ist dein Gott?», brachte er im Gebet vor den Herrn.
Dann ermutigte er seine niedergebeugte Seele mit den Worten: «Harre auf Gott!» Weiter blickte er hoffnungsvoll vorwärts und wusste: «Ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist.» Jemand hat gesagt: «Die dunkelste Nacht hat ihren Stern und die längste Nacht ihren Morgen.» Das gilt auch für dich und für mich.
Der Gläubige wird getröstet
Nehmen wir die beiden Psalmen 42 und 43 zusammen, dann finden wir trotz der spottenden Frage der Feinde: «Wo ist dein Gott?», viele bemerkenswerte Bezeichnungen unseres Gottes. Er ist der lebendige Gott, nach dem sich der Dichter sehnt. Der Mann hat aber auch eine persönliche Beziehung zu Ihm und nennt Ihn den Gott meines Lebens.
Auch wenn er den Eindruck hat, Gott habe ihn vergessen, hält er an Ihm fest und nennt Ihn: Gott, mein Fels (Psalm 42,10); Gott meiner Stärke (Psalm 43,2). Er denkt an zukünftige Tage, wo er erneut zum Altar Gottes kommen wird. In der Vorfreude auf jenen Moment spricht er vom Gott, der meine Jubelfreude ist und nennt Ihn: Gott, mein Gott.
Warum-Fragen (Psalm 42,10; 43,2) tauchen manchmal auch in unserem Leben auf. Hoch und tief gehende Empfindungen, wie wir sie in diesen zwei Psalmen ausgedrückt finden, kennen auch wir: Ängstliche Furcht und Vertrauen, Zweifel und Hingabe, Bedrückung und freudiger Jubel.
Alles dürfen wir im Gebet vor den Herrn bringen. Aber lasst uns nicht bei den Fragen, den Zweifeln und den Schwierigkeiten stehen bleiben. Sie könnten uns auf einmal überwältigen. Nein, wir wollen vom Psalmisten lernen, vertrauensvoll auf Gott zu warten, und dabei von uns und unseren Umständen wegschauen und auf den Herrn blicken. Er wird uns nicht im Stich lassen.
Der Gläubige erinnert sich an Gott
Die Sprache dieses Psalms ist die Sprache des treuen Überrests der Juden in der Endzeit. Sie erinnern sich an die Grosstaten Gottes gegenüber ihren Vorvätern. Doch ihre eigenen Erfahrungen sind ganz anderer Art. Ihre Feinde bedrücken und verhöhnen sie. Sie sind unter den Völkern zum Sprichwort geworden.
Trotz allem halten sie im Glauben an Gott fest und anerkennen seine Autorität als König. Sie bezeugen, dass seine Hand hinter allem steht, was sie erfahren, und sie beugen sich unter Gottes Züchtigung. Doch es ist nicht einfach, in der Züchtigung auf Gott zu vertrauen, besonders dann nicht, wenn man Gottes Wege nicht versteht (Psalm 44,18-20).
Aus Hebräer 12 wissen wir, dass Gott all die Seinen auf die eine oder andere Weise erzieht. Dabei ist seine Züchtigung nie angenehm und bereitet keine Freude, wenn man mitten drin steckt. Doch die Liebe des Vaters verfolgt mit der Erziehung seiner Kinder ein wichtiges Ziel: Wir sollen Ihm ähnlicher werden.
Und wie sollen wir uns verhalten, wenn seine Erziehungswege mit uns unverständlich sind? Dann lasst uns sowohl seine Souveränität anerkennen als auch die Tatsache, dass Er uns nicht alles erklären kann. Dabei wollen wir aber nicht vergessen, dass Er es gut mit uns meint. Seine Wege werden schliesslich zu seiner Ehre und zu unserem Segen ausschlagen.
Der Gläubige ruft zu Gott
Die bedrängten Gläubigen fragen sich, warum dies alles über sie gekommen ist, da sie doch Gott nicht vergessen haben. Sie sind auch nicht von Ihm abgewichen und haben sich nicht zu einem fremden Gott gewandt. Diese Fragen und Argumentationen berühren einen wichtigen Punkt in den Erziehungswegen Gottes mit den Seinen. Die Wege Gottes, die Er uns führt, sollten wir niemals als Strafe oder Vergeltung auffassen. Wir lernen dies aus dem Buch Hiob. Die Strafe für unsere Sünden trug der Heiland am Kreuz. Und Gott straft nicht zweimal. Aber Er erzieht uns. Manchmal legt Er uns etwas Schweres auf, um uns vor Überheblichkeit, vor Hochmut und Eigendünkel zu bewahren. Immer entspringen seine Wege der Erziehung oder Züchtigung seinem liebenden Herzen, das nur das Beste für uns im Sinn hat.
Vers 23 zeigt, dass die Leiden jener Juden mit denen eines Märtyrers vergleichbar sind, die für den Namen des Herrn Jesus Christus verfolgt werden (vergleiche das Zitat aus Römer 8,36).
Die Fragen in den Versen 24 und 25 verstehen wir alle sehr gut. Auch unser Leben verläuft nicht immer im Stillsein und im Vertrauen auf den Herrn. Sobald wir auf die Umstände statt auf den Herrn blicken, besteht die Gefahr, dass die herrschende Situation uns niederdrückt. Verzweifelt fragen wir dann: «Warum schläfst du, Herr?» Aber Er schläft nicht und vergisst uns nicht (Psalm 121,4).
Christus regiert als König
Sozusagen als Antwort auf das Rufen des bedrängten gläubigen Überrests der Juden in den vorherigen Psalmen, wird jetzt der Messias (Christus) vorgestellt. Es geht um sein Kommen in Herrlichkeit und wie Er sich mit dem treuen Überrest verbindet, was durch die Vermählung mit der Königin vorgestellt wird.
Der inspirierte Psalmdichter freut sich, die Herrlichkeit des kommenden Königs zu beschreiben (Vers 2). Es ist die gleiche Person, die einst als abhängiger Sohn des Menschen in Demut einen Dienst der Gnade ausgeübt hat. Die Holdseligkeit seiner Lippen erinnert an seine Worte der Gnade, über die sich seine Landsleute einst verwunderten (Lukas 4,22).
In diesem Psalm wird Er aber als einer beschrieben, der «Krieg führt in Gerechtigkeit». Nach der Unterwerfung seiner Feinde richtet Er ein Reich auf, das durch nichts erschüttert werden kann und in dem Gerechtigkeit herrscht.
Vers 7 wird in Hebräer 1 zitiert und macht deutlich, dass der König, der einmal über Israel und alle Nationen regieren wird, niemand anders als der ewige Sohn Gottes ist. Darum ist sein Thron ein ewig bleibender.
Die Königin, die zur Rechten des Messias-Königs steht, ist die irdische Braut des Herrn Jesus. Wir denken an das irdische Jerusalem im Gegensatz zum himmlischen, das von der Versammlung Gottes spricht (Offenbarung 21,9-11). Wenn Christus in Herrlichkeit erscheinen wird, wird Er sich mit dem gottesfürchtigen Überrest der Juden verbinden und diese Treuen als sein Volk anerkennen.
Die Königin zur Rechten des Königs
In den Versen 11 und 12 wird die Königin angesprochen. Warum soll sie ihr Volk und das Haus ihres Vaters vergessen? In der Zukunft wird die Beziehung zwischen Christus und seinem Volk eine ganz andere sein als die Beziehung, die zwischen Gott und seinem Volk auf der Grundlage des Gesetzes bestand. Im neuen Bund wird Gott alle Verpflichtungen übernehmen und nichts mehr vom Menschen verlangen. Alles Versagen des Menschen unter Verantwortung wird dann vorüber sein. Christus wird in seiner irdischen Braut die Schönheit sehen, die seine Gnade ihr verleiht. Sie wird aufgefordert, Ihm, der auch ihr Herr ist, zu huldigen oder Ihn anzubeten.
Vers 13 deutet an, dass auch die Nationen ihren Platz im Friedensreich des Herrn Jesus haben werden. Alle werden Christus als König der Könige und Israel als sein Volk anerkennen und mit Geschenken ihre Gunst suchen.
Welch eine Freude für den Herrn Jesus, wenn Israel, seine irdische Braut, als herrliche Königin vor Ihm stehen wird! Auch diese wunderbare Szene (Psalm 45,14-16) gehört zur Frucht der Mühsal seiner Seele, an der Er sich sättigen wird. Denn die Wiederherstellung seines irdischen Volkes und seine Einführung in den Segen des Tausendjährigen Reiches gründen sich auf das Werk, das Christus am Kreuz vollbracht hat. Ohne das Kreuz könnte Psalm 45 nicht in Erfüllung gehen. Darum wird Er, der einst das Lamm Gottes in Niedrigkeit war und dann der König in Herrlichkeit sein wird, immer und ewig gepriesen werden.
Gott ist Zuflucht und Stärke
Dieser Psalm spricht vom Vertrauen des gläubigen Überrests aus Israel und von der Befreiung Jerusalems beim Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Wenn Gott durch Christus zugunsten seines Volkes und der Stadt Jerusalem eingreifen wird, dann werden alle Feinde besiegt werden. Die gottesfürchtigen Juden werden die Hilfe und den Beistand ihres Gottes auf wunderbare Weise erfahren.
Doch die Worte dieses Psalms ermuntern auch jeden gläubigen Christen. In einer Gott feindlichen Welt bleibt Er unsere Zuflucht und Stärke. Bei Ihm finden wir jede nötige Hilfe. Wir brauchen uns wirklich nicht zu fürchten. Die Frage ist nur: Vertrauen wir Ihm auch von ganzem Herzen?
Ströme und Bäche reden in der Bibel oft von Segen (Psalm 36,9; Offenbarung 22,1). Wo entspringen diese Wasser, die die Stadt und das Heiligtum Gottes erfreuen? In Offenbarung 22,1 fliesst der Strom von Wasser des Lebens aus dem Thron Gottes und des Lammes hervor. Der Fluss, den Hesekiel sieht, entspringt im Tempel Gottes (Hesekiel 47). Wahrer Segen hat seine Quelle in der Gegenwart Gottes. Haben wir das nicht schon erfahren, wenn wir als Glaubende im Namen des Herrn versammelt waren und Er mit seinem Segen in unserer Mitte war? (Matthäus 18,20).
Vers 10 deutet an, dass einmal alle Kriege zu Ende sein werden. Wenn Christus in Gerechtigkeit und Frieden 1000 Jahren regieren wird, wird man den Krieg nicht mehr lernen. Die vorhandenen Waffen werden zerstört oder umfunktioniert werden (Jesaja 2,4).
Gott herrscht als König
Dieser Psalm ist gewissermassen die Fortsetzung von Psalm 46. Christus wird in Macht und Herrlichkeit erscheinen und dem treuen Überrest seines Volkes zu Hilfe kommen. Er wird Jerusalem, die Stadt Gottes, befreien und dann seine Herrschaft antreten. Das wird einen weltweiten Jubel auslösen. Nicht nur das irdische Volk Gottes wird zum Lob aufgerufen. Auch die übrigen Völker der Erde, die ebenfalls in den Genuss der segensreichen Regierung des Herrn Jesus Christus kommen, sollen dem König der ganzen Erde Psalmen singen. Es wird eine unvorstellbar herrliche Zeit für die Erde sein.
Der fünfte Vers erinnert an die Auserwählung Israels auf Grund der Liebe und Gnade Gottes. «Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt; denn ihr seid das geringste unter allen Völkern; sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch» (5. Mose 7,7.8).
Wenn schon das Volk Israel und mit ihm die Nationen zu Beginn des Tausendjährigen Reiches so viel Grund zum Jubeln und zum Lobpreis Gottes haben, wie viel mehr wir Christen! Sind wir nicht auserwählt vor Grundlegung der Welt, um Kinder und Söhne Gottes zu sein? Ist der allmächtige, grosse Gott nicht unser Vater geworden, der uns als seine Kinder liebt und in dessen ewigem Haus wir einmal für immer zu Hause sein werden? Ja, gepriesen und angebetet sei Er, der uns so sehr geliebt hat, dass Er seinen eingeborenen Sohn auf die Erde und in den Tod gab, damit jeder Glaubende ewiges Leben habe und sein Kind werde.
Die Stadt des grossen Königs
Thematisch gehört dieser Psalm zu den zwei vorangegangenen. Er handelt ebenfalls vom Lob Gottes zu Beginn des Tausendjährigen Reiches. Jerusalem wird das Zentrum der Regierung des Herrn Jesus sein. Sie wird genannt: Stadt des grossen Königs, Stadt des Herrn und Stadt unseres Gottes. Eng verbunden mit der Stadt Jerusalem ist der Berg Zion. Zion spricht von Gnade. Grundlage des zukünftigen Segens für Israel und die Welt ist nicht das Verdienst der Menschen, sondern die unumschränkte Gnade Gottes. Und so ist der Berg Zion der Sitz der königlichen Macht in Gnade (Hebräer 12,22).
«Wie wir gehört hatten, so haben wir es gesehen.» So reden die gläubigen Juden, die in das Reich eingegangen sind. Mit Bewunderung werden sie bekennen, dass alle Verheissungen Gottes sich erfüllt haben. Im Innern des Tempels, in der Gegenwart Gottes, denken sie über all seine Güte nach. Die Folge wird Lob und Freude sein.
Der letzte Vers ist von allgemeiner Bedeutung und trifft auch auf uns zu. Was Gott für das Volk zu Beginn des Reiches war, das wird Er auch während 1000 Jahren sein. «Dieser Gott ist unser Gott.» Die Beziehung, in die wir bei unserer Bekehrung zu Ihm kamen, bleibt für ewig. Wir sind und bleiben seine geliebten Kinder. Er ist und bleibt unser Gott und Vater. Gestützt auf diese Tatsache können wir mit vollem Vertrauen sagen: Er wird uns leiten bis ans Ziel. Kein Gläubiger braucht sich zu fürchten. Der Herr selbst ist die Garantie dafür, dass all die Seinen das Ziel erreichen werden.
Reichtum kann nicht erretten
Die Aussagen, die wir in diesem Psalm finden, gelten für alle Zeitalter. Und weil diese Worte für uns Menschen so bedeutungsvoll sind, hat dieser Psalm eine besonders lange Einleitung (Psalm 49,2-5). Jeder ist angesprochen, jeder soll hinhören, wenn der von Gott inspirierte Psalmdichter spricht.
Es geht um Menschen, die auf ihr Vermögen vertrauen, die sich ihres materiellen Reichtums rühmen. Der Glaubende braucht sich vor ihrem Einfluss nicht zu fürchten, denn er weiss, dass sie mit all ihrem Reichtum ihre Seele nicht erlösen können. Kein Mensch kann sich einen Platz im Himmel erkaufen. Die Erlösung sündiger Menschen hat viel mehr gekostet als aller Reichtum dieser Welt. Der Apostel Petrus schreibt, dass die Glaubenden nicht mit Silber oder Gold erlöst worden sind, sondern mit dem kostbaren Blut des Lammes Gottes (1. Petrus 1,18-21). Gott hat seinen eigenen Sohn als Mensch auf diese Erde und in den Tod gegeben. Am Kreuz ist Jesus Christus für alle die gestorben, die je an Ihn glauben. Nur aufgrund dieses Sühnungstodes kann Gott Glaubende begnadigen und erlösen. Einen anderen Weg gibt es nicht.
Eine weitere wichtige Wahrheit finden wir in Vers 11. Der Psalmist erkannte, dass alle Menschen sterben müssen, ob sie nun weise oder unvernünftig gelebt haben. Und von ihrem materiellen Besitz kann keiner etwas mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und doch nehmen die Menschen etwas in die Ewigkeit mit: alle ihre unvergebenen Sünden.
Reichtum besteht nicht ewig
Ab Vers 12 kommt der Psalmist wieder auf die Reichen dieser Welt zu sprechen. Vielleicht weil sie merken, dass der Tod auch für sie eine Realität ist, versuchen sie, ihren Namen und ihre Häuser auf dieser Erde möglichst zu verewigen. Aber was nützt dies, wenn der Mensch selbst nicht bleibt? «Wenn er stirbt, nimmt er das alles nicht mit; nicht folgt ihm hinab seine Herrlichkeit.» Aber etwas anderes folgt dem, der nur für das Diesseits gelebt und sich nicht um die Rettung seiner Seele gekümmert hat. Wir haben bereits gestern daran gedacht: seine vielen Sünden. Wenn er einmal zum Gericht auferstehen wird, werden all die ungesühnten Sünden auch noch da sein.
Der Psalmdichter aber kennt Gott als seinen Erlöser. Deshalb kann er zuversichtlich sagen: «Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols; denn er wird mich aufnehmen.» Obwohl er die Belehrung des Neuen Testaments über die Auferstehung zum Leben und die Entrückung nicht kannte, wusste er, dass Gott ihn aufnehmen würde.
Aus den Versen 15 und 21 haben gewisse Menschen den falschen Schluss gezogen, der Ungläubige würde nach dem Tod vernichtet, d.h. er höre auf zu existieren. Aber das ist eine Lüge des Teufels, mit der er die ungläubigen Menschen zu beruhigen sucht. Tatsache ist, dass der Herr Jesus selbst von einer Auferstehung zum Gericht spricht und in der Offenbarung das Gericht aller Ungläubigen klar beschrieben wird (Johannes 5,28.29; Offenbarung 20,11-15).
Gott richtet sein Volk (1)
In diesem Psalm tritt Gott als Richter gegen sein eigenes Volk auf. Worin machte es sich schuldig? Die Menschen aus Israel hatten Gott viele Opfer gebracht.
Aber wie sah es in ihrem Herzen aus? Sie meinten, mit den Tieropfern Gott zufrieden zu stellen. Er aber schaute aufs Herz, und darin fand Er weder wahres Lob noch ein ernsthaftes Beten zu Ihm. Er, dem ohnehin alle Tiere, ja, überhaupt alles gehört, brauchte die Opfertiere der Israeliten nicht. Vielmehr wartete Er auf Opfer des Lobes und Dankes von ihnen.
Gott sieht in seinem Volk, dem Er als Richter gegenübertreten muss, auch einen gläubigen Überrest, «die Frommen». Wodurch zeichnen sie sich aus? «Sie haben meinen Bund beim Opfer geschlossen», sagt Er von ihnen. Ist das nicht eine schöne Bezeichnung für Glaubende, die sich als Sünder nicht auf eigene Bemühungen oder religiöse Übungen stützen, sondern nur auf das Blut und das Opfer des Heilands?
Vers 15 ist vielen Gläubigen gut bekannt. Man hat im Blick auf seinen Inhalt auch schon von der Telefon-Nummer des Himmels gesprochen: 5015. Ja, in der Not darf jeder Erlöste seinen Gott anrufen und auf seine Rettung warten. Er verheisst jedem aufrichtig Rufenden: «Ich will dich erretten.» Und wenn wir Gottes Durchhilfe erfahren haben, dann lasst uns das Danken nicht vergessen: «Und du wirst mich verherrlichen.»
Gott richtet sein Volk (2)
Ab Vers 16 hat Gott als Richter seines Volkes ein ernstes Wort an die Gottlosen. Es sind die Ungläubigen, die die Worte der Bibel wohl im Mund führen, aber nicht nach den Anweisungen des Wortes Gottes leben. Er sagt zu ihnen: «Du hast meine Worte hinter dich geworfen» und führst ein sündiges Leben.
Gott wartet oft sehr lange, auch heute. Wenn aber jemand nur ein äusseres Bekenntnis zum Christentum hat, daneben aber ein Leben führt wie die ungläubigen Menschen dieser Welt, die nichts von Gott wissen wollen, wird er einmal ewig verloren gehen. Wenn seine Stunde der Verantwortung kommt, wird kein Retter da sein, denn er hat sich nie in Buße und Glauben zum Heiland gewandt.
Im letzten Vers werden zwei wichtige Sphären aufgezeigt, in denen der Gläubige sich bewegt. Er darf in die Gegenwart Gottes treten und Ihm das Lob und den Dank seines Herzens darbringen.
Anderseits befindet er sich in der Welt, umgeben von Ungläubigen. Hier soll er täglich in praktischer Gerechtigkeit leben, d.h. seinen Lebensweg so einrichten, dass er Gottes Anerkennung findet. Das ist kein einfacher Weg. Da begegnen uns manche Schwierigkeiten. Doch dann dürfen wir uns an Vers 15 erinnern und am «Tag der Bedrängnis» zu Gott rufen. Er wird nach seiner Weisheit und wie es am besten für uns ist antworten.
Das Ziel dieses Weges ist das Heil oder die Errettung nach Geist, Seele und Körper, wenn der Herr kommt, um uns zu sich zu holen.
Sündenbekenntnis
David war ein gläubiger Mann. Doch er fiel als König Israels in eine schwere Sünde. Er hatte Ehebruch betrieben und wollte diese Sünde mit einem Mord vertuschen. Aber Gott sandte den Propheten Nathan zu ihm, um ihn von seiner bösen Tat zu überführen (2. Samuel 11,1 – 12,15). Dieser Psalm zeigt uns, wie David durch ein aufrichtiges, schonungsloses Bekenntnis gegenüber Gott wieder zurechtkam. Auch wenn wir als Gläubige keine so schwere Sünde wie David verübt haben, wollen wir doch die in diesem Psalm enthaltenen Grundsätze auch für uns nehmen. Wenn wir als Kinder Gottes sündigen, dürfen wir dies jederzeit aufrichtig unserem Vater bekennen. Dann wird Er uns vergeben. Aber vielleicht ist uns nicht immer bewusst, dass jede Sünde, die wir verüben, ein Vergehen gegen Gott ist (Vers 6)!
Eine weitere Erkenntnis liegt in Vers 7. Unsere alte Natur ist durch und durch verdorben. Jeder von uns hat die Sünde als Wurzel in sich, und dies solange wir hier leben. In unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Es kann auch nicht verbessert werden.
Vers 8 warnt uns vor Unaufrichtigkeit. Wie leicht reden wir uns ein, es sei nicht so schlimm. Wir bemühen uns, die Sache in einem möglichst guten Licht darzustellen. Doch im Innersten wissen wir: Es ist eine Sünde, die bekannt werden muss, sonst kann Gott nicht vergeben. Froh können wir erst wieder werden, wenn die Sache vor Gott und wenn nötig vor Menschen wieder in Ordnung gekommen ist (Vers 10).
Wiederherstellung
David betete: «Verwirf mich nicht von deinem Angesicht.» Wird Gott, der Vater, eines seiner Kinder verwerfen, wenn es in Sünde fällt? Nein! Vom Herrn Jesus lesen wir, dass Er unser Sachwalter oder Fürsprecher ist, «wenn jemand gesündigt hat» (1. Johannes 2,1). Er übernimmt unseren Fall und gibt ihn nicht einfach auf. Welch ein Trost für jeden, der über die Sünde trauert, die in seinem Leben als Kind Gottes vorgekommen ist!
Aber die Sünde stört die Gemeinschaft zwischen uns und Gott. Und damit verschwindet auch die Freude (Vers 14). Sie kehrt erst wieder zurück, wenn wir zu Gott zurückgefunden haben, und zwar mit einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen. Dann wird Gott vergeben und wir dürfen aufs Neue die Freude der Gemeinschaft mit Ihm geniessen.
Als solche, die Gottes Barmherzigkeit und Vergebung erfahren haben, dürfen wir unsere Erfahrungen weitergeben (Vers 15). Um uns her leben noch so viele Menschen unversöhnt mit Gott. Sagen wir ihnen doch, dass Gott auch ihnen alle Schuld und jede Sünde vergeben will, wenn sie mit einem aufrichtigen Bekenntnis zu Ihm umkehren! Dann wird die Freude des Heils auch in ihr Herz einkehren.
Der Psalmist schliesst mit Opfern als einem Ausdruck von Lob und Dank. Das ist die Antwort eines Herzens, das sich der Vergebung Gottes gewiss ist und sich darum wieder uneingeschränkt freuen kann.
Der Gottlose und der Gerechte
Die Anfangsverse beschreiben die Begleitumstände, unter denen dieser Psalm gedichtet wurde. Es war die Anfangszeit der Flucht Davids vor Saul. Da kam er ins Haus des Priesters Ahimelech und bat um Brot für seine Leute. Aber Doeg, der Edomiter, der sich zu jener Zeit in Silo aufhielt, verriet die priesterliche Familie, sodass König Saul alle töten liess (1. Samuel 22 und 23).
Die ernsten Worte, die David in diesem Psalm an den gewalttätigen Doeg richtete, haben eine prophetische Bedeutung. Dieser Gewaltige, der das Böse mehr geliebt hat als das Gute, deutet auf den Antichristen in der Endzeit hin. Dieser Mensch der Sünde plant und führt auch Verderben gegen die gottesfürchtigen Juden aus, die ihn nicht als Messias anerkennen. Aber Gott wird ihn zerstören. Wenn Christus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird, werden das Tier (der Herrscher des Römischen Reiches) und der falsche Prophet (der Antichrist) auf der Stelle in den Feuersee geworfen werden (Offenbarung 19,20).
In den Versen 10 und 11 äussert David prophetisch die Worte des treuen Überrests, den der Herr Jesus bei seinem Kommen befreien wird. Sie haben vertraut und wurden nicht beschämt. Nun preisen sie Den in Ewigkeit, der alles für sie so wunderbar ausgeführt hat.
Nie beschämt Gott das Vertrauen der Seinen. Darum lasst auch uns auf seine Güte vertrauen und auf seinen Namen harren.
Der Abfall der Gottlosen
Interessanterweise ist dieser Psalm bis auf wenige Worte eine Wiederholung von Psalm 14. Es ist sicher nicht von ungefähr, wenn Gott in seinem ewigen Wort etwas wörtlich wiederholt. Betrachten wir den Inhalt der Verse genauer, dann müssen wir sagen: Er ist zeitlos aktuell.
Der Mensch hat Gott, seinem Schöpfer, nicht nur den Rücken zugekehrt (1. Mose 4,16). Manch einer versteigt sich sogar zur Behauptung: «Es ist kein Gott!» Aber Gott ist da, und Er sieht alle Menschen. Ja, Er schaut nach Verständigen aus, nach solchen, die nach Ihm fragen. Doch da ist kein Einziger, der, gemessen am Massstab Gottes, Gutes tut. Als seine Geschöpfe haben wir alle versagt.
Die Verse 5-7 beziehen sich zwar auf das irdische Volk Gottes und wie Er den Gottesfürchtigen zu Hilfe kommt und sich gegen ihre Feinde wendet. Allgemein gesehen, deuten sie aber darauf hin, dass Gott das gottlose Verhalten der Menschen nicht einfach übergeht. Die Zeit wird kommen, da Er jeden zur Rechenschaft ziehen wird, der nicht umgekehrt ist, der Gott nicht gesucht und den Heiland, Jesus Christus, nicht im Glauben angenommen hat. Am grossen weissen Thron des Weltenrichters wird kein Ungläubiger vorbeikommen (Offenbarung 20,11-15).
Warum aber muss der Tor es in seinem Herzen beteuern: «Es ist kein Gott!»? Weil sein Gewissen, solange es sich noch regt, das Gegenteil sagt. Ist nicht die Schöpfung einer der Beweise dafür, dass es einen Gott gibt? (Römer 1,19.20).
Der Gottesfürchtige ruft um Rettung
Zweimal heisst es, dass die Siphiter David an Saul verrieten, als er sich auf der Flucht vor dessen Nachstellungen in ihrer Gegend aufhielt (1. Samuel 23,19; 26,1).
Beide Male versuchte der König mit seinen Soldaten, David zu verhaften. Das erste Mal gelang es Saul, David und seine Männer zu umzingeln. Da blieb dem tapferen, gottesfürchtigen David wirklich nur noch der Ausweg nach oben. Der Psalm zeigt uns etwas von seinem Rufen nach Rettung. Im geschichtlichen Bericht finden wir, wie Gott auf seine Weise eingegriffen hat: Die Philister fielen ins Land ein, sodass Saul die Verfolgung Davids für den Moment aufgeben und den Feinden entgegenziehen musste. So konnte David dem Würgegriff Sauls entschlüpfen (1. Samuel 23,26-28).
In der zweiten Hälfte des Psalms sehen wir etwas vom Gottvertrauen Davids. Auch als die Lage menschlich gesehen ausweglos war, hielt er am Herrn fest: «Gott ist mein Helfer.» Er wurde nicht enttäuscht.
Und so endet der Psalm mit Lob und Dank und mit dem Zeugnis: «Aus aller Bedrängnis hat er mich errettet.» Wie gut ist der Herr!
Der Gott Davids ist auch unser Gott. Darum lasst uns Ihm ebenso vertrauen, und wenn wir im Leben in eine Situation kommen, die für uns ausweglos aussieht, dann wollen wir unser Vertrauen auf Gott nicht aufgeben, sondern wie David sagen: «Gott ist mein Helfer», und uns einfach auf Ihn stützen.
Der Gläubige wird bedrängt
David fleht hier in grosser Bedrängnis und Angst zu Gott. Seine Worte lassen uns an die Zeit denken, da er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste.
Prophetisch drücken die von David geäusserten Worte die grosse Not aus, in der sich der gläubige Überrest in der Endzeit befinden wird.
Aber manchmal werden die Angriffe der Menschen auch für einen gläubigen Christen so schlimm, dass er am liebsten weit fort fliehen würde. David wünschte sich Flügel einer Taube, um wegzufliegen. Aber dieses Gebet erhört Gott nicht immer. Oft können wir den Umständen einfach nicht entfliehen. Dann möchte der Herr, dass wir auf Ihn harren und auf Ihn vertrauen. Er wird uns nach seiner Verheissung neue Kraft schenken, damit wir uns mit unseren Flügeln des Glaubens aufschwingen können und nicht von den Umständen erdrückt werden (Jesaja 40,31).
Was David in diesem Psalm beschreibt, erlebte der Herr Jesus in besonderer Weise. Er kam als Mensch auf diese Erde und erfuhr sehr viel Feindschaft von den Menschen. Wie haben sie Den gehasst, der ihnen nur Liebe erwies! Wo fand Er einen Zufluchts- und Ruheort für seine Seele? Nur in seinem Gott. Darum suchte Er frühmorgens einen öden Ort auf, um zu beten, oder verharrte eine ganze Nacht im Gebet auf dem Berg (Markus 1,35; Lukas 6,12).
So dürfen auch wir immer wieder im Gebet unsere Zuflucht zu unserem Gott und Vater nehmen und bei Ihm zur Ruhe kommen.
Der Gläubige hofft auf Gott
Wer war diese Person, von der David in den Versen 13-15 spricht? Wer war dieser Freund und Vertraute, der zu seinem Widersacher wurde? Wir können an seinen Sohn Absalom denken, der sich gegen ihn erhob, um das Königtum an sich zu reissen. Aber da war auch Ahitophel, einer seiner weisen Berater, der den König verliess und zu seinem rebellischen Sohn hielt (2. Samuel 15 bis 17).
Hat der Herr Jesus mit seinem Jünger Judas Iskariot nicht Ähnliches erleben müssen? Jahrelang genoss dieser Mann die Nähe eines Meisters, wie es keinen zweiten gibt. Am Ende dieser Zeit «verkaufte» er Ihn an seine Feinde für den lächerlichen Preis von 30 Silberstücken und verriet Ihn in der Dunkelheit des Gartens Gethsemane mit einem Kuss. Welch ein Schmerz für das Herz unseres Herrn!
Ahitophel und Judas fanden beide ein schreckliches Ende, indem sie in der Verzweiflung Selbstmord begingen.
Prophetisch reden die Worte dieses Psalms vom Antichristen. Dieser Mann der Sünde wird sich als sehr religiös ausgeben. Aber er wird schlimm gegen alle die vorgehen, die ihn nicht als Messias anerkennen werden, und das werden die Gottesfürchtigen des Überrests sein.
Vers 23 ist eine Ermunterung für jeden geprüften Gläubigen. Wenn wir alles im Gebet auf den Herrn werfen, wird Er uns erhalten und nicht zulassen, dass wir wanken oder einknicken.
Vertrauen auf Gottes Treue
Vers 1 erinnert an die Situation, in der David diesen Psalm dichtete. Wieder war er in Not. Dieses Mal hielt er sich in Gat auf, da er hoffte, im Land der Philister Ruhe vor Sauls zu finden. Doch da gab es neue Bedrohungen (1. Samuel 21,11-16).
Auch dieser Psalm spricht prophetisch von dem, was die treuen Juden des Überrests in der zukünftigen Drangsalszeit durchmachen werden. Doch wir wollen uns heute auf die Verse konzentrieren, die für die Gläubigen aller Zeitperioden gültig sind:
Vers 5. Wohl jedes Kind Gottes hatte schon einmal Angst. Kennst du das nicht aus eigener Erfahrung? Dann dürfen wir diese Worte für uns nehmen und unser ganzes Vertrauen auf den Herrn setzen.
Vers 9. Nichts in unserem Leben entgeht Gott. Er nimmt Kenntnis von unserem Weg und weiss um jeden Fehltritt. Keine unserer Tränen übersieht Er. Und einmal wird der herrliche Augenblick kommen, da alle Schwierigkeiten, Nöte und alles Versagen hinter uns liegen werden. Dann wird Er selbst jede Träne von unseren Augen abwischen und damit jede Erinnerung an vergangenes Leid wegnehmen. Wie herrlich wird das sein!
Vers 10. «Dies weiss ich, dass Gott für mich ist.» Das sagt Paulus auch in Römer 8,31 und fügt hinzu: «Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?»
Verse 5 und 11. Das Wort Gottes nimmt hier einen wichtigen Platz ein. Der Glaube empfängt es, stützt sich darauf und freut sich darüber.
Vertrauen auf Gottes Rettung
Die Überschriften mancher Psalmen Davids zeigen, dass er sie vor allem in Zeiten der Verfolgung und Bedrängnis gedichtet hat. So hat er diesen Psalm vermutlich damals geschrieben, als er sich mit seinen Männern in einer Höhle versteckte und Saul ein Stück weit in die gleiche Höhle hineinging (1. Samuel 24,1-8). Was wäre geschehen, wenn David entdeckt worden wäre?
In seiner Not und Bedrängnis nahm er Zuflucht zum Schatten der Flügel Gottes, «bis das Verderben vorübergezogen ist». Die Flügel der göttlichen Liebe sind besser als die Flügel der Taube, um den Umständen zu entrinnen (Psalm 55,7). Unter ihnen findet der Gläubige sowohl Ruhe als auch Schutz. Zudem erwartete David die Rettung von oben, von Gott, der es für ihn vollendet. So wird auch in der Zukunft der Herr Jesus als «König der Könige und Herr der Herren» aus dem Himmel herniederkommen, um seine Feinde zu vertilgen und den treuen Überrest der Juden zu befreien (Offenbarung 19,11-21).
«Befestigt ist mein Herz, o Gott.» Das ist die Sprache eines Gläubigen, der sich völlig auf Gott stützt. Er weiss: Der Herr wird es für mich vollenden (Vers 3). In diesem Vertrauen kann er ruhen und Gott loben und preisen.
Es fällt auf, wie oft in den Psalmen, in denen David sein Gottvertrauen ausdrückt, von Lob und Dank die Rede ist. David konnte singen, bevor die Antwort auf seine Bitte eintraf. Und wir? Loben wir auch im Vertrauen, bevor die Antwort da ist?
Gott zeigt sich im Gericht
Die Fragen des zweiten Verses richten sich an die Richter, d.h. an die, deren Aufgabe es ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Doch die weiteren Verse sind eine Anklage gegen alle, die Unrecht tun und das Böse fördern. Es ist eigentlich der Weg des Menschen, der ohne Gott lebt. Von den Gottlosen heisst es in Vers 4: Sie sind von Geburt an abgewichen. Ja, der Mensch wird als Sünder geboren und solange er nicht Buße tut und an den Erlöser glaubt, lebt er als Sünder. Daher sucht man auf dieser Welt vergeblich nach echter Gerechtigkeit.
Erst wenn Gott selbst, in der Person des Herrn Jesus als Sohn des Menschen, als Richter auftreten wird, wird es auf dieser Erde wahre Gerechtigkeit geben (Vers 12b; Johannes 5,22.27; Matthäus 25,31.32). Vorher nicht.
Heute sind diese Verse, die nach Rache des Gerechten rufen, noch zukünftig. Jetzt leben wir im Zeitalter der Gnade, da der Herr Jesus den Menschen, bevor Er als Richter auftritt, als Heiland und Erlöser begegnen möchte. An uns liegt es, die Rettung, die Gott anbietet, im Glauben anzunehmen. Wer sein Gebot der Gnade zurückweist, wird seine Gerechtigkeit im Gericht erfahren müssen.
Der letzte Vers spricht vom Lohn für den Glaubenden. Gott wird einmal jede Treue im Leben der Seinen und jeden Einsatz für Ihn und seine Sache belohnen. Diese Anerkennung kommt mit der Regierung im Tausendjährigen Reich, die wir mit dem Herrn Jesus ausüben werden, zum Tragen (Lukas 19,16-19).
Bitte um Rettung von den Feinden
Dieser Psalm Davids entstand zu Beginn der langen Zeit, in der er von Saul mit tödlichem Hass verfolgt wurde. Nachdem eindeutig klar geworden war, dass sein Schwiegervater ihn töten wollte, gab es für David nur einen Ausweg: die Flucht (1. Samuel 19,10-12).
Warum wollte Saul ihn umbringen? Lag eine todeswürdige Schuld vor? Nein, überhaupt nicht. Gott hatte dem ungehorsamen König Saul erklärt, dass Er ihn verworfen habe. Das Königtum sollte sein Nächster bekommen, der besser war als er. Schon bald nach dem Sieg Davids über Goliath wurde Saul klar, wer dieser andere war: David (1. Samuel 18,8-11). Keine Schuld vonseiten Davids, sondern böser Neid und Hass machten Saul zum Feind Davids (Psalm 59,4.5).
Diese schwere Zeit der Verfolgung gehörte zur Lebensschule Gottes für David. Da bereitete Er ihn für das wichtige Amt eines Richters und Königs in Israel vor. In diesen Jahren der Prüfung lernte David, sein Vertrauen allein auf Gott zu setzen, Hilfe nur von Ihm zu erwarten und nur bei Ihm Zuflucht in der Not zu suchen.
Vers 9 erinnert an Psalm 2, wo die Nationen gegen den Herrn und seinen Gesalbten auftreten und sich von Gott lossagen möchten. Die erste Reaktion Gottes auf diese Überhebung des Menschen ist ein spöttisches Lachen. Ja, der Mensch meint, er sei gross und mächtig, und ist doch so verschwindend klein in den Augen seines Schöpfers (Jesaja 40,12-17). Auch wir als Gläubige wollen nicht vergessen, wie gering und klein wir sind, und stets demütig vor Gott sein.
Bitte um Rache an den Feinden
In den notvollen Umständen, durch die Gott seinen Knecht David führte, machte dieser ganz persönliche Erfahrungen mit dem Allmächtigen. Nun konnte er sagen: Mein Gott, meine Stärke, meine hohe Festung, Gott meiner Güte (Psalm 59,10.11.18). In Psalm 18, den David geschrieben hat, nachdem der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde gerettet hatte, finden wir ähnliche persönliche Aussagen über Gott. Es gab für ihn keine unüberwindbaren Hindernisse mehr: «Mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen» (Psalm 18,30).
Wenn wir uns ganz auf den Herrn stützen, werden wir ähnliche Erfahrungen wie David machen und unser Vertrauen zum Herrn wird gestärkt.
Vers 13 erinnert an Sünden, die wohl am häufigsten vorkommen. Wie schnell haben wir mit Worten gesündigt! Darum sollte das Gebet in Psalm 141,3 auch unsere Bitte sein: «Setze, Herr, meinem Mund eine Wache, behüte die Tür meiner Lippen!»
Auch dieser Psalm endet ähnlich wie Psalm 57 mit einem Lobgesang. David hat das Bedürfnis, seinen Gott, der ihm eine so starke Zuflucht ist, jubelnd zu preisen. Er will dem Gott seiner Güte Psalmen singen. Haben wir auch den Wunsch, Gott trotz den Schwierigkeiten, in denen wir uns befinden, zu loben und Ihm zu singen? Grund genug dafür hätten wir, wenn wir an seine Güte und Durchhilfe in vergangenen Tagen denken. Auch für uns bleibt wahr: Danken schützt vor Wanken; Loben zieht nach oben.
In grosser Bedrängnis
Die Überschrift lässt an schwere kriegerische Auseinandersetzungen denken. Aber aus den Versen 3-5 muss man doch schliessen, dass diese Angriffe verschiedener Feinde auf sein Volk eine Züchtigung Gottes waren. Irgendein Abweichen des Volkes führte dazu, dass Gott das Land erschüttern musste. Aber nun bittet der König David: «Führe uns wieder zurück!»
Auch in unserem Leben kann es vorkommen, dass Gott eingreifen muss, weil wir vom Weg abgekommen sind oder sonst versagt haben. Wie kann die Sache wieder in Ordnung kommen? Indem wir auf Gott blicken und auf Ihn hören. Er «hat geredet in seiner Heiligkeit». Sobald wir die Sache im Licht seiner Heiligkeit erkennen, dürfen wir sie bekennen und Er wird vergeben (1. Johannes 1,9).
Nachdem in den Versen 8-10 Gott gesprochen hat, fragt König David in Vers 11: «Wer wird mich … führen?» Wie schön ist die Antwort in Vers 12: «Nicht du, Gott, der du uns verworfen hast?» Der Herr, der sein Volk gezüchtigt hat, wird sein sicherer und treuer Retter und seine Kraft sein. Durch Ihn und mit Ihm werden die, die ohne Kraft sind, tapfere Taten tun.
Welch eine Ermunterung auch für uns! Der Gott Davids und Israels ist auch unser Gott. So wollen wir aus diesem Psalm lernen, die Züchtigung Gottes anzunehmen, das in Ordnung zu bringen, worauf Er allenfalls den Finger legt, und durch alles hindurch im Glauben auf Ihn zu blicken. Dann gilt auch für uns: «Mit Gott werden wir Mächtiges tun.»
Gebet
Die drei Psalmen 61, 62 und 63 stellen einen zusammenhängenden Gedanken vor. In Psalm 61 finden wir das Gebet des Glaubenden, in Psalm 62 sein Gottvertrauen und in Psalm 63 seine Gemeinschaft mit Gott.
David schreit hier im Gebet zu Gott. Haben wir nicht auch schon erlebt, dass Not beten lehrt? Und wenn wir zu Gott rufen, erfahren wir, dass Er uns auf einen Felsen leitet. Dieser Fels sind die Zusagen Gottes für uns in der Bibel – ein unerschütterliches Fundament für uns als Glaubende.
In Vers 4 blickt der Beter zurück und denkt an die erfahrene Hilfe Gottes in der Vergangenheit. Aber er schaut auch nach vorn und weiss: Mag passieren, was will, Gott wird mich ans Ziel bringen. Für uns Christen ist dies das Vaterhaus droben. Doch der Schutz seiner Flügel redet davon, dass wir als Gläubige schon auf dieser Erde Geborgenheit bei Gott finden.
Der erste Teil von Vers 7 hat sich bei David erfüllt, als er, nachdem er vor Absalom fliehen musste, wieder nach Jerusalem zurückkam. Aber der zweite Teil von Vers 7 und Vers 8 reden prophetisch vom Herrn Jesus. Er ist Mensch geworden und als Mann im Alter von ungefähr 33 Jahren gestorben. Doch Er ist auferstanden und lebt als Mensch in alle Ewigkeit vor Gott (obwohl Er gleichzeitig der ewige Sohn Gottes ist, der nie aufgehört hat, Gott zu sein).
Der Psalm endet mit dem Gedanken der ewigen Anbetung der Erlösten.
Gottvertrauen
Dieser Psalm spricht von echtem Gottvertrauen. Was ist darunter zu verstehen? Es ist ein Leben des Glaubens in Gemeinschaft mit Gott. David stützte sich nur auf seinen Gott (Psalm 62,2.3.6.7). Er suchte keine Alternativen. Nur zu Ihm nahm er in allen Lebenslagen Zuflucht. Sein Gottvertrauen war eine Sache des Herzens. Er vertraute still.
In Vers 2 sagt er: «Von ihm kommt meine Rettung.» Aber Gott greift nicht immer sofort ein. Das müssen auch wir lernen und können dann mit David sagen: «Von ihm kommt meine Erwartung» (Vers 6) und den Zeitpunkt seines Eingreifens Gott überlassen.
Die Verse 4 und 5 deuten an, dass der Feind unserer Seelen sich bemüht, unser Gottvertrauen zu zerstören. Sowohl durch seine Macht (Vers 4) als auch durch seine Listen (Vers 5) versucht er, unseren Glauben an Gott zu erschüttern. Dazu bedient er sich Menschen, die sich gegen uns stellen. Mögen die Verse 6-8 auch unsere Antwort auf diese Angriffe sein!
David gab seine Erfahrungen weiter, indem er andere ermunterte, ebenfalls auf Gott zu vertrauen und dabei alles im Gebet vor Ihm auszuschütten (Philipper 4,6.7).
Die Verse 10 und 11 warnen davor, weder auf Menschen noch auf sich selbst zu vertrauen. Wir werden vielmehr aufgefordert, uns auf das Wort Gottes zu stützen, auf alles, was Er geredet hat und in der Bibel aufschreiben liess.
Gemeinschaft
In diesem Psalm spricht David nun von Gott selbst. Es geht ihm jetzt um Den, zu dem er gebetet und auf den er vertraut hat. Er hat eine persönliche Beziehung zu Ihm, denn er sagt von Ihm: «Du bist mein Gott!»
Den zweiten Teil von Vers 2 können wir gut auf die Zeit des Neuen Testaments übertragen, in der wir leben. Bei unserer Bekehrung empfingen wir das Heil unserer Seele, neues Leben; aber unser Körper ist noch nicht erlöst. Darum «schmachtet unser Fleisch» nach dem Tag der Erlösung. Darum erwarten wir den Herrn Jesus als Heiland, der kommen und uns zu sich entrücken wird (Philipper 3,20.21). Auch wir dürfen, während wir in dieser Welt (Wüste) leben, im Heiligtum die Macht Gottes, seine Herrlichkeit, aber auch seine Güte betrachten. Alles dies erkennen wir in unserem Herrn, der als verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes thront und bald in Macht erscheinen wird.
Wenn David über all das nachdenkt, was sein Gott ihm bedeutet, dann kann er nur jubeln und preisen. Nicht nur seine Lippen sollen loben, auch sein Leben, sein ganzes Verhalten, soll zur Ehre Gottes sein.
Um die Gemeinschaft mit Gott geniessen zu können, müssen wir zur Ruhe kommen. Davon spricht Vers 7. Und Vers 8 erwähnt nochmals die erfahrene Hilfe und den Schutz, den wir bei Gott finden. Was ist die Schlussfolgerung von allem, was dieser Psalm uns vorstellt? Nachdem wir den Herrn und seine Herrlichkeit gesehen haben, möchten wir Ihm unmittelbar nachfolgen (Vers 9 Fussnote).
Schutz vor listigen Angriffen
Solange wir Gläubige in dieser Welt leben, sind wir von ungläubigen Menschen umgeben. Manchmal lassen sie uns ihre Feindschaft, die sich auch gegen unseren Herrn Jesus richtet, offen spüren. Dann dürfen wir uns im Gebet an Gott wenden, Ihm alles sagen und uns seinem Schutz und seiner Bewahrung anbefehlen.
Ungläubige Menschen denken oft, niemand würde sie sehen. Sie könnten ihre Pläne ohne Weiteres ausführen. Aber sie vergessen Gott. Ihm entgeht nichts. Manchmal greift Er plötzlich ein und lässt sie ernten, was sie gesät haben. Und wenn Er in der heutigen Zeit der Gnade den Dingen oft lange Zeit den Lauf lässt, bedeutet dies keineswegs, dass Er sie übersieht oder dass Ihm irgendetwas aus den Händen gleiten würde. In der Zukunft, wenn die Gläubigen entrückt sind, wird Gott wieder direkter in die Ereignisse eingreifen. Die Menschen werden dies erkennen und sich fürchten. Doch es wird für sie dann zu spät sein, noch Buße zu tun. Die Zeit der Gnade wird dann vorbei sein.
Als Glaubende wollen wir uns durch Vers 11 trösten und ermuntern lassen. Die tiefe Ursache unserer Freude sind nicht die Umstände – die oft sehr notvoll sein können –, sondern der Herr. Bei Ihm finden wir unsere Zuflucht. Und wir dürfen uns freuen, dass unserem Herrn und Heiland, der viel mehr als wir die Angriffe böser Menschen erfahren hat, einmal alle Ehre zuteil wird, die Ihm gebührt.
Gottes Segen im Friedensreich
Welch ein schöner Titel gibt David hier seinem Gott. Er nennt Ihn: Hörer des Gebets. Zu Ihm dürfen wir jederzeit und mit allem im Gebet kommen. Das gilt auch, wenn eine Sünde in unserem Leben vorgefallen ist. Dann wollen wir sie Ihm aufrichtig bekennen – und Er wird vergeben.
Wir denken bei diesen Versen vor allem an das Volk der Juden. Obwohl viele Juden in ihr Land zurückgekehrt sind, schweigt im Augenblick der Lobgesang in Zion. Er wird erst wieder zu Gottes Ehre ertönen, wenn dieses Volk im Glauben zu Ihm umgekehrt sein wird, d.h. wenn der gläubige Überrest die Schuld der Verwerfung von Christus einsehen, Buße tun und Vergebung erlangen wird. Sie werden in den Segen des Tausendjährigen Reiches eingehen. In jener Zeit wird Gott sich in wunderbarer Weise der Erde annehmen und alle dann lebenden Menschen werden es gut haben wie noch nie (Psalm 65,5.10-14).
«Glückselig der, den du erwählst und herzunahen lässt!» Auch jeder gläubige Christ ist auserwählt, aber zu einer weit höheren und herrlicheren Bestimmung als die Israeliten. Wir sind auserwählt in Christus vor Grundlegung der Welt, um Söhne des himmlischen Vaters zu sein (Epheser 1,3-7). Als solche dürfen wir einmal ewig bei Ihm in seinem Haus weilen, da, wo der Herr Jesus selbst ist (Johannes 14,2.3; 17,24). Freust du dich über diese herrliche Stellung? Weilst du in Gedanken oft im Himmel, wo wir bald auch dem Körper nach sein werden?
Gott hilft seinem Volk
Diese Verse sind ein Psalm-Lied, das zum Lob Gottes und zur Bewunderung seiner Grosstaten aufruft. Zu Beginn des Tausendjährigen Reiches wird das wiederhergestellte Volk Israel die Menschen an die Grösse Gottes und an die Herrlichkeit seiner Werke erinnern und die ganze Erde zum Lob und zur Anbetung Gottes auffordern.
Dem Herrn Jesus als König der Könige und Herr der Herren werden sich alle unterwerfen müssen. Während seines Friedensreiches wird das geringste Anzeichen von Auflehnung sofort mit dem Tod bestraft werden. Seine gerechte Regierung wird den Frieden garantieren. Doch die Menschen, die dann nicht von neuem geboren sind, werden Ihm Gehorsam heucheln und sich Ihm mit Schmeichelei unterwerfen (Vers 3). Am Ende der tausend Jahre wird der Teufel für kurze Zeit losgelassen. Dann wird sich zeigen, dass die besten äusseren Voraussetzungen, wie sie während des Tausendjährigen Reiches herrschen werden, das Herz des Menschen nicht verändern können. Es wird zu einer letzten Rebellion gegen Jesus Christus kommen (Offenbarung 20,7-10).
In der Anwendung für uns sind die beiden Psalmen 65 und 66 eine Illustration von Jakobus 5,13: «Leidet jemand unter euch Trübsal? Er bete» (Psalm 65). «Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen» (Psalm 66). Diese Reihenfolge sollte auch unser Leben prägen. Mit jeder Not dürfen wir im Gebet zu Gott kommen. Aber nachdem Er unser Flehen erhört hat, sollten wir das Loben und Danken auf keinen Fall vergessen.
Das Volk betet Gott an
In den Versen 10-12 denken die Gottesfürchtigen aus Israel an die Wege Gottes mit ihnen während der Drangsalszeit. Diese Prüfung und Läuterung, diese Bedrängnisse und Nöte (Feuer und Wasser) sind nötig, um die gläubigen Juden zur Buße und zur Einsicht über ihre Sünde der Verwerfung ihres Messias zu führen. Dann wird Gott aufgrund des Erlösungswerks von Golgatha vergeben und eine völlige Wiederherstellung schenken.
Nach der Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und seinem irdischen Volk wird es wieder Opfer geben, die Gott wohlgefällig sind.
Wenn es um die Grosstaten Gottes, um seine auf der Erde offenbarten Werke geht, sagt der Psalmist: «Kommt und seht!» Wenn es sich aber um das Werk Gottes im Innern eines Menschen handelt, das niemand sieht, dann heisst es: «Kommt und hört!» Erst durch das mündliche Zeugnis und das veränderte Verhalten eines Menschen können andere erkennen, wenn ein Werk Gottes an Herz und Gewissen stattgefunden hat und jemand errettet ist (vergleiche Römer 10,9.10).
Vers 12b gilt auch für uns. Jedes Kind Gottes wird in der Schule Gottes erzogen. Dabei möchte der Vater, der uns liebt, uns von allem befreien, was nicht zu Ihm passt (Vers 10). Prüfungen sind nicht angenehm. Aber lasst uns ans Ziel denken: Er wird uns herausführen zu überströmender Erquickung.
Vers 18 erinnert uns daran, dass Gott die Beweggründe sieht, die unseren Gebeten zugrunde liegen. Er wird nur aufrichtige Bitten erhören.
Bitte um Segen
Dieser Psalm spricht von der herrlichen Zeit des Tausendjährigen Reiches. Dann werden alle Völker Gott preisen. Welch ein Gegensatz zu heute, da in unseren einst christlichen Ländern die Gottesfurcht immer mehr schwindet! Andere Nationen verehren entweder einen falschen Gott oder falsche Götter oder der Gedanke an einen allmächtigen Schöpfer-Gott wird überhaupt abgelehnt.
Bis der in diesen Versen beschriebene Zustand eintritt, muss die Welt noch zwei wichtige Lektionen lernen. Die erste ist Gerechtigkeit. Gott wird all das Böse nicht einfach übersehen. «Wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit» (Jesaja 26,9). Das zweite ist Gnade. Darum die Bitte: «Gott sei uns gnädig … damit man auf der Erde deinen Weg erkenne.» Das Handeln Gottes mit seinem Volk Israel wird eine Demonstration seiner göttlichen Güte sein. «Jerusalem soll mir zum Freudennamen, zum Ruhm und zum Schmuck sein bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören werden, das ich ihnen tue» (Jeremia 33,9). Die Wiederannahme des irdischen Volkes Gottes, das wegen der Verwerfung seines Messias so lange Zeit auf die Seite gestellt wurde, wird für die Welt «Leben aus den Toten» bedeuten (Römer 11,15).
Die Aussicht dieses Psalms ist herrlich. Doch er geht nicht über die Erkenntnis Gottes hinaus. Wir aber dürfen Ihn als Vater kennen und sind als seine geliebten Kinder in seine unmittelbare Nähe gebracht.
Gott segnet sein Volk
Der Grundton dieses Psalms ist prophetisch. David als inspirierter Schreiber denkt an eine zukünftige Zeit und beschreibt das Kommen Gottes in der Person des Messias als ein mächtiger Monarch. Wir denken an das Erscheinen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde. Niemand wird Ihn auf diesem Weg hindern und Ihm entgegentreten können. Alle seine Feinde werden wie Wachs vor dem Feuer zerschmelzen (Offenbarung 19,19-21). Gleichzeitig blickt David zurück auf die Wege Gottes mit seinem Volk. Er beginnt den Lied-Psalm mit den gleichen Worten, die Mose einst äusserte, als die Bundeslade vom Sinai aufbrach, um weiterzuziehen (4. Mose 10,35).
Gott ist ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen. Bis heute will Er denen, die keine menschliche Stütze haben, ein liebender und fürsorgender Vater sein. Er übernimmt die Rechtssache derer, die leicht übervorteilt und ausgenützt werden, weil sie die Schwächeren sind. Welch ein Trost für alle einsamen und benachteiligten unter den Seinen!
«Gott lässt Einsame oder einzeln Zerstreute in einem Haus oder einer Familie wohnen, führt Gefangene hinaus ins Glück.» Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht als ihren Heiland angenommen haben, sind oft innerlich einsam und gefangen in ihrem Leben als Sünder. Wer aber in Buße und Glauben zu Ihm gekommen ist und Ihm nachfolgt, hat eine grosse Familie, die Familie Gottes, gefunden. Er gehört als Kind des himmlischen Vaters nun auch dazu und erlebt das Glück und die Freiheit der Kinder Gottes.
Gott richtet die Feinde seines Volkes
Die Bibel berichtet uns von verschiedenen Bergen, die für Gott und sein Volk von Bedeutung sind. Vers 18 erinnert uns an den Berg Sinai. Er steht als Symbol für die Heiligkeit Gottes da. Dort hatte Israel sich freiwillig allen Forderungen Gottes unterstellt und musste dann erleben, wie furchtbar, ja, grauenerregend seine Heiligkeit für den natürlichen, nicht von neuem geborenen Menschen ist. Doch der Sinai ist nicht der Berg, den Gott zu seinem Wohnsitz begehrt hat (Vers 17). Das ist der Berg Zion (Psalm 132,13). Im Tausendjährigen Reich wird Zion der Sitz der königlichen Macht in Gnade sein. Und worauf gründet sich diese Gnade? Auf den Sühnungstod von Christus am Kreuz und auf seine siegreiche Auferstehung, die in Vers 19 angedeutet wird (vergleiche Epheser 4,8-10).
«Gepriesen sei der Herr!» Das gilt sowohl für das, was in Vers 19 steht, als auch für das, was in Vers 20 folgt. Wenn wir an den Herrn Jesus denken, der am Kreuz Satan besiegt und «die Gefangenschaft gefangen geführt» hat, dann haben wir als Erlöste und Befreite allen Grund, Ihn in alle Ewigkeit zu loben und zu preisen. Aber wir dürfen Ihn auch preisen für das, was wir jeden Tag erfahren: seine Durchhilfe und seine Rettung in den Umständen. «Tag für Tag trägt er unsere Last.» Nie wird Er müde, nie überlässt Er das, was Er uns auferlegt hat, einfach uns selbst. Jeden Tag ist Er mit seiner Kraft und seiner Gnade da. Gepriesen sei Er dafür!
Die Nationen anerkennen Israel
Bei der Beschreibung «der Züge meines Gottes» dachte David sicher an den triumphalen Einzug der Bundeslade in Jerusalem (1. Chronika 15). Die Bundeslade ist ein eindrückliches Bild von Christus selbst – wahrer Gott und wahrer, sündloser Mensch in einer Person. Wenn Er in der Zukunft in Jerusalem einziehen wird, wird nicht nur sein Volk Ihm zujauchzen, sondern alle Völker werden Ihn ehren (Psalm 66,8). Die Könige werden Geschenke bringen und sich der Oberherrschaft des Herrn Jesus unterwerfen. Alles wird sich auf Jerusalem konzentrieren; denn in dieser Stadt wird im Reich von Christus der Sitz der Zentralregierung der ganzen Erde sein.
Vers 32 erinnert an die Prophezeiung Jesajas über Ägypten und Assyrien, in der es heisst, dass Israel mit Ägypten und Assyrien ein Segen inmitten der Erde sein wird (Jesaja 19,23-25).
Obwohl im Tausendjährigen Reich die Universalherrschaft des Herrn Jesus von allen anerkannt werden muss und auch anerkannt wird, herrscht nicht einfach sklavische Unterwerfung, sondern Freude. Zu gross und herrlich ist der weltweite Segen jener Zeit, als dass sich jemand beklagen könnte oder es anders wünschte. So löst der Segen, unter dem dann alle Menschen auf der Erde stehen werden, in den Herzen Lob und Dank gegenüber dem Geber aus. «Singt Gott, besingt den Herrn … Gepriesen sei Gott!» Alle Ehre gebührt Dem, der hier einst der Verworfene und Gekreuzigte war.
Christus leidet
Dieser Psalm wird im Neuen Testament öfters zitiert. Immer geht es um die Erfüllung seiner Aussagen im Blick auf unseren Herrn. Im Zentrum stehen die Leiden unseres Erlösers in seinem Leben und am Kreuz. Wenn wir an seinen Tod denken, zeigt uns dieser Psalm besonders die Seite des Schuldopfers. Durch seinen Sühnungstod hat Er unsere Schuld, die wir vor Gott aufgehäuft haben, bezahlt (Vers 5b).
Die Verse 1-7 drücken prophetisch die Empfindungen des Heilands aus, als Er am Kreuz hing. Da ergoss sich der ganze Hass seiner Feinde über Ihn, obwohl sie überhaupt keine Ursache hatten, Ihn so zu behandeln. Und wie schwer war es für Ihn, die drei Stunden der Finsternis vor sich zu haben! Die Verse 2-4 drücken etwas von dieser Seelennot aus.
Die Verse 8-13 sind ein Rückblick auf sein Leben. Diese Worte zeigen uns seine Leiden um der Gerechtigkeit willen. Seine Brüder, die Söhne seiner Mutter, glaubten nicht an Ihn und lehnten Ihn damals noch ab (Johannes 7,5).
Auch die Tränen des Herrn Jesus drücken seine Leiden aus. Er weinte über Jerusalem. Er weinte am Grab von Lazarus, und auch im Garten Gethsemane hat Er «mit starkem Schreien und Tränen» zu Gott gebetet.
«Die im Tor sitzen» – das waren die Männer der Justiz und Verwaltung. Die Zecher sind die Leute in den Gaststätten. Beide Gruppen von Menschen – die hochgestellten und die gewöhnlichen Leute – lachten über Ihn. Wie furchtbar musste das alles den Herrn getroffen haben!
Christus betet
Diese Verse zeigen uns den Herrn Jesus am Kreuz. Wie gross war die Schmach, die Er da empfand! Sein Gebet ging zu Gott, der im Begriff stand, Ihn in den drei Stunden der Finsternis für uns zu schlagen. Obwohl Er um Erlösung und Errettung flehte, konnte Gott Ihm jene Wasser des Gerichts und jene Tiefen des völligen Verlassenseins nicht ersparen.
Wenn wir in Schwierigkeiten und Nöte kommen, in denen wir meinen, den Boden unter den Füssen zu verlieren, dann dürfen wir zu Gott rufen. Er vermag uns aus dem Schlamm zu ziehen und vor dem Ertrinken zu bewahren (Matthäus 14,30.31). Aber unser Herr bekam in den drei Stunden der Finsternis keine Antwort von Gott, zu dem Er schrie (Psalm 88,2.3.14-19).
Dreimal erwähnt der Herr in diesem Psalm den Hohn der Menschen. Er wurde für seine Treue und Hingabe an Gott in seinem Leben verhöhnt (Vers 8). Doch am Kreuz brach der Hohn sein Herz (Psalm 69,20.21). Der Herr Jesus wartete gewissermassen auf irgendeine Liebes- und Mitleidsbezeugung vonseiten der Menschen. Doch Er fand nichts dergleichen (vergleiche dazu Psalm 22,7-9).
Die gottesfürchtigen Frauen, deren Herz für Ihn schlug, sahen von weitem zu (Matthäus 27,55). Sie waren selber so erschüttert. Wie hätten sie trösten können?
Vers 22b erfüllte sich, als nach dem Ausruf des Erlösers: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?», Ihm jemand mit einem Schwamm, den er mit Essig gefüllt hatte, zu trinken gab.
Gericht, Rettung, Lob
Um die Verse 23-29 dieses Psalms zu verstehen, müssen wir bedenken, dass wir die Anfangsverse auch auf den treuen Überrest aus dem irdischen Volk Gottes in der zukünftigen Drangsalszeit anwenden können. Auch sie werden angefeindet und verhöhnt und gehen durch die Wasser der Trübsal. Es ist ihre Stimme, die nach Gericht über ihre Feinde ruft. Wenn der Herr Jesus zu ihrer Befreiung erscheinen wird, wird dies für die Ungläubigen Gericht bedeuten.
Doch die letzten Verse des Psalms lassen uns noch einmal an den Herrn Jesus denken und an den Sieg, den Er am Kreuz errungen hat. Er wurde doch noch erhört. Gott hat Ihn nach vollbrachtem Erlösungswerk aus den Toten auferweckt.
Nun liegen alle Leiden für immer hinter Ihm. An die Stelle der Not und der Leiden ist jetzt Freude getreten. Davon spürt man etwas in diesen Versen. Die «Sanftmütigen» sind seine Erlösten, die in die Freude Dessen eintreten, der so viel für sie gelitten hat.
Die Wiederherstellung des Volkes Israel (Gott wird Zion retten) und die Segnungen des Tausendjährigen Reiches gründen sich auf das am Kreuz vollbrachte Erlösungswerk. Darum werden schliesslich Himmel und Erde und das Meer aufgefordert, Gott zu loben. Es wird ein universelles Lob zur Ehre Dessen sein, der einst am Kreuz unsäglich gelitten hat.
Hilferuf in der Bedrängnis
Diese Verse entsprechen im Wesentlichen den letzten Versen von Psalm 40. Auch jener Psalm weist prophetisch auf unseren Herrn hin. In Vers 1 heisst es, dass dieser Psalm «zum Gedächtnis» sei. Liegt hier vielleicht der Grund dafür, dass David diese Zeilen wiederholen musste? Wir wollen, wenn wir geprüft werden, an unseren Herrn denken und an das, was Er durchgemacht hat! Er wandte sich mit allem im Gebet an seinen Gott und klammerte sich an Ihn. Lasst uns Ihn nachahmen!
Das Lachen der Spötter beim Unglück der Gläubigen verletzt tief. Auch die Seele des Heilands wurde auf diese Art verwundet (Markus 15,29.30). Manchmal haben auch wir als Gläubige ein vorschnelles Urteil, wenn es einem anderen schlecht geht. Wir meinen, den Grund für die Prüfung zu kennen und reden offen davon. Dabei merken wir nicht, wie sehr wir damit den anderen verletzen.
Vers 5 zeigt uns einen Menschen, der nicht an sich, sondern an das Wohl der anderen denkt: «Lass fröhlich sein und in dir sich freuen alle, die dich suchen!» Wie gut für uns, wenn wir in der Prüfung von uns wegblicken und für andere besorgt sein können!
Der Herr Jesus ist uns auch darin ein einzigartiges Vorbild. Selbst in den grössten Leiden, als Er am Kreuz hing, war Er noch für andere – für seine Mutter – besorgt (Johannes 19,26.27). Nie hat Er an sich, immer nur an die anderen gedacht.
Gott hilft in der Jugend und im Alter (1)
Aus verschiedenen Versen dieses Psalms wird deutlich, dass der inspirierte Schreiber ein alter Mann war, der aber von Jugend an mit seinem Gott gelebt hat. Auf Ihn hatte er sich in jungen Jahren im Vertrauen gestützt. Diesem seinem Gott gehörte aber auch sein Lob und sein Dank. So sollte es auch bei uns sein. Denn das, was wir durch den Glauben erleben durften, ist doch ein Wunder der Gnade: Einst waren wir Feinde Gottes, jetzt sind wir seine geliebten Kinder!
Aber nun spürt der Psalmschreiber, wie die Kräfte abnehmen. Da klammert er sich umso fester an Gott (Vers 9). Er bittet: «Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich stets gehen kann!» – auch im Alter.
Doch er hat noch ein anderes Problem. Als alt werdender gläubiger Mann empfindet er die Welt der Ungläubigen, die ihn umgibt. Er hat den Eindruck, dass die Menschen jetzt besonders auf ihn schauen und sehen möchten, ob sein Gott ihm in der Zeit des Altwerdens und des Abnehmens der Kräfte hilft. Seine ungläubigen Feinde sagen bereits: «Gott hat ihn verlassen.»
Doch wir haben einen grossen, gütigen und gnädigen Gott und Vater, der die Seinen auch im Alter nicht verlässt. Eine Antwort auf die Bitte des Psalmisten in den Versen 10-12 finden wir z.B. in Jesaja 46,4: «Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen; ich habe es getan, und ich werde heben, und ich werde tragen und erretten.»
Gott hilft in der Jugend und im Alter (2)
Voll Zuversicht auf den Gott, der ihn auch im Alter nicht verlassen wird, sagt der Psalmdichter: «Ich aber will beständig harren und all dein Lob vermehren.» Aber er tut noch etwas. Nachdem der grösste Teil seines Lebens mit Gott hinter ihm liegt, will er seine Erfahrungen weitergeben, anderen von der Durchhilfe seines Gottes erzählen, damit auch sie auf Ihn vertrauen. – Wenn er weiter sagt: «Gott, du hast mich gelehrt von meiner Jugend an», dann bezeugt er, dass er in der Schule Gottes war. Gott erzieht jedes seiner Kinder. Möchten wir an den Bemühungen seiner Liebe nicht achtlos vorbeigehen, sondern bereit sein, seine Lektionen zu lernen. Es wird nicht immer einfach sein. Aber unser Vater erzieht uns, damit die Wesenszüge seines Sohnes in unserem Leben vermehrt sichtbar werden.
«Bis ich deinen Arm dem künftigen Geschlecht verkünde.» Wie schön ist es, wenn gläubige Grossväter und Grossmütter oder andere ältere Gläubige den Kindern und Heranwachsenden nicht von sich erzählen, sondern vom Arm und von der Macht des Herrn, die sie erleben durften.
Jede Prüfung in unserem Leben sollte am Ende zweierlei bewirken: dass wir Gott besser kennenlernen («Gott, wer ist wie du?») und Ihn dafür loben, dass Er alles zu seinem Ziel gebracht hat (Psalm 71,20-24). Es wird nach seiner Gerechtigkeit sein (Psalm 71,2.16.19.24). Bei Gott ist nichts zufällig. Alles, was Er tut, stimmt mit dem überein, was Er ist: gerecht, allmächtig und treu. Ihm wollen wir vertrauen.
Christus wird herrlich regieren
Obwohl dieser Psalm «für Salomo» war, weist er doch auf einen grösseren als den direkten Sohn Davids hin: auf Jesus Christus, den König der Könige. Diese Verse beschreiben den Wohlstand in Israel und auf der Erde unter der Regierung des Friedefürsten. Alles hängt von Christus ab, der in Gerechtigkeit regieren wird. Er wird sich denen besonders annehmen, die unter der ungerechten Regierung der Menschen so oft benachteiligt wurden. Es sind die Elenden, die Armen, die Geringen. In jener Zeit wird sich Sacharja 14,9 erfüllen: «Der Herr wird König sein über die ganze Erde, an jenem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer.»
Als König wird der Herr Jesus alle Richter der Erde übertreffen. Sein Urteil wird immer gerecht und göttlich weise sein, wie wir dies bei Salomo nur angedeutet finden (1. Könige 3,16-28). Die Folge dieser göttlich gerechten Herrschaft wird Frieden, Glück und Wohlergehen für die Menschen sein (Vers 3). Vers 6 illustriert den Segen jener Zeit. Er wird wie Regen auf die gemähte Flur sein. Die gemähte Wiese weist wohl auf den schwer geprüften treuen Überrest des Volkes Israel sowie auf die durch Gerichte heimgesuchte Erde hin.
Dann wird es keine Bedrückung der Gläubigen mehr geben wie heute (Vers 7). Die Unterwerfung unter die Herrschaft des Herrn Jesus wird global sein. Alle werden sich Ihm beugen. Wie in Vers 11 lesen wir auch in Offenbarung 21,24.26 von Königen und Nationen, die den Herrn ehren werden.
Christus wird retten und segnen
Die Verse 12-14 erinnern an das erste Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde. Wie sehr hat Er sich damals um die Elenden und Armen gekümmert! Nicht die Selbstgerechten, sondern alle, die sich ihrer Not und ihrer Sünden bewusst waren, haben seine Gnade erfahren.
Im Tausendjährigen Reich wird es für alle dann lebenden Menschen genug zu essen geben; keinen Hunger mehr auf dieser Erde! Der zweite Teil von Vers 16 lässt daran denken, dass die Bevölkerung der Erde durch die Gerichte in der Drangsalszeit sehr stark dezimiert werden wird. Im Tausendjährigen Reich aber werden die Menschen aufs Neue «hervorblühen».
«Sein Name wird ewig sein.» Es ist der Name unseres Erlösers, von dem es in Philipper 2,9 heisst: «Darum (weil er bis zum Tod am Kreuz gehorsam wurde) hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist.» Als Antwort auf den Segen, den alle Völker dann geniessen werden, werden alle Nationen Ihn glücklich preisen. Alles wird zur Verherrlichung Gottes, des Vaters, ausschlagen (Psalm 72,18.19; Philipper 2,11).
Mit der Aufrichtung des Königreichs von Christus enden alle Wünsche und Bitten und jedes Verlangen des Volkes Israel. Deshalb schliesst der Psalm und damit das zweite Psalmbuch mit den Worten: «Die Gebete Davids, des Sohnes Isais, sind zu Ende.» Alle finden im Reich und in seinen Segnungen ihre Antwort.
Einleitung
Als viele Menschen weder lesen noch schreiben konnten, war das Erlernen und die Kenntnis weiser Sprüche eine besondere Form der Unterweisung. Gott hat dem Rechnung getragen und in sein ewiges Wort auch eine solche Sammlung aufgenommen: das Buch der Sprüche.
Salomo, der Sohn Davids, von dem es heisst, dass er weiser war als alle Menschen, ist der von Gott inspirierte Verfasser dieses Bibelbuchs (Sprüche 1,1).
Das Buch der Sprüche zeigt, was der gottesfürchtige Mensch in dieser Welt suchen und was er meiden soll. Es lehrt, dass jeder Mensch – auch der gläubige – unter der Regierung Gottes das erntet, was er gesät hat. Es enthält die Ratschläge göttlicher Weisheit für das tägliche Leben eines gottesfürchtigen Menschen in allen Schwierigkeiten, Prüfungen, Gefahren und Freuden seines Erdenweges.
Dieses von Salomo, dem König des Friedens, geschriebene Buch weist auch gewisse Parallelen zu den Grundsätzen des Reiches Gottes auf, wie sie der Herr Jesus in Matthäus 5 – 7 (Bergpredigt) dargelegt hat.
Die in den Sprüchen häufig erwähnte göttliche Weisheit, die in den Kapiteln 8 und 9 sogar als Person spricht, findet im Neuen Testament ihren vollkommenen Ausdruck in Christus, dem Sohn Gottes (1. Korinther 1,30).
Die Furcht des Herrn ist das Schlüsselwort dieses Buchs. Sie ist der Anfang der Erkenntnis und Weisheit und vieles mehr. Achte beim Lesen besonders auf die Verse, in denen die Furcht des Herrn erwähnt wird.
Zweck des Buches
Gott hatte Salomo, den König von Israel, mit besonderer Weisheit ausgestattet (1. Könige 3,12; 5,9-14). Als inspirierter Schreiber erteilt er im Buch der Sprüche Ratschläge göttlicher Weisheit für ein Leben in Gottesfurcht. Gott hat uns dieses Buch als Teil seines ewigen Wortes geschenkt, damit wir in der Welt, die von Ihm und seinen Grundsätzen nichts wissen will, den rechten Weg gehen können. Es zeigt, wonach wir als Gläubige streben und was wir meiden sollen. Wir lernen auch, dass jeder Mensch erntet, was er gesät hat. Das gilt auch für den Gottesfürchtigen.
Nach den einleitenden Worten stellt Salomo das Schlüsselwort dieses Buches vor: die Furcht des Herrn. Sie wird in verschiedenen Zusammenhängen erwähnt. In Vers 7 wird sie als Anfang der Erkenntnis vorgestellt (vergleiche auch Sprüche 9,10; 15,33). Doch im gleichen Vers wird auch gesagt, dass längst nicht jeder bereit ist, auf die Ratschläge der göttlichen Weisheit zu hören. Als Narr wird der unvernünftige, eigenwillige Mensch bezeichnet, der diese Weisheit und Unterweisung verachtet.
Mit der Anrede «mein Sohn», der wir im ersten Teil der Sprüche immer wieder begegnen, werden Gläubige angesprochen. Weil sie neues Leben besitzen, können sie die Ratschläge der Weisheit befolgen. Als Erstes wird ein solcher die Autorität seiner Eltern respektieren und sich ihr unterstellen (Epheser 6,1-3). Damit anerkennt er die Ordnung, die Gott für die Beziehung in der Familie gegeben hat.
Warnung vor Sündern
Die Welt, in der wir uns als Gläubige bewegen müssen, ist voller Gefahren für uns. Im vorliegenden Abschnitt geht es um die Versuchung durch ungläubige Mitmenschen, die uns zum Mitmachen verleiten wollen. Sie schmieden Pläne, um sich unrechtmässig zu bereichern, und wir sollen uns an ihren Machenschaften beteiligen. Auch in unserem Herzen sitzt die Wurzel der Habsucht. Darum dürfen wir die uns drohende Gefahr nicht unterschätzen. Lasst uns die Empfehlung des Wortes beherzigen und praktizieren!
Durch Salomo sagt Gott: «Wenn Sünder dich locken, so willige nicht ein … Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg.» Und der Herr Jesus sagte zu seinen Jüngern – und damit auch zu uns: «Gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht» (Lukas 12,15).
Wenn Paulus an Timotheus von der Geldliebe als einer Wurzel alles Bösen schreibt, fügt er hinzu: «Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge!» (1. Timotheus 6,10.11).
Wohin führt die Habsucht? Vers 19 sagt: «Sie nimmt ihrem eigenen Herrn das Leben.» Der Apostel Paulus warnt: «Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang» (1. Timotheus 6,9).
Wir wollen diese praktischen Ratschläge der Weisheit zu Herzen nehmen und uns vor aller Habsucht hüten.
Die Botschaft der Weisheit
Wir haben gesehen, dass durch die Anrede «mein Sohn» erlöste Menschen angesprochen werden, die in Gottesfurcht ihren Weg gehen möchten. In Vers 22 spricht die göttliche Weisheit die Einfältigen, die Spötter und Toren an. Wen meint sie damit?
Die Einfältigen sind die Unerfahrenen. Ihnen fehlt das Unterscheidungsvermögen. Sie sind offen für alles und daher auf Verführung besonders anfällig. Auch Gläubige können zu den Einfältigen zählen.
Der Spötter verhöhnt Gott und sein Wort. Für die Anweisungen der Bibel hat er nur ein Lächeln übrig. Sie sind für ihn wertlos, und er meint, sie gingen ihn nichts an.
Der Tor ist unwissend über Gott und seine Gedanken. Er will auch nichts mit Ihm zu tun haben: Er ist ein gottloser Mensch (Psalm 14,1).
Die Weisheit gibt sich alle Mühe, auch diese Personen zu erreichen, um ihnen zu raten und zu helfen. Doch sie verschweigt die Folgen nicht, die jene treffen, die sich weigern, auf ihren Rat zu hören. Wir wollen bei diesen Worten der Weisheit daran denken, dass unser Herr Jesus Christus die personifizierte Weisheit ist (1. Korinther 1,24.30). Im Licht des Neuen Testaments betrachtet, ist Er es, der all jene warnt, die nicht auf Ihn hören wollen. Aber welch eine Ruhe und Sicherheit verspricht Er denen, die auf Ihn hören und Ihm gehorchen! Ähnliches sagt Er in Johannes 5,24. Wer auf Ihn vertraut, braucht sich nicht zu fürchten.
Der Weg der Weisheit
In diesem Kapitel wird uns gezeigt, wie wir in der uns umgebenden gefahrvollen Welt bewahrt bleiben können. Es ist nötig, dass wir uns unter die Autorität des Wortes Gottes beugen, indem wir es annehmen und ihm gehorchen. Die Verse 2-4 reden von der geistlichen Energie, mit der wir die Bibel lesen sollen, um Gottes Willen immer besser kennen zu lernen. Der Herr wird sich zu einem solchen Einsatz bekennen und das Verständnis öffnen.
Und was wird die Folge sein? «Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden.» Ein vertieftes Verständnis von dem, was in den Augen des Herrn recht und gut ist, wird uns bewahren. Es wird uns sowohl von dem Mann, der Verkehrtes redet, als auch von der fremden Frau, die ihre Worte glättet, erretten. Unter diesem Mann und dieser Frau können wir physische Personen sehen, die eine Gefahr für uns bilden. Heute wird in der Welt viel Verkehrtes propagiert und praktiziert, ohne dass man es böse oder anstössig findet. Das beeinflusst auch uns Gläubige.
Die Verse 21 und 22 zeigen zwei ganz unterschiedliche Ziele auf: Die Aufrichtigen werden das Land bewohnen, die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet werden. In der Sprache des Neuen Testaments heisst das: Die Glaubenden werden in Ewigkeit eine ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus geniessen, während die Ungläubigen in der ewigen Gottesferne enden werden.
Vom Segen der Weisheit
In Vers 3 werden Güte und Wahrheit miteinander verbunden. Das erinnert uns an Johannes 1,17, wo es heisst: «Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.» In seinem Leben gab es stets eine vollkommene Ausgewogenheit zwischen Gnade (Güte) und Wahrheit. Wie leicht überwiegt bei uns die Güte auf Kosten der Wahrheit, oder wir vergessen beim entschiedenen Festhalten der Wahrheit die Gnade!
Den Vers 5 wollen wir uns für alle Zeiten merken, und auch dann auf den Herrn vertrauen, wenn wir Mühe haben, unsere Lebenssituationen als seine Wege zu erkennen. Er wird unser Vertrauen bestimmt nicht enttäuschen (Vers 6b).
2. Korinther 9,6-11 zeigt, dass der Grundsatz der Verse 9 und 10 auch in der Zeit des Neuen Testaments gültig ist. «Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten.» In Hebräer 13,15.16 finden wir, dass unser materielles Opfer ebenso zum Wohlgefallen Gottes ist wie unser Lobopfer.
Die Verse 11 und 12 unseres Abschnitts werden in Hebräer 12,5.6 zitiert. Dort spricht der Schreiber von der Erziehung Gottes. Wir alle, die wir durch den Glauben an den Herrn Jesus zur Familie Gottes gehören und Kinder des himmlischen Vaters sind, haben Erziehung nötig. Oft schätzen wir das nicht. Aber lasst uns daran denken: Alles, was der Vater uns auferlegt, kommt aus seinem liebenden Herzen. Seine Züchtigung hat immer den Zweck, uns Ihm ähnlicher zu machen und unsere Gemeinschaft mit Ihm zu vertiefen.
Weisheit finden
In den Versen 13-18 werden Vorzüge der göttlichen Weisheit gerühmt. Wer sie gefunden hat und wer sie festhält, wird glückselig gepriesen (Verse 13 und 18). Wir können diese Verse am besten verstehen, wenn wir anstelle der Weisheit den Namen des Herrn Jesus einsetzen. Er personifiziert sie ja! Es gibt auf der Erde tatsächlich nichts Besseres, als dass ein Mensch den Herrn Jesus als seinen persönlichen Retter findet, durch den Glauben an Ihn neues Leben empfängt und ein Kind Gottes wird (Johannes 1,11-13). Wer als ein Erlöster Ihm nachfolgt, befindet sich auf einem «lieblichen Weg» und einem «Pfad des Friedens» (Vers 17).
Die Verse 19 und 20 erinnern an Gottes Weisheit in der Schöpfung. Wie wunderbar hat Er alles gemacht! Alles Geschaffene zeugt von seiner Herrlichkeit (Psalm 19,2).
Damit die göttliche Weisheit unser praktisches Leben als Gläubige zum Guten beeinflussen kann, müssen wir uns an die Anweisungen des Wortes Gottes halten (Psalm 119,105). Im Weiteren hat uns Christus in seinem Leben hier ein Beispiel hinterlassen (1. Petrus 2,21). Wenn wir im Vertrauen zu Gott und im Gehorsam zu seinem Wort den Fussstapfen unseres Herrn folgen, sind wir in Sicherheit. Wir brauchen uns vor nichts in dieser Welt zu fürchten. Wir befinden uns ja in den Händen unseres guten Hirten. Nichts und niemand kann uns aus diesem sicheren Platz vertreiben (Johannes 10,28).
Gerecht leben
Die praktischen Ermahnungen in den Versen 27 und 28 werden im Neuen Testament bestätigt. Jakobus schreibt, dass wir unseren Glauben vor den Menschen dadurch beweisen können, dass wir unserem bedürftigen Nächsten Gutes tun (Jakobus 2,15-17). Der Apostel Johannes fragt sich, wie die Liebe Gottes in einem Gläubigen bleiben kann, wenn er sein Herz (und seine Hand) gegenüber dem Bruder verschliesst, der Mangel leidet (1. Johannes 3,17).
Was wir in Vers 29 haben, ist ein grober Missbrauch des Vertrauens, das jemand zu uns hat. Die Ermahnungen der Verse 30 und 31 erinnern daran, dass die Wurzel zu Streit, Missgunst und Neid auch in der alten Natur jedes Gläubigen noch vorhanden ist. Wenn wir nicht wachsam sind, treiben diese Wurzeln ihre Schosse. Darum sagt Kolosser 3,5.8: «Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind … Jetzt aber legt auch ihr das alles ab.»
Die Verse 32-35 zeigen uns göttliche Gegensätze auf, damit es uns leichter fällt, das Gute zu wählen. Was der Herr verabscheut und verurteilt, sollten auch wir meiden. Der Vers 34 wird im Neuen Testament wie folgt wiedergegeben: «Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade» (Jakobus 4,6; 1. Petrus 5,5). Denken wir an unseren Herrn, der von sich sagen konnte: «Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig» (Matthäus 11,29) und treten wir in seine Fussstapfen!
Weisheit annehmen
Salomo unterweist nicht nur als Vater seine Söhne. Er stellt sich selbst als ein Sohn vor, der von seinem Vater Belehrung empfangen hat. Das, was er von ihm gelernt hat, gibt er nun seinem Sohn weiter. Wie schön, wenn dies auch heute noch vorkommt! Was für ein grosses Vorrecht hat ein gläubiger Mensch, wenn seine Eltern und Grosseltern gottesfürchtig und gläubig sind. Mögen wir, wenn der Herr uns dies gewährt hat, ein solches Geschenk schätzen und von Herzen dafür dankbar sein!
Im Neuen Testament lesen wir von Timotheus, der zwar einen griechischen Vater, aber sowohl eine gläubige Mutter als auch eine gläubige Grossmutter hatte. Dadurch lernte er die heiligen Schriften von Kind auf kennen (2. Timotheus 1,5; 3,15).
In den Versen 10-13 betont Salomo den Weg der Weisheit. Sein Sohn sollte die Weisheit nicht nur verstandesmässig erfassen, sondern sie in seinem täglichen Leben praktisch verwirklichen. Es genügt nicht, das Wort Gottes zu kennen – obwohl dies die Voraussetzung für ein gottesfürchtiges Leben ist –, man muss das aus der Bibel Gelernte auch ausleben. Diese Reihenfolge finden wir z.B. im 2. Timotheus-Brief, wo der Apostel zuerst von seiner Lehre, dann aber auch von seinem Betragen schreibt (2. Timotheus 3,10).
Vers 13 erinnert an 2. Timotheus 1,13.14, wo der Apostel seinen jüngeren Mitarbeiter Timotheus ermahnt: «Halte fest das Bild gesunder Worte … bewahre das schöne anvertraute Gut.»
Weisheit umsetzen
Das Festhalten und Verwirklichen der Anweisungen des Wortes Gottes ist eine Sache. Eine zweite ebenso wichtige Sache ist die klare Trennung von denen, die diesen Weg nicht gehen wollen. Die Gefahr ist gross, dass wir mit Menschen Kompromisse schliessen, die nicht bereit sind, sich in allem unter die Autorität des Wortes Gottes zu stellen und es zu befolgen. Doch ein solcher Weg führt in die Irre, ins Dunkel. Wie viel herrlicher ist der Weg einer entschiedenen Nachfolge des Herrn Jesus, indem man in seine Fussstapfen tritt! «Der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe.»
In den Versen 20-27 werden verschiedene Körperteile erwähnt, auf die wir Acht haben und die wir bewahren müssen:
- Die Ohren sollen offen sein, um das verkündete Wort Gottes aufzunehmen.
- Das Herz ist der Sitz unserer Persönlichkeit. Dort treffen wir unsere Entscheidungen.
- Der Mund und die Lippen sind schnell dabei, Verkehrtes zu sagen. Darum betete David: «Setze, Herr, meinem Mund eine Wache, behüte die Tür meiner Lippen» (Psalm 141,3).
- Die Augen schweifen gern umher, und sehen dann manches Ungute, das aber anziehend ist. Hiob machte einen Bund mit seinen Augen, um nicht zu sündigen (Hiob 31,1).
- Die Füsse sind in Gefahr, vom Weg Gottes abzubiegen. Auch sie müssen behütet werden.
Leben in Reinheit
In diesen Versen werden wir zunächst vor einer Verbindung mit dem anderen Geschlecht ausserhalb der von Gott gegebenen Verbindung – der Ehe – gewarnt. Wir wollen diese Verse als Warnung vor jeder Verführung des Fleisches zu Herzen nehmen. Gott möchte, dass wir als Gläubige ein reines Leben führen.
Wie können wir uns vor dieser Gefahr schützen? Unsere Bewahrung liegt in der konsequenten Trennung von diesen Verführungen. Entsprechend der Warnung von Vers 8 sagt Römer 13,14: «Treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden.» 1. Korinther 6,18 wird noch eindringlicher: «Flieht die Hurerei!»
Wie manch einer, der nicht vorsichtig genug war und mit der Sünde gespielt hat, musste die bitteren Folgen seines Weges tragen, wie die Verse 9-11 es schildern. Es ist sehr gefährlich, diese Warnungen in den Wind zu schlagen. Mit Selbstvorwürfen (Sprüche 5,12-13) kann man keine Sünde ungeschehen machen.
Glücklicherweise gibt es aber immer einen Weg zurück. Er führt über echte Buße und ein aufrichtiges Bekenntnis der vorgefallenen Sünden vor Gott. Dann ist Er treu und gerecht, dass Er uns vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt (1. Johannes 1,9).
Das durfte auch König David nach seinem tiefen Fall (Hurerei mit Bathseba und Ermordung Urijas, des Ehemanns von Bathseba) erfahren. Gott vergab ihm alles, doch die Folgen seines Fehltritts blieben (2. Samuel 12,13.14).
Leben in ehelicher Treue
Als Gott den Menschen als Mann und Frau schuf und sie in der Ehe miteinander verband, da hatte Er das Wohl und Glück für beide im Auge. Wir wissen, dass durch den Sündenfall auch die Ehe in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und doch bleibt die eheliche Liebe, die zwei Menschen – ein Mann und eine Frau – in der Ehe miteinander geniessen dürfen, ein Geschenk unseres Schöpfers. Doch sie muss ständig gepflegt werden. Der Herr Jesus will jedem gläubigen Ehemann und jeder gläubigen Ehefrau täglich helfen, dies zu verwirklichen. Die Verse 15-20 sind Ansporn dazu. Gleichzeitig wird der Sohn davor gewarnt, sich mit einer fremden Frau einzulassen. Wir werden nur bewahrt, wenn wir auch als Verheiratete dem anderen Geschlecht gegenüber den nötigen Abstand einhalten.
Die Augen des Herrn sehen unser ganzes Leben, und Er beurteilt es. In Hebräer 13,4 heisst es: «Die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt; denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten.» Er sieht auch die Sünden, die im Verborgenen verübt werden. Oft richtet Gott die Sünden der Menschen nicht sofort. Doch dadurch verschwinden sie nicht einfach. Spätestens beim Endgericht vor dem grossen weissen Thron wird der Ungläubige realisieren, dass seine eigenen Ungerechtigkeiten ihn fangen (Vers 22; Offenbarung 20,11-15). Er wird verloren gehen, weil er nicht auf Gott und sein Wort gehört und nicht an den Herrn Jesus als seinen Erlöser geglaubt hat.
Warnung vor Bürgschaft und Faulheit
In diesem Buch werden wir mehrfach davor gewarnt, Bürge zu werden. Warum sollen wir das nicht tun? Wer Bürgschaft leistet, verspricht etwas im Blick auf die Zukunft, die er weder kennt noch in der Hand hat. Wir sind nicht Gott, der etwas versprechen kann und es auch einlösen wird. Die göttliche Weisheit sagt uns daher: Werde niemals Bürge für einen anderen. Falls du diese Torheit bereits begangen hast, setze alles daran, dich davon zu befreien.
Die zweite Warnung der Weisheit in diesen Versen richtet sich an den Faulen. Ehrlicherweise müssen wir zugeben, dass in uns allen der Wunsch vorhanden ist, mit möglichst geringem Aufwand möglichst viel zu verdienen. Die Bibel aber fordert uns Gläubige zum Fleiss bei der Arbeit auf. Unabhängig davon, wie die Menschen unsere Arbeit honorieren, wollen wir uns 100-prozentig einsetzen und dabei Kolosser 3,23.24 verwirklichen: «Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet; ihr dient dem Herrn Christus.» Welch ein Adel verleiht es unserer Berufsarbeit, wenn wir sie für unseren Erlöser tun! Zudem spornt uns dieser Gedanke zu grösstem Fleiss an.
Die Folgen der Faulheit bei der Arbeit werden nicht ausbleiben. Wie mancher hat seine Arbeitsstelle aus eigener Schuld verloren. Hätte er das Wort Gottes zu Herzen genommen und sich angestrengt, wäre er nicht in Armut geraten. Diese Worte sind heute so aktuell wie zur Zeit Salomos.
Warnung vor einem bösen Herzen
Der in den Versen 12-15 beschriebene Mensch wird als ein heilloser Mann bezeichnet. Gottes Wort spricht von einem Menschen als von einem hoffnungslosen Fall, wenn er nur Böses schmiedet und zu aller Zeit Zwietracht ausstreut. Wie kommt es so weit, dass Gott, dessen Gnade und Barmherzigkeit uns gegenüber unendlich gross sind, über einen solchen Menschen derart ernst urteilt?
Eine Antwort auf diese Frage findet sich nicht so leicht. Vielleicht liegt sie in der Tatsache, dass in diesem Abschnitt der Mund, die Augen, die Füsse, die Finger und das Herz erwähnt werden. Doch die Ohren fehlen. Wenn ein Mensch nicht mehr auf Gott und sein Wort hören will, wird er zu einem hoffnungslosen Fall.
Die Wurzel zu all dem, was der Herr hasst, findet sich auch in unserem Herzen, in unserer alten Natur. Deshalb wollen wir die ernsten Warnungen dieser Verse keineswegs übergehen. Wir sind in grösster Gefahr, wenn wir meinen, so etwas könne bei uns nicht vorkommen. Konkret werden wir vor Hochmut, Lüge, Gewalttätigkeit, bösen Absichten, bösen Taten, falschen Aussagen und vor dem Säen von Zwietracht gewarnt. An erster Stelle steht der Hochmut. Er zeigt sich in verschiedenen Formen. Der eine bildet sich etwas auf seinen Reichtum ein, ein anderer ist stolz auf seine Bildung. Gläubige können sogar auf die geistliche Gabe stolz werden, die der Herr ihnen geschenkt hat! In ihrem Hochmut stellen sie sich dann über die anderen Gläubigen. Wie traurig!
Warnung vor Ehebruch
Es ist ein grosses Vorrecht, gläubige Eltern zu haben, die ihre Kinder nicht nur erziehen, sondern ihnen auch biblische Unterweisung und Belehrung geben. Ihre Zurechtweisungen sind nicht nur nötig, sondern auch eine Hilfe, um auf dem rechten Weg zu bleiben (Vers 23).
Die Warnungen der gottesfürchtigen Eltern decken sich mit denen des Geistes Gottes in diesen Versen. Es geht um die Sünde des Ehebruchs und der sexuellen Verbindung mit einer fremden Frau.
Heute sind die Verführungen in dieser Hinsicht enorm. Lasst uns davor fliehen, wie man vor Feuer flieht! Wer Feuer in die Hand nimmt oder über glühende Kohlen geht, wird Brandwunden erleiden. Sich mit einer fremden Frau einzulassen, wird zu ähnlich schlimmen Folgen führen. Sowohl unser Zeugnis nach aussen (Kleider) als auch unser Lebenswandel (Füsse) werden massiv beeinträchtigt.
Ein Dieb kann das Gestohlene erstatten und damit den Schaden beheben. Wer aber mit einer verheirateten Frau Ehebruch begeht, «dessen Schande wird nicht ausgelöscht werden». Der Schaden ist irreparabel. Denken wir nur an die Eifersucht des Ehepartners! (Vers 34). Es gibt keine Sühne, keine Genugtuung für den Ehebruch. Das stellen uns diese Verse mit aller Deutlichkeit vor. Denken wir ja nicht: Das kann einem Kind Gottes nicht passieren! Gottes Warnung richtet sich an uns alle, ob wir gläubige Männer oder gläubige Frauen sind.
Warnung vor Hurerei
Das ganze Kapitel ist eine einzige Warnung vor der fremden Frau. Diese ist keine Prostituierte, sondern eine verheiratete Frau, die während der Abwesenheit ihres Mannes mit einem anderen Mann Verkehr hat (Sprüche 7,19.20). Anhand einer eindrücklichen Beschreibung, wie ein unverständiger Jüngling den Verlockungen dieser Frau erliegt und zur Sünde verleitet wird, unterstreicht der Heilige Geist seine Warnung.
Warum blieb dieser Sohn ein einfältiger, dem die Erfahrung und das Unterscheidungsvermögen fehlten? Er beachtete die Empfehlungen der göttlichen Weisheit nicht und nahm sie nicht zu Herzen. Wie eindringlich bittet die Weisheit zu Beginn des Kapitels jeden aufrichtigen Bibelleser: «Bewahre meine Worte und birg bei dir meine Gebote … Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens.» Der inspirierte Dichter von Psalm 119,9 fragt: «Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln?» Die göttliche Antwort folgt unmittelbar darauf: «Indem er sich bewahrt nach deinem Wort».
Von der in diesem Kapitel beschriebenen Sünde bleiben wir als Glaubende nur dann bewahrt, wenn wir uns konsequent an das Wort Gottes halten. Wir wollen seine Hinweise und Warnungen beachten und die Gefahrenzonen möglichst meiden (Sprüche 7,8.9.25). Sollten wir einmal unvermittelt in grosse Gefahr kommen wie einst Joseph, dann lasst uns vor der Sünde fliehen (1. Mose 39,10-12; 1. Korinther 6,17). Bei allem wollen wir uns auf die bewahrende Gnade des Herrn stützen.
Der Charakter der Weisheit
Die göttliche Weisheit bleibt nicht untätig. Gott möchte, dass wir seine Gedanken kennen lernen. Darum ladet uns die Weisheit ein, auf sie zu hören. Auf uns übertragen können wir sagen, dass Gott die Bibel in viele Sprachen in der ganzen Welt verbreiten lässt. In unseren Ländern kann jeder Mensch für wenig Geld in den Besitz einer guten und genauen Bibel-Übersetzung kommen. Doch Gott möchte, dass die Menschen sein Wort auch lesen. Darum dieser Appell der Weisheit.
Die Weisheit Gottes wird auch in einer Person verkörpert: in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Er hat alle Gedanken Gottes in seinem Leben hier verwirklicht. Von Ihm darf jeder Gläubige lernen und Ihm in seinen Fussstapfen nachfolgen.
Drei Grundsätze kennzeichnen die Weisheit Gottes:
- Besonnenheit oder Einsicht. Dadurch sieht man die Umstände im richtigen Licht. Anstatt dem Eigenwillen zu folgen, erwägt man die Umstände vor Gott.
- Das Böse hassen. Diese Haltung ist ein Beweis der vorhandenen Gottesfurcht.
- Abscheu gegen den Stolz, den Hochmut und die Heuchelei im Menschen. Wie sehr hat unser Herr diese Grundsätze ausgelebt!
Vers 17 dürfen wir als ein Wort unseres Erlösers betrachten. Wenn wir Ihm unsere Liebe durch den Gehorsam zu seinem Wort zeigen (Johannes 14,21.23), gilt diese Ermunterung auch uns. Er enttäuscht keinen, der Ihn eifrig sucht.
Die Weisheit als Person
Wenn die Weisheit ab Vers 22 auf ihre ewige Existenz hinweist, dann werden unsere Blicke unwillkürlich auf Christus, den ewigen Sohn Gottes, gelenkt. Die ewige, nie endende Weisheit Gottes ist in Ihm offenbart und entfaltet worden. War Er nicht der Ausführende, als Gott die Schöpfung ins Dasein rief? Doch gleichzeitig war Er die Person des Wohlgefallens Gottes: der Sohn seiner Liebe.
Weiter heisst es von Ihm, dass seine Wonne bei den Menschenkindern war. Als diese herrliche Person Mensch wurde und als Sohn der Maria in Bethlehem geboren wurde, lobten die Engel Gott und sagten: «Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen!» (Lukas 2,14). Damals wurde Christus von seinen Geschöpfen verworfen und umgebracht. Eine Beziehung zu Ihm und zu Gott gibt es nur für Menschen, die an Ihn glauben. Ihnen erklärt Er: «Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott» (Johannes 20,17). Erst im ewigen Zustand wird Gott seine ungetrübte Wonne an den Menschen finden können (Offenbarung 21,1-4).
Heute gilt Vers 35 für jeden, der sich in Buße und Glauben zum Heiland wendet. Wer an den Herrn Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Er wird nicht verloren gehen. Er hat «Wohlgefallen erlangt von dem Herrn», d.h. der Glaubende wird ein von Gott geliebtes Kind. Er darf wissen, dass er eine ewige Heimat im Haus seines himmlischen Vaters hat (Johannes 14,2.3). Wer aber nicht an Ihn glauben will, wird ewig verloren gehen (Vers 36; Johannes 3,36).
Weisheit oder Torheit
Wir haben früher gesehen, dass in den Sprüchen mit den Einfältigen solche gemeint sind, die unerfahren sind und kein gutes Urteilsvermögen haben. Die Weisheit Gottes ladet solche ein, zu ihr zu kommen, um weise zu werden.
Im Neuen Testament finden wir, dass der Herr Jesus wünscht, dass die an Ihn Glaubenden geistlich wachsen. Wir, die auf Ihn vertraut haben, sollen vollkommen, d.h. geistlich erwachsen werden. Er möchte, dass Er uns alles bedeutet und dass der Wille Gottes zur Richtschnur unseres Lebens wird (Kolosser 4,12). Doch am Anfang jedes Wachstums in geistlicher Hinsicht steht die Gottesfurcht. Ohne sie kann es niemals einen gesunden Fortschritt in unserem Leben geben.
Der Schluss des Kapitels zeigt, dass es in dieser Welt neben der Einladung Gottes durch sein Wort noch eine andere Stimme gibt. Sie kommt von unten. Hinter den Worten von Frau Torheit müssen wir den Widersacher Gottes sehen. Im Gegensatz zu unserem Herrn sucht er nie das Gute des Menschen. Lasst uns daran denken und es nicht vergessen, wenn wir geneigt sind, auf die Stimmen zu hören, die in dieser Welt an unser Ohr dringen. Sie tönen vielleicht angenehm, versprechen manches Gute, aber sie führen von Gott weg. Darum: «Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist», und mag es noch so anziehend sein! Denn «die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit» (1. Johannes 2,15.17).
Buchtipp: Leben in Weisheit.
Das Buch der Sprüche Vers für Vers praxisnah erklärt.
Das Hauptthema des Kolosser-Briefs
Jesus Christus, unser Lebensinhalt
Jeder Mensch, der Buße tut und an das Erlösungswerk des Herrn Jesus glaubt, bekommt durch die Neugeburt ein neues Leben, das Christus selbst ist. Dadurch besitzt er einen neuen Lebensinhalt: Alles dreht sich um Jesus Christus, der für ihn gestorben ist und jetzt als seine Hoffnung im Himmel zur Rechten Gottes sitzt. Diese Tatsache spricht Paulus im Kolosser-Brief an, wenn er sagt: «Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit» (Kolosser 1,27).
Doch solange wir noch auf der Erde leben, versucht der Feind unser Herz von Christus abzuziehen und mit dem zu füllen, was die Welt bietet. Vor dieser Gefahr warnt uns der Apostel auch in diesem Brief: «Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt, und nicht nach Christus» (Kolosser 2,8).
Aber bevor Paulus diese Warnung ausspricht, entfaltet er in Kapitel 1 die ganze Herrlichkeit von Jesus Christus. Er stellt den Sohn Gottes in seiner Grösse vor, um unsere Herzen neu für Ihn zu erwärmen. Denn der Apostel weiss: Neben der Würde und Bedeutsamkeit des Herrn Jesus verblasst jede Philosophie der Welt und jede menschliche Weltanschauung.
Deshalb wollen wir uns beim Lesen dieses Briefs die Aufforderung aus Kolosser 3,16 zu Herzen nehmen: «Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen.»
Was das Evangelium bewirkt
In den Versen 1 und 2 werden die Absender und Empfänger des Briefs erwähnt. Paulus nennt sich Apostel und deutet damit die Autorität an, die er von Gott für seinen Dienst bekommen hat. Gleichzeitig verbindet er sich mit Timotheus, der jahrelang mit ihm an dem Evangelium gedient hat (Philipper 2,22).
Den Glaubenden in Kolossä wünscht er Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Mit diesem Gruss erinnert er uns an unsere christlichen Beziehungen: Wir sind Kinder des himmlischen Vaters und Schafe des guten Hirten.
In Vers 3 beginnt der Apostel mit einem Dankgebet für die gläubigen Kolosser. Er kannte sie nicht persönlich, hatte aber von ihrem Glauben an Christus Jesus und von ihrer Liebe zu den Erlösten gehört. Diese beiden Früchte des neuen Lebens wurden in ihrem Verhalten sichtbar: Sie pflegten eine Glaubensbeziehung zum Herrn und übten praktische Bruderliebe aus. Die Kraftquelle für dieses gesunde Christenleben war ihre Hoffnung auf die zukünftige, uneingeschränkte Gemeinschaft mit Christus und den Seinen im Himmel.
Vers 6 zeigt uns die Wirkungen des Evangeliums: Einerseits bringt es in der ganzen Welt für Gott Frucht, indem es Menschen rettet und ihnen neues Leben gibt. Anderseits stellt es die Glaubenden auf den Boden der Gnade. Weil sie die Errettung geschenkt bekommen haben, führen sie nun aus Dankbarkeit ein Leben zur Ehre Gottes. Aus Vers 7 entnehmen wir, dass die Kolosser durch den Dienst von Epaphras zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren.
Geistliches Wachstum
Die Verse 9-11 zeigen uns, wie wir als Glaubende zur Ehre Gottes leben können. Die erste Voraussetzung dafür ist, dass wir seinen Willen kennen. In der Bibel hat Er uns seine Gedanken für unser Leben mitgeteilt. Wenn wir sie lesen, brauchen wir einerseits Weisheit, um die Gedanken Gottes ins Herz aufzunehmen, und anderseits Einsicht, um die Grundsätze des Wortes richtig in unsere aktuelle Lebenssituation zu übertragen. Beides dürfen wir von Gott erbitten.
Die zweite Voraussetzung für ein Verhalten, das dem Herrn gefällt, finden wir in Vers 11: Wir brauchen geistliche Kraft, um den Willen Gottes in unserem Leben zu tun. Wir bekommen sie jeden Tag von Christus, der im Himmel verherrlicht ist.
Die Verse 12-14 beschreiben die christliche Stellung, die uns grundsätzlich fähig macht, nach dem Willen Gottes und zur Freude des Herrn zu leben:
- Wir besitzen ein Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Das bedeutet, dass wir ein Recht haben, als geliebte Kinder vor unserem Gott und Vater zu stehen. Obwohl wir uns in seiner heiligen Gegenwart befinden, fürchten wir uns nicht, weil Er uns in Christus angenommen hat.
- Wir sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Das bedeutet, dass wir auch im Reich Gottes einen Platz haben. Dort anerkennen wir die Autorität des Herrn Jesus, der als Sohn vom Vater geliebt ist.
Damit wir in diese herrliche Stellung kommen konnten, war ein Werk Gottes nötig: Er hat uns aus der Macht Satans errettet und uns unsere Sünden vergeben.
Christus – eine herrliche Person
In diesen Versen werden uns vielfältige Herrlichkeiten von Jesus Christus vorgestellt, um uns innerlich ganz auf Ihn auszurichten:
- Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, denn als Sohn hat Er uns Menschen gezeigt, wer Gott ist.
- Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Als der Sohn Gottes Mensch wurde, lag Er als Kind armer Eltern in einer Krippe. Trotzdem war Er in der Schöpfung der Ranghöchste.
- Durch Jesus Christus sind alle Dinge geschaffen worden, denn Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde.
- Er ist vor allen Dingen. Das weist auf seine ewige Existenz hin (Johannes 1,1-3). Bevor es die Schöpfung gab, war Er da.
- Alle Dinge bestehen durch Ihn. Er erhält das Universum, damit kein Chaos entsteht, sondern alles nach den festgelegten Gesetzmässigkeiten abläuft.
- Christus ist das Haupt des Leibes, der Versammlung. Als Mensch im Himmel steht Er als Haupt in einer lebendigen Beziehung zur Versammlung, die hier auf der Erde gebildet wird.
- Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Jetzt weist Paulus auf die neue Schöpfung hin, in der Christus durch seine Auferstehung den Anfang bildet und der Vornehmste von allen ist, die durch den Glauben zu diesem neuen Bereich gehören.
Bei Gott hat Jesus Christus in allem den Vorrang. Welchen Platz geben wir Ihm? Möge die Herrlichkeit seiner Person unser Herz erfüllen und unserem Leben die richtige Ausrichtung geben.
Eine zweifache Versöhnung
Als der Herr Jesus als Mensch auf der Erde lebte, war es das Wohlgefallen der ganzen Fülle der Gottheit in Ihm zu wohnen. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, und Gott, der Heilige Geist, fanden in Jesus Christus einen Wohnort. So konnte das Wesen Gottes – sein Licht und seine Liebe – in Ihm völlig zum Ausdruck kommen.
Die Verse 20-22 zeigen uns die beiden Seiten der Versöhnung, die Jesus Christus durch seinen Kreuzestod bewirkt hat:
- Die Versöhnung der Dinge in Vers 20 ist noch zukünftig und betrifft weder Engel noch Menschen, sondern die unintelligente Schöpfung. Als die Sünde in die Welt kam, entstand in der Schöpfung eine Entfremdung von Gott. Aber der Herr Jesus hat am Kreuz durch sein Blut Frieden gemacht. So werden auf der Grundlage seines Erlösungswerks die Dinge im Himmel und auf der Erde wieder in Übereinstimmung mit Gott gebracht werden.
- Die Versöhnung der Glaubenden in Vers 22 ist eine gegenwärtige Tatsache. Einst lebten wir auf Distanz zu Gott. Wir waren seine Feinde und wollten nichts mit Ihm zu tun haben. Aber als wir unsere Rebellion eingesehen und unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, hat Er uns mit Gott versöhnt. Der Heiland musste am Kreuz sterben, damit wir jetzt heilig, untadelig und unsträflich vor Gott stehen können.
Das Evangelium macht klar: Unsere jetzige Stellung und unsere zukünftige Hoffnung haben wir einzig und allein unserem Erlöser zu verdanken. Diese Tatsache wollen wir im Glauben festhalten.
Das Geheimnis ist offenbart
In den Versen 23-25 werden die beiden Dienste des Apostels vorgestellt:
- Er war ein Diener des Evangeliums, indem Er den Menschen z.B. verkündete, wie sie Vergebung der Sünden und Befreiung von der Macht der Sünde empfangen konnten.
- Als Diener der Versammlung erklärte er den Glaubenden ihre neue Stellung in Christus. Sie sind z.B. Kinder Gottes, Erben Gottes und gehören gemeinsam zur Versammlung des Herrn Jesus.
Seine Aufgabe im Blick auf die Versammlung brachte Paulus von Seiten der Juden viele Leiden ein. Denn er machte klar, dass es in der Versammlung Gottes keine nationalen Unterschiede gibt. Alle Erlösten besitzen die gleichen Vorrechte als Glieder am Leib des Christus.
Diese Wahrheit war im Alten Testament nicht bekannt. Jetzt aber hat Gott dieses Geheimnis offenbart und durch den Apostel Paulus niederschreiben lassen, damit das Wort Gottes thematisch vollendet werde. Johannes hat zwar nach Paulus noch manches Bibelbuch verfasst, aber er hat darin keine grundsätzlich neuen Wahrheiten mitgeteilt.
Dieser Reichtum, den der Apostel Paulus offenbart hat, hat einen grossen Mittelpunkt: Christus (Vers 27). Seine Person macht jetzt und ewig unser ganzes Glück aus. Darum war Christus auch das grosse Themader Verkündigung von Paulus (Vers 28). Denn er verfolgte in seinem Dienst ein grosses Ziel: Er wollte alle Glaubenden vollkommen in Christus darstellen, damit sie sich nur an Ihm freuen.
Das Geheimnis verstehen
Vers 1 knüpft an die letzten Gedanken von Kapitel 1 an und zeigt uns, was für einen grossen Kampf der Apostel für die Gläubigen in Kolossä und Laodizea hatte. Er setzte sich voll für sie ein, indem er für sie betete und sie über die christliche Wahrheit belehrte. Vers 2 stellt uns drei Wirkungen einer guten, biblischen Unterweisung vor:
- Wenn das Wort Gottes vorgestellt und erklärt wird, kommen unsere Herzen zur Ruhe. Sie werden getröstet, weil wir uns auf ein stabiles Glaubensfundament stützen können.
- Die christliche Lehre verbindet uns als Erlöste in Liebe miteinander, weil uns bewusst wird, was für ein herrliches Glaubensgut wir gemeinsam besitzen.
- Durch gute Belehrung werden wir zur vollen Gewissheit des Verständnisses und zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes geführt. Wir erfassen die christliche Wahrheit in unseren Herzen und bekommen eine innere Überzeugung dafür.
Das Geheimnis Gottes enthält viele reiche Schätze. Wenn wir uns anhand des Wortes Gottes mit Jesus Christus und der Versammlung beschäftigen, entdecken wir diese Schätze und werden glücklich. Als Folge davon verliert die Verführung, die durch überredende Worte an unsere Ohren dringt, ihre Anziehungskraft. Dieses grosse Bewahrungsmittel stellt der Apostel vor, ehe er konkret auf die Gefahren eingeht (Vers 8).
Der äussere Zustand der Kolosser war gut. Sie standen fest im Glauben und es herrschte Ordnung in der Versammlung.
In Christus vollendet sein
Bei unserer Bekehrung haben wir Jesus Christus als unseren Erlöser angenommen. Nun soll unser ganzes Glaubensleben in Ihm verankert sein. Wie ist das möglich? Durch ein Leben der Gemeinschaft mit Ihm, in dem wir alle Einflüsse ablehnen, die uns als Christen schaden. In Vers 8 werden wir vor zwei solchen Gefahren gewarnt:
- Die «Philosophie» versucht menschliche Antworten auf die elementaren Fragen des Lebens zu geben. Sie steht jedoch oft im Widerspruch zu dem, was Gott sagt, der immer die Wahrheit spricht. Darum müssen wir alle menschlichen philosophischen Gedanken bewusst ablehnen.
- Mit den «Überlieferungen der Menschen» sind die religiösen Traditionen gemeint. Sie sprechen die menschlichen Gefühle an, können aber die echten Bedürfnisse nicht befriedigen.
Beide Punkte sind Elemente der Welt und ziehen uns von Christus weg. Aber es gibt für uns Christen nichts Grösseres und Besseres als unseren Herrn. In Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, und wir sind in Ihm vollendet, d.h. wir besitzen in Christus eine herrliche und sichere Stellung vor Gott.
Die Verse 11-15 beschreiben die Auswirkungen des Erlösungswerks des Herrn Jesus für uns Glaubende. Die «Beschneidung des Christus» spricht vom Tod unseres Erlösers. Sein Tod wurde uns bei der Bekehrung angerechnet, so dass wir mit Ihm der Sünde, der Welt und den Forderungen des Gesetzes gestorben sind. Aber wir sind auch mit Ihm auferweckt und dadurch in die christliche Stellung eingesetzt worden.
Warnung vor dem Gesetz und der Welt
In Vers 16 spricht Paulus nochmals die Gefahr der jüdischen Überlieferungen an. Sie gründeten sich auf die Anordnungen des Gesetzes, gingen aber über jene Anweisungen hinaus. Sie fanden deshalb nicht die Zustimmung Gottes.
Vers 17 macht zudem deutlich, dass alle Verordnungen im Alten Testament auf den Herrn Jesus hinweisen. Sie waren ein Schatten, die Wirklichkeit ist Christus. So ziehen wir heute einen grossen Nutzen aus dem Alten Testament, wenn wir in den göttlichen Vorschriften an Israel Bilder von unserem Erlöser entdecken.
In Vers 18 stellt der Apostel die menschlichen Vorstellungen und Praktiken bloss. Was so beeindruckend erscheinen mag, sind in Wirklichkeit eigenwillige und hochmütige Überlegungen von Menschen, die sich nicht unter Gottes Autorität beugen wollen.
In starkem Kontrast dazu stehen die Gedanken Gottes über Christus und seine Versammlung (Vers 19). Der Herr Jesus ist das Haupt, die Erlösten bilden den Leib. Jeder hat eine Funktion, die er zum Wohl und Wachstum des ganzen Leibes ausüben soll.
Weil wir mit Christus der Welt gestorben sind, ist es uns als Glaubende möglich, nicht auf ihre Einflüsse zu reagieren (Vers 20). So brauchen wir uns nicht an Essens-Vorschriften zu halten, die über die biblischen Anweisungen hinausgehen (Apostelgeschichte 15,20). Wenn Paulus hier die Gefahr der Askese anspricht, macht er deutlich, welches Ziel dabei verfolgt wird: Man will dabei selbst gross herauskommen!
Sucht was droben ist!
Durch die Tatsache, dass wir mit Christus gestorben sind (Kolosser 2,20), haben wir unsere Beziehung zur alten Welt abgebrochen. In Vers 1 lernen wir nun die Auswirkung davon kennen, dass wir mit Christus auferweckt worden sind: Wir stehen in Beziehung zur neuen, himmlischen Welt, in der unser Herr der Mittelpunkt ist. Allerdings leben wir noch auf der Erde. Doch wir blicken im Glauben zum Himmel hinauf und stehen so mit dem verherrlichten Christus in Verbindung. Nun werden wir zu zweierlei aufgefordert:
- «Sucht, was droben ist, wo der Christus ist.» Wir sollen uns für die himmlischen Gedanken des Herrn Jesus über unser Christenleben auf der Erde interessieren. Er will uns die Sichtweise der neuen Welt für unsere Lebenspraxis zeigen, damit wir hier als himmlische Menschen leben.
- «Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist.» Je mehr wir uns mit den himmlischen Gedanken über unser Leben beschäftigen, desto weniger werden uns die menschlichen Ideen und Philosophien, die ihren Ursprung auf der Erde haben, beeinflussen können.
Die Verse 3 und 4 zeigen uns unsere innige Beziehung zu Jesus Christus. Jetzt besitzen wir das gleiche Leben wie Er, der im Himmel bei Gott ist. So sind wir im Glauben – wenn auch unsichtbar – mit Ihm verbunden. In der Zukunft werden wir mit Ihm öffentlich erscheinen. Dann wird jeder erkennen, dass wir Ihm gehören.
Das spornt uns an, hier als himmlische Menschen nach dem Willen unseres himmlischen Herrn zu leben.
Verurteilt die Sünde!
Als Erlöste haben wir die Erbsünde noch in uns, die uns zu sündigen Gedanken, Worten und Taten verleiten will. Wenn wir nicht wachsam sind, kommen wir zu Fall. Darum werden wir in unserem Abschnitt aufgefordert, die Auswüchse der alten Natur zu verurteilen. «Töten» beginnt damit, dass wir das Böse in unserem Leben so wie Gott verurteilen. Es beinhaltet auch das vorbeugende Bewusstsein: Ich habe die Sünde noch in mir und bin zu jedem Fehltritt fähig. «Töten» bedeutet aber auch, die begangene Sünde Gott zu bekennen und die Ursache dafür zu erkennen und zu verurteilen. Wie ernst Gott es mit diesem Selbstgericht meint, machen die Verse 6 und 7 klar. Menschen, die keine Beziehung zu Ihm haben und die Sünde verharmlosen, anstatt sie zu verurteilen, kommen ins Gericht.
In Vers 8 werden wir aufgefordert, alle Sünden, die wir mit dem Mund begehen, abzulegen. Einst lebten wir in der Sünde, aber jetzt sollen uns die alten, sündigen Gewohnheiten nicht mehr prägen.
Der Grund dafür wird uns in den Versen 9 und 10 angegeben. Bei unserer Bekehrung hat eine grundlegende Veränderung stattgefunden. Wir haben den alten Menschen abgelegt, d.h. wir stehen vor Gott nicht mehr in unserem sündigen Zustand. Zudem haben wir den neuen Menschen angezogen und sind nun fähig, nach dem Vorbild unseres Herrn Jesus zur Ehre Gottes zu leben.
In der neuen, himmlischen Welt bestehen die alten Unterschiede nicht mehr. Alle Glaubenden haben nur ein Ziel und einen Lebensinhalt: Jesus Christus!
Verhaltet euch wie Christus!
Diese Verse bilden das Gegenstück zum vorherigen Abschnitt. Wir werden jetzt aufgefordert, im Zusammenleben der Christen die Wesenszüge des neuen Menschen zu offenbaren. Der Herr Jesus ist unser grosses Vorbild dazu.
Doch zuerst werden wir an unsere Stellung erinnert. Wir sind Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte! Als solche sind wir in der Lage, barmherzig, gütig, demütig, sanftmütig und geduldig zu sein.
Die Schwachstellen unserer Mitchristen sollen wir ertragen und immer bereit sein, einander die Sünden zu vergeben. Die wichtigste Eigenschaft ist die göttliche Liebe. Sie motiviert uns, allen Glaubenden in der Gesinnung von Jesus Christus zu begegnen.
Als der Herr Jesus hier lebte, genoss Er immer – sogar in den schwierigsten Situationen – einen inneren Frieden. Diesen Frieden möchte Er uns schenken (Johannes 14,27), damit wir alle Entscheidungen aus dieser inneren Ruhe heraus fällen.
Das Wort des Christus ist die ganze christliche Wahrheit, wie sie uns im Neuen Testament vorgestellt wird. Wenn wir die Bibel lesen und auf unser Herz und Gewissen anwenden, wird dieses Wort in uns wohnen und segensreiche Auswirkungen haben:
- Wir werden uns als Christen gegenseitig lehren und ermahnen.
- Wir werden zur Ehre Gottes und zu unserer Freude gemeinsam Loblieder singen.
- Wir werden alles in unserem Leben so tun wollen, wie es der Herr Jesus tun würde.
Ehe, Familie, Beruf
In diesem Abschnitt spricht der Apostel unser Verhalten in der Ehe, in der Familie und am Arbeitsplatz an. Was das Letztere betrifft, so dürfen wir seine Anweisungen an die Sklaven seiner Zeit auf das Verhältnis der Arbeitsnehmer unserer Tage übertragen. Es fällt uns auf, dass Paulus immer wieder den Herrn erwähnt, um den konkreten Anordnungen für das Alltagsleben einen hohen Wert beizumessen.
Zuerst werden die Ehefrauen angesprochen. Sie sollen sich ihren Männern unterordnen. Der Schöpfer hat ihnen diesen Platz in der Ehe gegeben. Wenn die Frauen ihn bereitwillig einnehmen, erleben sie den Segen und die Zustimmung des Herrn.
Die Ehemänner werden aufgefordert, ihre Frauen zu lieben. Sie sollen ihnen Zeit und Zuwendung schenken. Zudem werden die Männer davor gewarnt, bitter gegen ihre Frauen zu sein. Denken wir daran: Bitterkeit verletzt das Herz und führt zur Verhärtung!
Der Appell an die Kinder ist ganz einfach: Gehorcht euren Eltern! Doch wie freut sich der Herr, wenn sie es tun! Die Väter haben die Hauptverantwortung in der Erziehung. Sie stehen in Gefahr, ihre Kinder ungerecht zu behandeln oder zu überfordern.
Als Arbeitnehmer werden wir aufgefordert, dem Chef zu gehorchen und die Arbeit in erster Linie für den Herrn Jesus zu tun. Das motiviert uns, auch langweilige oder schwierige Aufgaben möglichst gut zu erledigen. Vers 24 enthält eine Ermutigung, Vers 25 eine Warnung. Der Herr beurteilt unser Verhalten am Arbeitsplatz. Wir werden ernten, was wir säen (Galater 6,7.8).
Wachen und beten
In Vers 1 werden alle Christen angesprochen, die im Beruf eine Kaderfunktion einnehmen. Sie sollen zu den Untergebenen gerecht sein und ihnen das geben, was ihnen an Lohn, Urlaub usw. zusteht. Der Gedanke, dass sie selbst einen Herrn im Himmel haben, hilft ihnen, sich als Vorgesetzte richtig zu verhalten. So wie Er mit ihnen handelt, sollen auch sie mit ihren Angestellten umgehen.
Ab Vers 2 bis zum Schluss des Kapitels lernen wir einige Lektionen über die Arbeit im Werk des Herrn. Zuerst stellt der Apostel uns in den Versen 2-6 drei allgemeine Voraussetzungen dazu vor: das ausdauernde Gebet, das korrekte Verhalten und das angemessene Reden. Anschliessend erwähnt Paulus in den Versen 7-17 verschiedene Mitarbeiter – ermutigende und warnende Beispiele für uns!
Die Verse 2-4 fordern uns alle zu einem lebendigen Gebetsleben auf. Zuerst lernen wir, wie wir beten sollen und anschliessend, wofür wir beten dürfen. Regelmässiges Beten erfordert geistliche Kraft und Ausdauer. Darum ist es gut, wenn wir wie Daniel feste Gebetszeiten kennen (Daniel 6,11). Vergessen wir beim Beten das Danken nicht! Wie viel Gutes bekommen wir jeden Tag von unserem Gott.
In den Versen 3 und 4 folgen zwei konkrete Gebetsanliegen: Erstens dürfen wir den Herrn bitten, dass Er seinen Dienern eine offene Tür zur Ausübung ihrer Aufgabe gibt. Zweitens dürfen wir dafür beten, dass sie bei der Verkündigung des Wortes den richtigen Ton finden, damit die Botschaft aufgenommen wird.
Weise leben und dienen
Wie wichtig ist unser Verhalten im Alltag! Unsere Mitmenschen beobachten uns an der Arbeit, in der Freizeit, in der Nachbarschaft. Wir haben Weisheit nötig, um uns als Christen in den einzelnen Situationen des Lebens korrekt zu benehmen. Gott möchte uns dieses Feingefühl geben, damit wir im Alltag die Anweisungen des Wortes Gottes zur rechten Zeit und in der richtigen Weise umsetzen.
Im Kontakt mit denen, die draussen sind – d.h. mit den Ungläubigen – schenkt der Herr uns Gelegenheiten, von Ihm und unserem Glauben an Ihn zu reden. Vielleicht ist unser gottesfürchtiges Verhalten der Anlass dazu. Wir wollen solche Möglichkeiten zum Zeugnis nutzen und den Herrn Jesus bitten, dass Er uns dazu das rechte Wort schenkt.
Ab Vers 7 spricht Paulus von seinen Mitarbeitern. Tychikus hatte als sein vertrauter Reisebegleiter die Aufgabe, die Kolosser über die persönlichen Umstände des gefangenen Apostels zu informieren. Gleichzeitig sollte Tychikus ihm bei seiner Rückkehr über die Situation der Kolosser berichten. Auch heute ist Gott gemässe und vertrauenswürdige Information für das Werk des Herrn förderlich. Onesimus begleitete Tychikus und konnte als zweiter Zeuge dessen Aussagen bestätigen.
Aristarchus, der Mitgefangene von Paulus, Markus, der wiederhergestellte Diener, und Jesus, genannt Justus, waren weitere Mitarbeiter des Apostels. Ihre treue Arbeit im Reich Gottes und ihre Verbundenheit mit Paulus waren eine grosse Ermutigung für ihn.
Mitarbeit im Werk des Herrn
Paulus fährt mit seinen Grüssen fort und erwähnt nochmals Epaphras. Von ihm haben die Menschen in Kolossä das Evangelium von Jesus Christus gehört (Kolosser 1,7). Nun wird die andere Seite dieses treuen Dieners gezeigt. Er war ein fleissiger Beter! Wenn er in den Gebeten für die Kolosser rang, hatte er zwei Bitten für sie auf dem Herzen:
- Er wünschte, dass sie vollkommen in allem Willen Gottes standen. Das ist dann der Fall, wenn wir die ganze christliche Wahrheit kennen und verwirklichen.
- Es war sein Anliegen, dass sie völlig überzeugt im Willen Gottes standen. Diese Herzensüberzeugung für die christliche Wahrheit bekommen wir, wenn wir das Wort Gottes im Herzen erfassen und bewahren.
Der Apostel richtete auch Grüsse von Lukas, dem geliebten Arzt, und von Demas aus. Im zweiten Timotheus-Brief werden diese beiden Mitarbeiter nochmals erwähnt. Dort kann Paulus die Treue des Ersten hervorheben: «Lukas allein ist bei mir.» Leider muss er auch von der Untreue des Zweiten berichten: «Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat.»
Nymphas erhielt einen speziellen Gruss. Hatte er diese Ermutigung besonders nötig, weil er Aufwand und Verzicht auf sich nahm, damit die Versammlung in seinem Haus zusammenkommen konnte? Archippus empfing von Paulus eine persönliche Ermahnung. War er in seinem Dienst träge geworden oder stand er in Gefahr, sich in andere Aufgaben einzumischen?
Buchtipp: Christus in uns – die Hoffnung der Herrlichkeit.
Den Kolosser-Brief besser verstehen.
Geburt und Jugend der Zwillinge
Auch in der Ehe von Isaak und Rebekka gab es eine Not. Sie bekamen keine Kinder. Doch der Glaubende weiss, wohin er sich wenden kann: im Gebet an seinen Gott. So bat Isaak den Herrn für seine Frau und Dieser erhörte ihn: Rebekka wurde schwanger, und zwar mit Zwillingen.
Nun sehen wir, wie auch sie zum Herrn betete und eine Antwort von Ihm bekam. Als der souveräne und allwissende Gott erklärte Er ihr, was aus ihren beiden Kindern werden würde. Wenn der allwissende Gott solche Aussagen macht, heisst dies nicht, dass der Mensch für sein Verhalten nicht mehr verantwortlich wäre. Die Bibel unterstreicht sowohl die Souveränität Gottes als auch die Verantwortung des Menschen. Beides läuft parallel nebeneinander und ist hundertprozentig wahr.
Die beiden Söhne waren in ihrem Wesen ganz verschieden. Leider entstand dadurch eine gewisse Entfremdung zwischen den Eheleuten, denn Isaak zog Esau vor, während Rebekka Jakob liebte. Dabei liessen sie sich von ihren natürlichen Neigungen leiten.
Sicher wusste Jakob, was Gott über ihn zu seiner Mutter gesagt hatte. Er glaubte dem Wort des Herrn. Doch er meinte, Gott nachhelfen zu müssen. So versuchte er auf menschlich schlaue Weise in den Besitz des Erstgeburtsrechts zu kommen.
Esau war ein Ungläubiger, der das Erstgeburtsrecht und den damit verbundenen Segen des Herrn gering achtete. Er wollte nur seinen Hunger stillen. Göttliche Dinge interessierten ihn nicht. Leichtsinnig verkaufte er sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht (Hebräer 12,16).
Buchtipp: Gott erfahren – ganz persönlich.
Isaak in Gerar
Im Leben Isaaks finden wir Parallelen zum Leben seines Vaters Abraham. Das wird in unserem Abschnitt besonders deutlich. Wie zur Zeit Abrahams gab es auch zur Zeit Isaaks eine Hungersnot. Solche Prüfungszeiten erproben unseren Glauben.
Was tun wir, wenn wir in den Zusammenkünften der Gläubigen einen Mangel an geistlicher Nahrung empfinden, wenn das Wort Gottes nur sehr dürftig verkündigt wird? Wie leicht schlagen wir dann den Weg des geringsten Widerstands ein. Es besteht die Gefahr, dass wir uns der Welt zuwenden in der Meinung, dort unseren inneren Hunger stillen zu können. So wie Gott Isaak warnte, nach Ägypten (= Welt) zu ziehen, so warnt Er auch uns. Wir wollen auf Gottes Stimme hören und Ihm gehorchen. Nur dann kann Er uns segnen.
Isaak zog also nicht nach Ägypten, sondern nur zum König von Gerar. Er blieb zwar im Land, ging aber zu den Philistern. Sie sind in der Bibel oft ein Bild von religiösen Bekennern, die kein Leben aus Gott haben. Wenn wir engen Kontakt mit Menschen suchen, die sich zwar Christen nennen, aber keine wahren Gläubigen sind, werden wir negativ beeinflusst.
Isaak fürchtete sich vor jenen Leuten und griff zu einer Lüge. Wie Abraham verleugnete er seine Frau und behauptete, sie sei seine Schwester. Da musste ihn der heidnische König zurechtweisen. Sind wir besser als Isaak? Haben wir nicht schon unter dem Einfluss von religiösen Menschen unsere himmlische Stellung oder die Zugehörigkeit zu den Gläubigen verleugnet, die sich einfach zum Herrn Jesus hin versammeln?
Brunnen graben
Isaak erfuhr den Segen des Herrn. Da beneideten ihn die Philister, unter denen er wohnte. Schliesslich wurde die Feindschaft so gross, dass Isaak und seinen Herden die Lebensgrundlage entzogen wurde. Als Folge davon musste er wegziehen. Vielleicht erleben auch wir Neid und Widerstand von unseren Mitmenschen, so dass wir nachgeben und ausweichen müssen. Aber prüfen wir uns, ob diese Feindschaft nicht eine Folge unseres verkehrten Verhaltens ist! Bei Isaak war es Gottes Güte in seinem Leben, die zu solchen Reaktionen führte.
Wovon reden die Wasserbrunnen, die Isaak wieder aufgrub? Sie sind ein Bild des Wortes Gottes, wie es durch den Heiligen Geist lebendig vor die Herzen gestellt wird. Was bedeuten dann die verstopften Brunnen? In der Vergangenheit hat der Herr treuen Männern Gottes viel Verständnis und Licht über die biblische Wahrheit gegeben. Leider wird heute vieles aus dem Dienst dieser Glaubensmänner herabgewürdigt, wenn nicht sogar verworfen. An uns liegt es nun, die Wahrheit des Wortes Gottes, die unsere geistlichen Vorfahren gekannt und verkündigt haben, für uns zu erfassen und sie dann verständlich weiterzugeben. Aber ebenso nötig ist es, dass wir die Bibel selbst erforschen, denn Isaak grub auch neue Brunnen.
Auf seinen Zügen kam Isaak schliesslich nach Beerseba. Dort bekam er wunderbare Zusagen seines Gottes und dort baute er auch einen Altar. Als Anbeter rief er den Namen des Herrn an und wohnte als Fremder in einem Zelt. Auch der Brunnen – das Wort Gottes –, aus dem er täglich schöpfte, fehlte nicht.
Abimelech besucht Isaak
Nun bekam Isaak hohen Besuch aus dem Volk der Philister. Zu Dritt kamen sie zu dem, den sie einst weggetrieben hatten. Wir verstehen die verwunderte Frage Isaaks. Was führten diese Männer im Schild?
Was Isaak erlebte, kann auch uns passieren: Ungläubige Menschen äussern sich uns gegenüber anerkennend. Dabei übertreiben sie vielleicht sogar. Wie verhalten wir uns dann? Von Isaak wollen wir lernen, zurückhaltend und vorsichtig, aber ebenso freundlich und grosszügig zu sein. Wir wollen uns bemühen, mit der Hilfe des Herrn Römer 12,18 zu verwirklichen: «Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden.» Gleichzeitig wollen wir jedoch nicht vergessen, dass die Schmeichelei der Welt eine grosse Gefahr für uns ist. Die Bibel gibt uns in Hiskia ein warnendes Beispiel. Dieser gottesfürchtige Mann erkannte diese Gefahr nicht und tappte in die Falle Satans. Die Folgen waren für ihn und andere verheerend (Jesaja 39).
Am gleichen Tag, da Isaak seinen hohen weltlichen Besuch wieder entlassen hatte, berichteten ihm seine Knechte von einem neuen Brunnen. Es scheint, als ob Gott damit das Verhalten Isaaks gegenüber den ungläubigen Besuchern anerkennen und belohnen wollte.
Esau heiratete zwei heidnischen Frauen. Diese Entscheidung offenbarte seine innere Haltung. Er war ein Ungläubiger, der sich auch in der Frage der Ehe nicht um Gott und seine Gedanken kümmerte. Welch ein Herzeleid waren diese Frauen für seine gläubigen Eltern!
Ein schmackhaftes Gericht
Diese Verse zeigen uns in Isaak einen Gläubigen, der in seinem Alter nicht mehr in Abhängigkeit von Gott lebte und handelte. Hatte er vergessen, dass der Herr zu Rebekka gesagt hatte: «Der Ältere wird dem Jüngeren dienen»? Weil seine Gemeinschaft mit Gott getrübt war, stand er im Begriff, gegen den offenbarten göttlichen Willen zu handeln. Und Gott? Ihm gleitet nichts aus den Händen, auch wenn die Menschen – und sogar die Glaubenden – versagen.
Rebekka, die Frau Isaaks, sah, dass sich die Dinge in die verkehrte Richtung entwickelten. Leider stand auch sie nicht auf der Höhe des Glaubens. Warum sprach sie nicht mit ihrem Mann über die Sache und erwähnte seinen Fehler? Es scheint, dass das Miteinander in ihrer Ehe zu einem Nebeneinander geworden war. Wie schade! Rebekka brachte die Sache auch nicht vertrauensvoll im Gebet vor Gott, sondern reagierte auf das fleischliche Verhalten Isaaks ebenso eigenwillig, ja, sogar betrügerisch.
Und Jakob? Auch bei ihm sehen wir keinen tätigen Glauben. Wohl zögerte er, den Vorschlag seiner Mutter auszuführen und seinen Vater zu betrügen. Doch nicht Gottesfurcht, sondern die Angst vor den Konsequenzen beim Scheitern des Plans bewog ihn, Einwände zu machen. Schliesslich überwog der Einfluss der Mutter. Sie wollte die Folgen eines allfälligen Misslingens auf sich nehmen. Nun war der Sohn zur bösen Tat bereit.
Zwar gelang der Plan, aber wie tragisch waren die Folgen für alle Beteiligten!
Jakob erschleicht sich den Segen
Das Wort Gottes berichtet uns nicht, mit welchen Empfindungen Jakob seinen Vater hinterging. Wir wissen nicht, wie sehr ihn sein Gewissen bei diesem Verhalten anklagte. Aber die Bibel sagt uns, wie oft Jakob gelogen und wie er sogar den Namen Gottes missbraucht hat (1. Mose 27,19.20.24).
Obwohl Isaak aufgrund der Stimme, die er als Jakobs Stimme erkannte, Verdacht schöpfte, gelang der Plan. Jakob erlangte den begehrten Segen. Mit List und Betrug erreichten Rebekka und Jakob ihr Ziel. Das alles spielte sich nicht in einer weltlichen Familie, sondern unter Gläubigen ab. Wie traurig! Diese Geschichte zeigt einmal mehr, dass die alte Natur im Gläubigen zu allem Bösen fähig ist. Wir wollen uns dieser Tatsache bewusst sein und uns nahe beim Herrn aufhalten.
Bevor Jakob geboren worden war, hatte der souveräne und allwissende Gott gesagt: «Der Ältere wird dem Jüngeren dienen.» Jakob glaubte diesem göttlichen Ausspruch. Zudem anerkannte und wertschätzte er den Segen, der mit dem Erstgeburtsrecht verbunden war. Diesen Glauben Jakobs beantwortete Gott dadurch, dass sein Vater ihn tatsächlich segnete. Aber weil Jakob nicht auf Gott warten konnte und meinte, er müsse Ihm nachhelfen, erfuhr er Gottes Erziehung. Wie bitter waren die Folgen seines eigenwilligen, betrügerischen Tuns! Wir wollen aus dieser Geschichte für uns lernen, beständig in Abhängigkeit vom Herrn zu leben. Anstatt Ihm durch eigenwillige Handlungen vorzugreifen, gilt es, Schritt für Schritt mit Ihm zu gehen.
Esau hasst Jakob
Nun hatte Jakob den erwünschten Segen. Doch es musste ihm klar gewesen sein, dass sein Betrug ans Licht kommen würde. So geschah es auch, als der wahre Esau mit seinem zubereiteten Essen zu Isaak trat.
In den Versen 30-40 fallen uns zwei Reaktionen der beteiligten Personen auf: der grosse Schrecken, den das Herz Isaak durchzog (Vers 33), und das grosse, bitterliche Geschrei und die Tränen Esaus (1. Mose 27,34.38). Der Schrecken Isaaks macht deutlich, dass er seinen grossen Fehler erkannt haben muss. Wenn der Herr es nicht verhindert hätte, hätte er gegen den göttlichen Willen gehandelt und den älteren Sohn gesegnet. Isaak sah dies ein und stellte sich nun im Glauben ganz auf Gottes Seite. Er erklärte Esau: «Ich habe ihn gesegnet; und er wird auch gesegnet sein.»
Esaus grosse Enttäuschung ist verständlich. Doch sein ungläubiges Herz zeigte keine Reue über die frühere Missachtung des Erstgeburtsrechts. Er trauerte nur dem Segen nach, der ihm entgangen war (Hebräer 12,16.17). Nun wollte er Rache üben und seinen Bruder umbringen, um als Haupterbe doch noch zum gewünschten Segen zu kommen. Aber Gott verhinderte dies.
Rebekka plante, Jakob zu ihrem Bruder Laban zu senden. Mit ihren Bemerkungen über die heidnischen Frauen Esaus, brachte sie ihren Mann dazu, über die Heirat Jakobs nachzudenken und seinen Sohn schliesslich nach Paddan-Aram zu senden (1. Mose 28). In jener Zeit fragte in der Familie Isaaks leider niemand nach Gott und seinem Willen. Wir sehen keine Abhängigkeit von Ihm, sondern ein Handeln nach eigenen Überlegungen.
Jakob verlässt das Elternhaus
Das Leben Jakobs kann in drei Teile gegliedert werden, die prophetisch auf die Geschichte Israels hinweisen:
- Sein Leben in Kanaan bis zur Flucht vor Esau spricht von der Zeit des Segens Gottes unter David und Salomo.
- Sein Wegzug nach Paddan-Aram und sein harter Dienst bei Laban veranschaulichen die Zeit, da Israel unter die Nationen zerstreut ist.
- Seine Rückkehr in das verheissene Land deutet die Zeit an, da Israel wieder in seinem Land wohnt.
Mit dem vorliegenden Kapitel beginnt der zweite Teil der Geschichte Jakobs.
Bereits in 1. Mose 27,46 hatte Rebekka mit ihrem Mann darüber gesprochen, wie schlimm es wäre, wenn Jakob eine heidnische Frau aus der Umgebung heiraten würde. Nun sehen wir, wie Isaak seinen Sohn nach Paddan-Aram zu den Angehörigen von Rebekka sandte. Obwohl Jakob mit diesem Wegzug vor Esau und seinem Hass fliehen musste, gab ihm sein Vater einen Segen mit auf den Weg. Isaaks Worte zeigen, dass er die Gemeinschaft mit seinem Gott wieder gefunden hatte. Was er aussprach, lag ganz auf der Linie der Gedanken Gottes.
Der Segen Isaaks und sein Gebot an Jakob, keine heidnische Frau aus Kanaan zu nehmen, sowie der Gehorsam Jakobs, blieben nicht ohne Einfluss auf Esau. Um seinen Eltern entgegenzukommen, nahm er zu seinen bisherigen Frauen noch eine Tochter Ismaels hinzu. Doch dies war nur eine äussere Geste gegenüber seinen Eltern. Sie zeigt etwas vom sympathischen Charakter Esaus. Sein Herz änderte sich leider nicht. Er blieb ungläubig.
Jakob in Bethel
Nun war Jakob auf der Flucht vor Esau. Er begann zu ernten, was er gesät hatte. In seinem Leben sah es tatsächlich nicht erfreulich aus. «Die Sonne war untergegangen.» Er übernachtete als mittelloser Flüchtling im Freien und musste seinen Kopf auf ein steinhartes «Kissen» legen.
Aber Gott erbarmte sich über ihn und gab ihn nicht auf. Er erschien ihm in einem eindrücklichen Traum und machte ihm herrliche Verheissungen über seine Nachkommen und über das Land, das er aus eigener Schuld für eine Zeit verlassen musste. Für die Gegenwart, in der die Aussichten alles andere als günstig waren, verhiess ihm Gott: «Ich bin mit dir.» Er wollte ihn schliesslich zurückbringen.
Welch ein Trost sind solche Worte Gottes für uns, die wir wie Jakob manchmal versagen. Unser Gott und Vater gibt uns, die wir Ihm angehören, wegen unserer Fehltritte nicht auf. Er will uns vielmehr wieder zurechtbringen. Oft kann Er uns jedoch – wie bei Jakob – seine Wege der Erziehung nicht ersparen.
Jakob fürchtete sich nach dieser Begegnung mit Gott, weil sein Herz noch nicht im Reinen mit Ihm war. Anstatt die angebotene Gnade dankbar anzunehmen, tat er ein Gelübde: «Wenn Gott mit mir ist … so soll der Herr mein Gott sein.» Jakob machte Ihm sogar Versprechungen. Er wollte Ihm seine Durchhilfe mit dem Zehnten entschädigen. Jakob meinte es aufrichtig. Doch wie weit war er von den Wegen und Gedanken Gottes entfernt! Wie vieles musste er noch lernen.
Jakob kommt nach Haran
Schliesslich erreichte Jakob den Wohnort seiner Verwandten. Wir erinnern uns an 1. Mose 24, als der Knecht Abrahams diesen Ort aufsuchte, um von dort eine Frau für den Sohn seines Herrn zu nehmen. Welch ein Unterschied zu Jakob! Damals kam der Knecht Abrahams mit «allerlei Gütern seines Herrn» und betete zu Gott, damit Er ihm die richtige Frau für Isaak zeige. Jetzt sehen wir Jakob als heimatlosen Flüchtling, der nicht einmal betete, sondern sich von seinen Gefühlen gegenüber Rahel leiten liess. Doch Gott benutzte die Umstände, um seine Pläne mit Jakob zu erfüllen.
Jakob war bereits ein erfahrener Hirte. Das merkt man aus dem Gespräch, das er mit den Hirten aus Haran führte (Vers 7). Als er dann Rahel, die Tochter Labans, sah, wälzte er den Stein von der Brunnenöffnung und tränkte die Schafe.
Danach konnte er seine Tränen nicht mehr zurückhalten. «Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte.» Wie froh war er, dass er endlich bei seiner Verwandtschaft angekommen war. Ob er hier eine Bleibe finden konnte?
Auch wenn Jakob im Gegensatz zum Knecht Abrahams nichts mitbrachte, wurde er im Haus von Laban als Neffe doch freundlich aufgenommen. Einen Monat lang blieb Jakob bei seinem Onkel. In dieser Zeit leistete er bereits gute Arbeit, so dass Laban erkannte, wie wertvoll und nützlich ihm sein Neffe als Viehhirte werden könnte. Deshalb versuchte er, ihn bei sich zu behalten (Vers 15).
Jakob wird betrogen
Nachdem der erste Monat bei Laban vergangen war, wurde die Lohnfrage zwischen dem Onkel und seinem Neffen geregelt. Für Jakob war klar: «Ich will dir sieben Jahre dienen um Rahel, deine jüngere Tochter.» Weil er sie liebte, vergingen ihm diese Jahre wie im Flug (1. Mose 29,18.20). Laban aber wollte diesen guten Knecht, der sozusagen ohne materiellen Lohn bei ihm arbeitete, noch weitere sieben Jahre an sich binden. Deshalb betrog er Jakob am Hochzeitstag, indem er ihm Lea statt Rahel zur Frau gab. Und Jakob? Auch wenn Laban für sein betrügerisches Tun verantwortlich war, stand doch Gott hinter allem. In seiner Erziehung mit Jakob liess Er ihn das ernten, was er selbst gesät hatte. Er, der seinen Vater betrogen hatte, wurde nun selbst hintergangen.
Nach einer Woche Hochzeitsfeier gab Laban seinem Neffen auch die gewünschte Tochter zur Frau: die von ihm geliebte Rahel. Doch Jakob musste bei Laban nochmals sieben Jahre arbeiten (1. Mose 29,27.30). Nun hatte Jakob zwei Frauen! Die Folge war, dass die eine geliebt und die andere gehasst war. Wie traurig! Doch der Herr dachte in seiner Gnade an Lea und schenkte der ungeliebten Frau Jakobs einige Söhne, während Rahel unfruchtbar war.
Die beiden Frauen Jakobs zeigen uns ein prophetisches Bild. Rahel stellt das Volk Israel dar, wie es vom Herrn geliebt war, aber zunächst keine Frucht brachte. Lea spricht von den Menschen aus den Nationen, die in der Zeit der Gnade durch den Glauben an das Evangelium Frucht für Gott bringen.
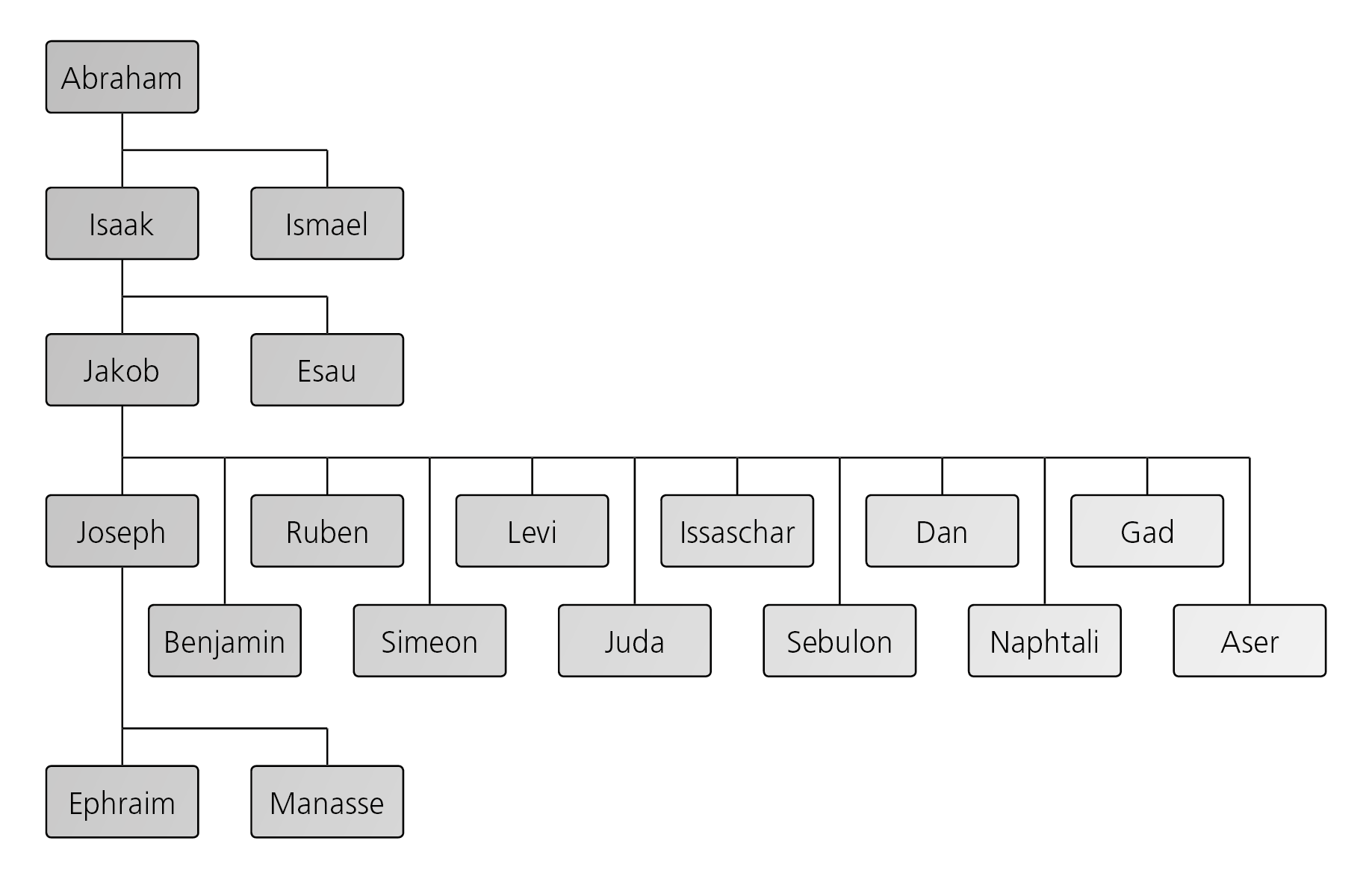
Stammbaum der Nachkommen Abrahams
Jakob und seine Familie
Gott duldete in der Zeit des Alten Testaments die Vielehe (Polygamie), aber sie war nie nach seinen Gedanken. Er hatte noch vor dem Sündenfall des Menschen die Einehe eingesetzt. Alle Beispiele im Alten Testament über Familien, in denen ein Mann mehr als eine Frau hatte, sind negativ. Immer gab es Schwierigkeiten und Nöte, so auch in der Familie von Jakob.
Ähnlich wie einst Sara versuchte Rahel ihre Unfruchtbarkeit zu umgehen, indem sie Jakob ihre Magd Bilha zur Frau gab. Als Lea aufhörte zu gebären, beschritt sie den gleichen Weg wie Rahel und gab Jakob ihre Magd Silpa zur Frau. Nun hatte Jakob vier Frauen. Wie sehr wurde sein Eheleben dadurch belastet! In einer Vielehe kann es niemals Harmonie geben. Das ist nur in der Einehe nach Gottes Gedanken möglich.
Auch wenn wir Menschen oft versagen, hört der souveräne Gott doch nicht auf, gnädig und barmherzig zu sein. Das sehen wir auch in der Geschichte der Familie Jakobs. Gott sah das schwierige Los von Lea und erhörte sie, indem Er ihr weitere Kinder schenkte (1. Mose 30,17-21). Aber Er dachte auch an Rahel. Als Gottes Zeit gekommen war, schenkte Er auch ihr einen Sohn: Joseph. Zuerst hatte Rahel von Jakob Kinder gefordert (Vers 1). Doch das konnte er nicht erfüllen. Später lernte sie, die Not im Gebet vor Gott zu bringen – und Er erhörte sie (Vers 22). So sorgte Gott trotz allen menschlichen Überlegungen und Handlungen dafür, dass Jakob der Stammvater aller 12 Stämme des Volkes Israel wurde.
Jakob und seine Arbeit
Nun wünschte Jakob, in das Land der Verheissung zurückzukehren. Er stellte sein Vorhaben dem Schwiegervater vor. Doch der schlaue Laban war nicht so schnell bereit, seinen hervorragenden Arbeiter ziehen zu lassen. Er bekannte: «Ich habe gespürt, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat.» Es gelang ihm, seinen Neffen zum Bleiben zu überreden, indem er ihm einen Lohn anbot.
Die Verhandlungen zwischen Onkel und Neffe sowie ihr Verhalten zeigen, dass diese beiden Männer in ihrer Schlauheit, aber auch in ihrem gewieften Handeln einander ebenbürtig waren. Trotz den Vorkehrungen Labans konnte Jakob als erfahrener Tierzüchter durch geschickte Massnahmen den Lohn zu seinen Gunsten beeinflussen. Das Resultat war, dass der materielle Reichtum Jakobs überaus wuchs. Aber stand nicht Gott hinter allem, der Jakob segnen wollte (1. Mose 31,42)?
Mit der Geburt von Joseph kam bei Jakob das Verlangen auf, nach Kanaan zurückzukehren. Es scheint, dass er sich ins Land der Verheissung zurücksehnte, wo seine Vorfahren gelebt und an ihren Altären mit Gott Gemeinschaft hatten. In Haran besass Jakob keinen Altar. Hätte er dort überhaupt einen haben können?
Aus der Tatsache, dass Jakob nach der Geburt von Joseph in sein Land zurückziehen wollte (Vers 25), können wir etwas lernen. Joseph ist hier ein Bild vom Herrn Jesus. Wenn Er vor unseren Glaubensblicken steht, sehen wir klar, welchen Weg wir nach Gottes Gedanken gehen sollen. Wichtig ist aber, dass wir uns nicht abhalten lassen, sondern diesen Weg auch gehen.
Jakob macht sich auf den Heimweg
Durch den schnell wachsenden Reichtum Jakobs verschlechterte sich das Verhältnis zwischen ihm und seinem Schwiegervater. Die Söhne Labans wurden neidisch auf ihren Cousin. Da griff Gott ein und forderte Jakob zur Rückkehr in das Land seiner Väter auf. Er versicherte ihm seinen Beistand: «Ich will mit dir sein.» Seitdem der Herr damals in Bethel mit ihm gesprochen hatte, war es nun das erste Mal, dass Jakob wieder die Stimme Gottes hörte.
Zuerst besprach Jakob die Sache mit seinen Frauen. Aus seinen Worten an Rahel und Lea erfahren wir, wie der Herr sich trotz des betrügerischen Verhaltens von Laban zu Jakob bekannt und ihn gesegnet hatte. Was für einen gnädigen Gott haben wir doch! Auch wenn Er uns wie einst Jakob erziehen muss, ist Er nicht gegen uns, sondern für uns.
Ohne sich von Laban zu verabschieden, machte sich Jakob mit seiner grossen Familie und allem, was er besass, auf den Weg nach Kanaan. Er befolgte Gottes Anweisung, aber er fürchtete sich vor Laban. Deshalb hinterging er ihn und floh während der Abwesenheit seines Onkels. Trotz der Zusage Gottes in Vers 3 sehen wir nicht, dass Jakob auf Ihn vertraut hätte. Obwohl der Herr zu ihm gesprochen hatte, ruhte er noch nicht in seinem Gott.
Doch sein Verhalten gegenüber seinen Frauen und Kindern zeugt von seiner Liebe und Sorge für seine Familie (Vers 17). Er kümmerte sich darum, dass sie möglichst bequem reisen konnten.
Jakob wird von Laban verfolgt
Sobald Laban von der Flucht Jakobs hörte, jagte er ihm nach. Aus Vers 29 kann man entnehmen, dass er keine guten Absichten hatte. Doch Gott verhinderte jedes böse Vorhaben, indem Er ihn in einem Traum deutlich warnte: «Hüte dich, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest!» So sehen wir, wie Gott – als seine Zeit gekommen war – selbst dafür sorgte, dass Jakob sich von Laban trennen konnte.
Vers 27 zeigt nochmals, wie unaufrichtig Laban war. Nach all dem, was die Bibel bis dahin über ihn berichtet hat, glaubt wohl niemand, dass er Jakob bei seinem Wegzug mit Freude und Musik begleitet hätte! Es waren schöne, aber unwahre Worte.
Neben der Habsucht hatte Laban noch einen weiteren Grund, um Jakob zu verfolgen: der Verlust seiner Hausgötzen (Vers 30). Laban war ein Götzendiener! Der Gott Jakobs war nicht sein Gott. Gegenüber Jakob nannte er Ihn «den Gott eures Vaters» (Vers 29).
Vers 32 macht klar, dass Jakob nicht alles wusste, was in seiner grossen Familie vorging. Er war ehrlich davon überzeugt, dass niemand von den Seinen Labans Götzen gestohlen hatte. Doch er täuschte sich: «Rahel aber hatte die Teraphim genommen und sie in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt» (Vers 34). Zudem erwies sich Rahel als eine echte Tochter Labans. Ihre List war so gut, dass ihr Vater seine Götzen trotz intensiver Suche in keinem der Zelte Jakobs finden konnte. «Er durchsuchte alles und fand die Teraphim nicht.»
Jakob auf dem Gebirge Gilead
Wir verstehen den Zorn Jakobs in Vers 36. Dennoch war es ein Ausbruch seiner alten Natur. Nun leerte er seinen Kropf und sagte seinem Onkel die Meinung. Doch was nützte es? Eigentlich nichts. Laban liess sich nicht beeindrucken und änderte sich nicht (Vers 43). Er blieb, was er war.
Wie lehrreich sind die Worte Jakobs für uns! Sie offenbaren etwas von der Härte und Schwere seines 20-jährigen Dienstes bei Laban, aber auch von der Treue, in der Jakob als Hirte arbeitete. Sie zeigen weiter, wie er wusste, dass Gott in dieser Zeit mit ihm gewesen war und seine Arbeit gesegnet hatte. Er war in seinem Elend nicht allein gewesen. So ist es heute noch. Wenn Gott uns in seiner Erziehung Wege führen muss, die wir als schwer empfinden, ist Er doch für uns und mit uns. Das wollen wir nicht vergessen.
Der errichtete Steinhaufen markierte eine klare Trennung zwischen Jakob und Laban. Der eine zog als Glaubender weiter, während der andere in der Welt blieb.
Dann schlossen beide Männer einen Bund. Die Worte Labans zeigen, welch ein Rechthaber und Besserwisser er war. Er meinte auch jetzt noch, er könne bestimmen. Doch es war Jakob, der eigentlich in allem die Initiative übernahm. Er opferte ein Schlachtopfer und lud seine Brüder zum Essen ein. Laban war und blieb ein Weltmensch. Aber Jakob versuchte als ein Gläubiger die Würde zu behalten. Er stand auf der Seite des Allmächtigen und wusste, dass Gott für ihn war.
Jakob fürchtet sich vor Esau
Nach der endgültigen Trennung von Laban kam Jakob ins verheissene Land zurück. Da begegneten ihm Engel Gottes, die ihn sozusagen willkommen hiessen. Doch es war auch das Heerlager Gottes. Wollte der Herr ihm damit nicht zeigen, dass Er ihn beschützen konnte, wenn er seinem Bruder Esau begegnete, vor dessen Hass er einst geflohen war? Jakob gab dem Ort den Namen «Machanaim», was Doppellager bedeutet. Möglicherweise erschienen ihm die Engel in zwei Zügen, die einen zum Schutz gegen die Gefahr von hinten (Laban) und die anderen zum Schutz gegen die Bedrohung von vorn (Esau).
Die bevorstehende Begegnung mit Esau machte Jakob grosse Sorge. Ja, er fürchtete sich, als er hörte, dass dieser ihm mit 400 Mann entgegenkam. Wo blieb das Gottvertrauen Jakobs? Ach, er handelte, wie auch wir oft reagieren. Wir unternehmen alles Menschenmögliche, um einer Schwierigkeit zu begegnen. Erst dann beten wir und bitten Gott um seine Hilfe und Rettung.
Es war ein schönes Gebet, das Jakob zu seinem Gott betete. Aber er war noch nicht bereit, mit ganzem Herzen auf Den zu vertrauen, mit dem er geredet hatte. Er bereitete ein Geschenk für Esau vor, das er vor sich her sandte, um ihn zu versöhnen (Vers 21). Sollte dieses Geschenk – das übrigens keine Kleinigkeit war – eine materielle Wiedergutmachung gegenüber Esau sein, den er einst betrogen hatte?
Dann heisst es: «Er übernachtete in jener Nacht im Lager.» Jene Nacht sollte die bedeutungsvollste im Leben Jakobs werden. Das zeigen uns die nächsten Verse.
Jakob in Pniel
In jener Nacht überquerte Jakob mit seiner Familie und seinem Besitz den Jabbok. Als er alles über die Furt des Flusses geführt hatte, blieb er allein am anderen Ufer zurück. Da rang ein Mann in der Dunkelheit mit ihm. Aus Hosea 12,4 wissen wir, dass es Gott war, mit dem Jakob kämpfte.
Zunächst schien es, als ob Jakob die Oberhand behielt. Doch als der geheimnisvolle Mann das Hüftgelenk Jakobs anrührte und dieses verrenkt wurde, war der Kampf entschieden. Nun war Jakob körperlich behindert und unfähig, weiter zu kämpfen.
Was bedeutete das alles? Bis zu diesem Ereignis hatte Jakob sehr vieles im Selbstvertrauen getan. Er hatte sich auf seine Kraft und Klugheit gestützt, aber dabei die tägliche Gemeinschaft mit Gott vernachlässigt. Alles, was Gott ihm auf seinem Lebensweg begegnen liess, konnte an dieser Einstellung nichts ändern. Darum griff der Herr nun selbst ein und brach seine Kraft für den Rest des Lebens. Sobald Jakob sich seiner bleibenden Schwachheit bewusst wurde, klammerte er sich an den Kämpfenden, um unbedingt von Ihm gesegnet zu werden. Jakob wollte jetzt alles nur noch von Gott bekommen. Damit hatte der Herr sein Ziel mit ihm erreicht.
Als Bestätigung der Sinnesänderung, die bei Jakob in dieser Nacht eingetreten war, gab Gott ihm einen neuen Namen: Israel (= Kämpfer Gottes). Nach dieser Begegnung mit Gott ging ihm die Sonne wieder auf (vergleiche Vers 32 mit 1. Mose 28,11).
Jakob trifft mit Esau zusammen
Obwohl Jakobs Kraft gebrochen und er ein hinkender Mann war, versuchte er noch einmal, mit Hilfe seiner eigenen Pläne Esau zu begegnen. Doch er musste lernen, dass alle seine Massnahmen völlig überflüssig waren. Sein Bruder begegnete ihm trotz seines früheren Betrugs mit grosser Herzlichkeit (Vers 4). Wir sehen darin, dass auch die Ungläubigen grossherzig sein können.
Auf die Frage Esaus antwortete Jakob als ein Gläubiger: Er rühmte die Gnade Gottes, die er in seinem Leben erfahren hatte. Das Geschenk, das er Esau bereits gemacht hatte, war ebenfalls ein Beweis davon (1. Mose 33,5.11). Als Esau seinen Bruder auf der Reise begleiten wollte, lehnte Jakob dankend ab. Es war ihm klar, dass ein Gläubiger niemals einen gemeinsamen Weg mit einem Ungläubigen gehen kann. Doch seine Begründung war schwach und unwahr. Er hätte seinem Bruder einfach sagen sollen, dass er ein anderes Ziel verfolgte. Er wollte doch nicht nach Seir, sondern nach Kanaan!
Als Jakob in Sukkot ein Haus baute und später in Sichem einen Altar errichtete, hatte er da das Ziel noch nicht erreicht. Wohl war er im Land Kanaan angekommen, aber noch nicht bis Hebron gelangt (1. Mose 35,27).
Der Altar in Sichem redet vom persönlichen Gebetskontakt des Glaubenden mit Gott. Obwohl es nun im Leben Jakobs einen Altar gab, stimmte sein innerer Zustand noch nicht mit dem Allmächtigen überein. Es standen ihm noch demütigende und beschämende Erfahrungen bevor, bis sein Herz wirklich auf Gott ausgerichtet war.
Unmoral in Sichem
Bevor wir uns mit den traurigen Ereignissen in Kapitel 34 beschäftigen, wollen wir uns zweierlei fragen:
- Hätten diese schlimmen Sünden nicht vermieden werden können, wenn Jakob von Pniel direkt nach Bethel gezogen wäre?
- Hatte er durch den Bau eines Hauses in Sukkot und den Kauf eines Feldes in Sichem nicht einen Teil seines Charakters als Fremder in der Welt aufgegeben und so seine Familie einer zusätzlichen Versuchung ausgesetzt?
Dina, die Tochter Leas, suchte den Kontakt zu ungläubigen jungen Frauen. Leider blieb es nicht dabei. Der Sohn eines Fürsten der Hewiter verliebte sich in sie und nahm sie, wie die Welt gewohnt ist zu nehmen. Er beging die Sünde der Hurerei mit ihr und entehrte sie. Daran änderte sich auch nichts, als der Vater dieses Mannes zu Jakob kam und um Dina als Frau für seinen Sohn bat.
Über diese Schandtat, die in Israel verübt worden war, ergrimmten die Söhne Jakobs sehr. Als dann Hemor zu Jakob und seinen Söhnen kam und ihnen vorschlug, sich mit den Bewohnern des Landes zu verschwägern, redeten sie betrügerisch. Sie wollten sich an ihnen rächen.
Warum schwieg Jakob, als er hörte, was mit seiner Tochter passiert war? Weil er wohl gemerkt haben muss, dass auch er daran schuld war: Anstatt nach Bethel zu ziehen, war er in Sichem geblieben. Doch nun konnte er an der Sache nichts mehr ändern. Er musste die Folgen ernten. Da er ein gläubiger Mann war, demütigte er sich unter die erziehende Hand Gottes – und schwieg.
Gewalttat in Sichem
Hemor und Sichem schöpften überhaupt keinen Verdacht, als die Söhne Jakobs, die vorher gekränkt und wütend reagiert hatten, nun einen Vorschlag machten. Jedenfalls brachten sie die gestellten Bedingungen der Söhne Jakobs vor die führenden Männer der Stadt. Schliesslich war man bereit, darauf einzugehen. So wurden alle Männlichen von Sichem beschnitten.
Was dann am dritten Tag geschah, als die Leute in Schmerzen waren, ist überaus verwerflich und abscheulich. Simeon und Levi ermordeten alle Männer der Stadt und holten Dina aus dem Haus Sichems. Dann kamen die übrigen Söhne Jakobs und plünderten die Stadt. Man ist geneigt zu sagen: Menschen zu töten, denen man die Möglichkeit genommen hat, sich zu verteidigen, ist eine weitaus schlimmere Sünde als die Schandtat Sichems. Doch Gott muss uns allen, die wir diesen Bericht lesen, zeigen, wozu wir Menschen fähig sind (Markus 7,21.22).
Jakob hatte das böse Tun seiner Söhne nicht verhindern können. Jetzt fürchtete er sich vor den Folgen. Er sagte: «Ihr habt mich in Trübsal gebracht, indem ihr mich stinkend macht unter den Bewohnern des Landes.» Warum dachte er nicht daran, wie sehr sein Gott, dem er in Sichem einen Altar gebaut hatte, durch das Verhalten Dinas und das Tun seiner Söhne verunehrt worden war?
In dieser Notsituation griff der Herr selbst ein. Er beschützte Jakob und die Seinen vor der Rache der Bewohner des Landes (1. Mose 35,5). Was für einen gütigen und gnädigen Gott haben wir doch!
Jakob zieht nach Bethel hinauf
Obwohl Jakob demütigende Erfahrungen machen musste (1. Mose 34), gab Gott ihn nicht auf. Er forderte jetzt den Patriarchen auf, nach Bethel hinaufzuziehen, wo er auf seiner Flucht vor Esau den Traum mit der Leiter vom Himmel auf die Erde gehabt hatte (1. Mose 28,11-22). Dort sollte er wohnen und seinem Gott einen Altar bauen.
Der Altar in Bethel spricht von der Gemeinschaft mit Gott. Auf dem Weg dorthin merkte Jakob, dass in seiner Familie nicht alles in Übereinstimmung mit Gott war. Er ordnete deshalb an, dass sie alle Götzen wegtun sollten, was sie auch befolgten. Dann vergrub Jakob alle fremden Götter und die Amulette unter der Terebinthe bei Sichem. Weiter forderte er die Seinen auf, sich zu reinigen und ihre Kleidung zu wechseln. Die Reinigung spricht vom Selbstgericht, das wir nötig haben, um die Gemeinschaft mit Gott geniessen zu können. Das Wechseln der Kleidung spricht von der würdigen Weise, in der wir vor Gott erscheinen sollen (vergleiche 1. Korinther 11,27-34).
In Bethel baute Jakob einen Altar und nannte den Ort: Gott des Hauses Gottes. Damit verwirklichten er und seine Familie gottesdienstliche Gemeinschaft.
Nun war Jakob innerlich so weit, dass Gott ihm wieder erscheinen konnte. Dabei bestätigte Er seinen neuen Namen: Israel. Zudem stellte sich Gott ihm als der Allmächtige vor, ähnlich wie Er es einst Abraham gegenüber getan hatte (1. Mose 17,1). Er verhiess Jakob sowohl eine grosse Nachkommenschaft als auch das Land Kanaan zum Besitztum.
Jakob kommt zu seinem Vater
Bei der Geburt ihres zweiten Sohnes starb Rahel. Für Jakob muss es ein sehr grosser Schmerz gewesen sein, als er seine geliebte Rahel durch den Tod verlor. Viele Jahre später, kurz vor seinem eigenen Tod, sprach er zu seinem Sohn Joseph mit ergreifenden Worten von Rahel: «Als ich aus Paddan kam, starb Rahel bei mir im Land Kanaan … und ich begrub sie dort auf dem Weg nach Ephrat, das ist Bethlehem» (1. Mose 48,7).
Wir hören nicht, dass Israel etwas zur Sünde seines Erstgeborenen sagte. Doch aus seinen letzten Worten an seine Söhne wird deutlich, wie sehr er diese Verfehlung verurteilte (1. Mose 49,4). Als Folge seiner Sünde verlor Ruben sein Erstgeburtsrecht (1. Chronika 5,1).
Mit der Geburt von Benjamin hatte Jakob nun zwölf Söhne (1. Mose 35,23-26). Sie wurden die Stammväter des Volkes Israel.
Schliesslich kam Jakob mit seinem ganzen Zug bis nach Mamre, wo sein alter Vater Isaak noch lebte. Von Rebekka wird nach Kapitel 28 nichts mehr berichtet. Vermutlich war sie in der Zwischenzeit gestorben. Sie konnte Jakob nicht mehr aus Haran holen lassen, wie sie es geplant hatte (1. Mose 27,45).
Im Alter von 180 Jahren verstarb Isaak. Jakob lebte zwar abgesondert von seinem ungläubigen Bruder Esau. Doch als es um das Begräbnis von Isaak ging, handelten beide Söhne miteinander. Der Tod eines Vaters ist ein Familienereignis, das alle Kinder betrifft – ob gläubig oder ungläubig. Wie schön, wenn sie den Vater gemeinsam beerdigen.
Die Nachkommen Esaus (1)
Warum hat uns Gott in seinem Wort ein ganzes Kapitel über die Familie Esaus und ihre Entwicklung hinterlassen? Es waren doch ungläubige, gottlose Menschen! Weil wir bei Esau und seinen Nachkommen die gleichen Merkmale finden, die auch die uns umgebende Welt prägt. So zeigt uns dieses Kapitel das Verhalten von ungläubigen und oft gottlosen Menschen, damit wir als gläubige Christen die Gefahren erkennen, die durch ihren Einfluss auf uns drohen.
Esau hatte wie Jakob einen zweiten Namen. Doch er hatte ihn nicht von Gott bekommen. Weil er das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft hatte, wurde er Edom genannt (1. Mose 25,30). Dieser Name erinnert an seine Gleichgültigkeit und sein Desinteresse an Gott. Immer wieder wird in diesem Kapitel auf diesen Namen Esaus hingewiesen.
Aus Vers 6 erfahren wir, dass Esau mit seiner Familie und seiner Habe von Jakob weg auf das Gebirge Seir zog. Von den Menschen, die dort wohnten, hatte Esau seine zweite Frau: Oholibama, die Tochter Anas und Enkeltochter Zibeons (1. Mose 36,2.24.25). So suchte er sein Glück in der Welt. Als Gläubige werden wir zu einer klaren Absonderung von der Welt aufgerufen (2. Korinther 6,14 – 7,1). Wir leben zwar in der Welt, sind aber nicht mehr von ihr (Johannes 17,14-16).
Die Aufzählung der Fürsten oder Stammeshäupter in den Versen 15-19 zeigen, dass die Nachkommen Esaus nicht nur zahlreich, sondern auch mächtig wurden. Das Streben nach Macht, Ehre und Reichtum ist bis heute ein Kennzeichen der Welt.
Die Nachkommen Esaus (2)
Die Söhne Seirs waren die Bewohner jenes Landes bevor Esau mit seiner Sippe dorthin zog. Aus ihrer Auflistung erfahren wir etwas über die Verwandtschaft der zweiten Frau Esaus. Zudem erkennen wir, dass er bereits vor seinem Umzug dorthin eine Verbindung zu Seir hatte. Auch unter den Bewohnern Seirs gab es Fürsten, so dass sich zwei ähnlich mächtige Sippen zusammenfanden.
Ab Vers 31 wird das Land Seir, wo die Nachkommen Esaus lebten, als Edom bezeichnet. Vermutlich war die Nachkommenschaft Esaus zahlenmässig stärker als die Sippe von Seir. Wichtig für uns aber ist die Bemerkung aus 5. Mose 2,5. Dort erklärte Gott dem Volk Israel, das auf dem Weg von Ägypten nach Kanaan war, dass das Land Seir nicht zu ihrem Erbteil gehörte: «Das Gebirge Seir habe ich Esau als Besitztum gegeben.»
Vom Schwiegervater Esaus wird in Vers 24 gesagt, dass er die warmen Quellen in der Wüste fand. Sind sie nicht ein Bild der Freuden der Welt? Oft sprechen sie die Gefühle der Menschen an. Aber ihre Wirkung verfliegt schnell wieder – so wie warmes Wasser in der Hitze der Wüste den Durst nicht wirklich stillen kann.
Die Erwähnung der Könige, die in Edom regiert hatten, bevor in Israel ein König herrschte, spricht sicher von Regierungsgewalt. Wie oft wird diese Herrschaft in der Welt selbstsüchtig und ungerecht ausgeübt.
Am Ende des Kapitels erwähnt der Geist Gottes nochmals den Namen Edom. Das Irdische erfüllte das Herz Esaus. Für Gott gab es da keinen Platz.
Einleitung
Im ersten Timotheus-Brief bekommen wir Anweisungen für ein angemessenes Verhalten im Haus Gottes.
Kapitel 1: Gesetz und Gnade
Kapitel 2: Gebet und Demut
Kapitel 3: Aufseher und Diener
Kapitel 4: Falsche und richtige Lehre
Kapitel 5: Witwen und Älteste
Kapitel 6: Genügsamkeit und Reichtum
Im zweiten Timotheus-Brief finden wir viele Hinweise zum Dienst für die Zeit des Niedergangs in der Christenheit.
Kapitel 1: Die Leiden des Dieners
Kapitel 2: Die Aufgaben des Dieners
Kapitel 3: Die Hilfsmittel des Dieners
Kapitel 4: Der treue Herr des Dieners
Das Gebot der Gnade
Der erste Brief an Timotheus ist einer der vier Briefe, die der Apostel Paulus an Einzelpersonen geschrieben hat. Der vorliegende legt das Schwergewicht auf die Gottseligkeit oder Gottesfurcht. Das geht auch uns an, die wir am Ende der christlichen Zeitepoche leben. Und der Charakter Gottes, wie er in den Briefen an Timotheus und Titus vorgestellt wird, hat sich bis heute nicht verändert: Er ist ein Heiland-Gott, ein Gott der Liebe.
Timotheus war ein enger und treuer Mitarbeiter des Apostels der Nationen. Als Paulus von Ephesus nach Mazedonien weiterreiste, liess er Timotheus mit einem Auftrag in Ephesus zurück (1. Timotheus 1,3.5). Den Gläubigen in jener Stadt drohten zwei Gefahren.
- Der Feind versuchte die christliche Lehre mit menschlichen, philosophischen Ideen zu vermischen (1. Timotheus 1,3.4).
- Es gab Menschen aus dem Judentum, die die Gläubigen unter das Gesetz bringen wollten, das Gott am Sinai dem Volk Israel gegeben hatte.
Der Apostel behandelt vor allem den zweiten Punkt. Er zeigt, dass Gott das Gesetz gab, damit der Mensch erkennt, was vor Gott böse ist. Das Gesetz ist nicht die Lebensregel der Christen (1. Timotheus 1,8-10).
Vers 5 zeigt, was uns kennzeichnen sollte: Liebe aus reinem (aufrichtigem) Herzen, ein gutes Gewissen, das uns nicht anklagt, und einfältiges Gottvertrauen. Das wird uns auf dem guten Weg bewahren.
Barmherzigkeit und Gnade
Das Gesetz vom Sinai konnte nur zeigen, wie böse und sündig wir Menschen in Gottes Augen sind. Es konnte keinem helfen, die Situation zu ändern. Wie anders ist da die Gnade Gottes!
In den Versen 12-17 stellt sich Paulus selbst vor, um klarzumachen, was die unumschränkte Gnade auf der Grundlage des Erlösungswerks des Herrn Jesus zustande bringt. Paulus war vor seiner Bekehrung ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter. Doch der Herr Jesus, den er verfolgte, trat ihm in den Weg, führte ihn zur Einsicht und zur Buße über sein böses Leben und zum Glauben an Ihn und sein Erlösungswerk. Nach seiner Bekehrung betrachtete sich Paulus als den ersten oder grössten Sünder, für den Jesus Christus in die Welt gekommen war. Wenn Er ihn errettet hat, wird Er auch jeden anderen, der aufrichtig Buße tut und an Ihn glaubt, erretten. Welch eine Barmherzigkeit Gottes hat dieser Mann erfahren! Ja, er spricht von überströmender Gnade, weil Gott ihn nicht nur errettet, sondern auch in seinen Dienst gestellt hat. Er kann nicht anders, als in Vers 17 einen Lobpreis anstimmen.
In Vers 18 kommt Paulus auf den besonderen Auftrag zurück, den er Timotheus gegeben hatte (vergleiche 1. Timotheus 1,3.5). Er ermuntert ihn, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und sich im persönlichen Gottvertrauen nicht erschüttern zu lassen. Es gab einige, die der Apostel mit Namen nennt, die über die Stimme ihres Gewissens hinweggingen. Dabei kamen sie so weit von der Wahrheit ab, dass Paulus mit apostolischer Autorität gegen sie handeln musste.
Unser Heiland-Gott
Unser Gott ist ein Heiland-Gott, der an alle Menschen denkt. Es ist sein Verlangen, dass sie alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit über sich selbst und über Gott kommen. Unsere Aufgabe ist, für alle Menschen zu beten. Unser Reden mit Gott kann dabei verschiedene Formen annehmen je nach der Situation, die wir Ihm vorbringen. Manchmal wird das Gebet zu einem intensiven Flehen. Oft denken wir dabei an die anderen (Fürbitte), und für wie vieles können wir Gott danken!
Neben allen Menschen wird die Kategorie von Königen und hochgestellten Personen besonders hervorgehoben. Möchten wir mehr für die Verantwortlichen in der Regierung beten, damit wir bis zum baldigen Kommen unseres Herrn ein Leben in Gottesfurcht führen können. Ruhig und still bedeutet, dass wir uns in keiner Weise auffallend benehmen sollten.
Die Verse 5 und 6 zeigen die Grundlage, auf der alle Menschen errettet werden können. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen und am Kreuz gestorben. Dabei hat Er alle gerechten Ansprüche Gottes erfüllt und ein Lösegeld bezahlt, das für alle Menschen ausreicht. Aber es kommt nicht automatisch allen zugut. Die Bibel kennt keine Allversöhnung. In den Genuss des Lösegeldes und damit der Errettung kommen nur die Menschen, die Buße tun und an Jesus Christus glauben. Die anderen gehen verloren. – Wichtig ist, dass wir die Botschaft des Heils verkündigen. Paulus hat es getan. Heute sollten wir das Evangelium den Menschen weitersagen.
Männer und Frauen
Um diese Verse zu verstehen, müssen wir an die Aussage in 1. Timotheus 3,15 denken. Dort erwähnt der Apostel den Grund für diesen Brief: «Damit du weisst, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist.» Es geht in unseren Versen um das Verhalten von gläubigen Männern und Frauen.
Vers 8: Wenn irgendwo (an jedem Ort) unter Menschen gebetet wird, sollen dies Männer tun. Da wo Verantwortung übernommen werden muss, sind die Männer angesprochen. Doch sie sollen «heilige Hände aufheben». Um in der Öffentlichkeit zu beten, z.B. in einer Zusammenkunft der Gläubigen, muss der persönliche Zustand des Beters vor Gott in Ordnung sein.
Der gläubigen Frau wird gesagt, dass sie sich in ihrem Äusseren so verhalten soll, wie es «Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen». Die Gottesfurcht hilft uns, praktische Fragen, z.B. über Mode und Kleidung, zu lösen. Diese Verse stimmen ganz mit anderen Stellen überein, die vom Platz der Unterordnung der Frau reden, den Gott ihr gegeben hat. Sie soll also nicht öffentlich eine Führung übernehmen, sei es im Gebet oder im Lehren. Zwei Gründe werden für diesen Platz der Unterordnung, den eine christliche Frau einnehmen sollte, angegeben. Erstens entspricht er der Schöpfungsordnung. Zweitens wird der Sündenfall erwähnt. Zwar sehen wir in 1. Mose 3, wie sowohl Adam als auch Eva in Sünde fielen, und Gott die erste Verantwortung auf Adam legt. Doch Adam fiel nicht, indem er wie Eva durch die Schlange betrogen wurde.
Der Aufseherdienst
Gott möchte, dass in seinem geistlichen Haus – in der Versammlung – alles «anständig und in Ordnung» abläuft (1. Korinther 14,40). Damit dies auch praktisch verwirklicht wird, hat Er das Amt des Aufsehers oder Ältesten und das Amt des Dieners gegeben. Da wir heute keine Apostel und keine von Aposteln autorisierte Personen haben, die Älteste anstellen können, kennen wir keine amtlichen Aufseher mehr. Doch bis heute gibt es unter den Gläubigen in den örtlichen Versammlungen Männer, auf die die Beschreibung der Verse 2-7 zutreffen. Solche können den Dienst eines Aufsehers ausüben. An uns liegt es, diese Brüder und ihren Dienst anzuerkennen (1. Thessalonicher 5,12.13).
Man könnte den Aufseherdienst als eine Art von örtlich begrenztem Hirtendienst bezeichnen. Gläubige Männer, die an einem Ort einen solchen Dienst tun, haben ein fürsorgliches Auge für ihre Mitgläubigen und kümmern sich um sie (1. Petrus 5,1-3).
Wenn wir die Voraussetzungen sorgfältig lesen, fallen uns einige wichtige Punkte auf. Wer einen Dienst als Aufseher ausüben möchte, muss verheiratet sein und im persönlichen Leben bewiesen haben, dass er seiner Verantwortung als Familienoberhaupt nachgekommen ist. Unmöglich kann ein Neuling, d.h. ein Mensch, der erst vor Kurzem gläubig geworden ist, einen solchen Dienst ausführen. Und wie beurteilen aussenstehende Mitmenschen einen solchen Mann? Wer kein gutes Zeugnis von ungläubigen Nachbarn oder Arbeitskollegen hat, ist für einen Aufseherdienst ungeeignet.
Diener und die Versammlung
Die Aufgabe eines Dieners umfasst nicht den geistlichen Zustand der Glaubenden, sondern die materiellen Belange der örtlichen Versammlung (z.B. die Verwaltung der materiellen Gaben oder die Betreuung und den Unterhalt des Versammlungsraums). Diener wurden nicht von Aposteln, sondern von den Gläubigen erwählt und bestimmt. Das gilt bis heute. Wer eine solche Aufgabe wahrnehmen möchte, muss die in den Versen 8-12 gegebenen Voraussetzungen erfüllen. Ein Beispiel von Dienern finden wir in Apostelgeschichte 6,1-6 (siehe auch 1. Korinther 16,3; 2. Korinther 8,18-22).
Eine schöne Illustration von Vers 13 ist das Leben von Philippus. Er war einer der sieben Dienern, die in Apostelgeschichte 6 erwählt wurden, um die Tische zu bedienen. Später wurde er ein Evangelist, der in vielen Städten die frohe Botschaft verkündete (Apostelgeschichte 8,5.40; 21,8).
Der 15. Vers ist ein Kernvers des ganzen Briefes. Aus diesem Brief lernen wir, wie wir uns als Gläubige, die zusammen die Versammlung Gottes bilden, zu verhalten haben, und zwar jeder an dem Platz, wo der Herr ihn hingestellt hat. – Der letzte Vers des Kapitels zeigt uns das Geheimnis der Gottseligkeit. Bei diesem Geheimnis geht es um die geheimnisvolle Kraft eines Lebens in Gottesfurcht. Diese verborgene Quelle liegt in der Offenbarung Gottes, wie Er sich in seinem Sohn Jesus Christus gezeigt hat. Wie wichtig ist es, diese wunderbare Person – es ist unser Erlöser – immer besser kennen zu lernen. Er ist die Kraftquelle für das richtige Verhalten im Haus Gottes.
Warnung vor falschen Lehren
Gott wohnt durch den Heiligen Geist in der Versammlung. Dieser Geist warnt jetzt in Vers 1 vor religiösen Verirrungen unter den Christen, die schon bald nach dem Heimgang der Apostel auftreten würden. Doch die hier aufgeführten irrigen Ansichten findet man auch heute noch in der Christenheit.
Das Abfallen vom Glauben bedeutet das Aufgeben der Wahrheit, wie sie uns in der Bibel mitgeteilt ist. Man gibt die Grundwahrheiten des christlichen Glaubens auf und glaubt dafür an Lehren, deren Quelle Dämonen sind. Diese bösen Lehren haben praktische Auswirkungen auf das Leben der Menschen, wie Vers 3 zeigt. Da wird das, was der Schöpfer-Gott eingerichtet und gegeben hat, verboten. Tatsache aber ist, dass Gott uns alles schenken möchte, was wir in seiner Schöpfung finden. Wir dürfen es dankbar von Ihm annehmen und geniessen.
Timotheus hatte die Aufgabe, den Gläubigen in Ephesus diese ernsten Warnungen klar vorzustellen. Wenn er dies tat, war er ein guter Diener des Herrn.
Die Worte des Glaubens sind der Inhalt und die Worte der Lehre die Form der Wahrheit Gottes, d.h. was Gott uns mitgeteilt hat und wie Er es getan hat.
Die Gottseligkeit oder wahre Gottesfurcht wirkt sich sowohl im gegenwärtigen Leben als auch in der Zukunft aus. Heute darf der Gläubige mit ruhigem Gottvertrauen durchs Leben gehen. Und wie herrlich wird die Zukunft sein, wenn sich das ewige Leben in ihm ungehindert entfalten kann!
Auf die biblische Lehre achten
Das Wort Gottes ist treu und zuverlässig. Doch es ist kein leichter Dienst, den Menschen dieses Wort weiterzugeben. Die Leute wollen es nicht so ohne Weiteres annehmen. Doch jeder Diener des Herrn kann sich vertrauensvoll auf den lebendigen Gott stützen.
Die Verse 11-15 sind wichtige Ermahnungen, die jeder, der dem Herrn dienen möchte, zu Herzen nehmen muss. Wenn unser Leben nicht vorbildlich ist und nicht mit dem übereinstimmt, was wir sagen, ist unser Zeugnis kraft- und wertlos.
Der Herr hat jedem von uns etwas gegeben, das wir im Dienst für Ihn einsetzen dürfen. Timotheus hatte eine besondere Gnadengabe. Doch es scheint, dass er sehr zurückhaltend war und dadurch in Gefahr stand, seine Gabe zu vernachlässigen. – Die Fortschritte, von denen Paulus in Vers 15 spricht, beziehen sich nicht nur auf das Glaubensleben im Allgemeinen, sondern auch auf den Dienst für den Herrn. Wenn Timotheus die Ermahnungen des Apostels zu Herzen nahm, würde er Fortschritte in seinem Dienst machen.
Es ist wichtig, dass den Gläubigen das Wort Gottes nahegebracht wird, denn es drohen ihnen auf dem Weg zur Herrlichkeit viele Gefahren. Sie werden daraus gerettet, wenn sie auf die Botschaft der Bibel hören und sie befolgen. Damit die Verkündigung bei den Zuhörern ankommt, muss der Diener des Herrn sich immer wieder im Licht Gottes prüfen und das wegtun, was im Widerspruch zum Herrn ist, aber auch die ganze Wahrheit des Neuen Testaments sorgfältig festhalten und ohne Abstriche weitergeben.
Witwen in der Versammlung (1)
Im Haus Gottes, d.h. unter den Gläubigen, gibt es alte Männer, alte Frauen, junge Männer und junge Frauen. Timotheus sollte sich allen gegenüber richtig verhalten. Wie viel können wir aus den ersten zwei Versen für unser Benehmen lernen! Begegnen wir unseren älteren Geschwistern so, wie der Apostel dies vorstellt? Denken wir beim Umgang mit dem anderen Geschlecht daran, die nötige Distanz zu wahren?
Die Witwen hatten es zur Zeit von Timotheus nicht leicht. Es gab für sie keine staatliche Unterstützung. Wenn eine Witwe Kinder oder Enkel hatte, lag es an diesen, für ihre Mutter und Grossmutter zu sorgen. Auch wenn es heute vielerorts Witwenrenten gibt, haben diese Verse nichts von ihrer Bedeutung verloren. Gottes Wort ist an keine Zeitperiode gebunden, es ist ewig. Den Eltern das zu vergelten, was sie uns Kindern getan haben, umfasst mehr als materielle Unterstützung. Sie haben uns ihre Liebe erfahren lassen, für uns gesorgt und, wenn sie gläubig waren, sich bemüht, uns in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Vergelten wir ihnen etwas davon?
Witwen, die keine Nachkommen hatten und auf sich allein gestellt waren, hatten nur Gott, auf den sie sich stützen konnten. Er ist es, der angeordnet hat, dass wirkliche Witwen von der Versammlung unterstützt werden (Vers 16).
Christen, die es versäumen, für die Ihren zu sorgen, verhalten sich schlechter als ein Ungläubiger. Welch ein trauriges Zeugnis vor der Welt!
Witwen in der Versammlung (2)
Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiss, wie schnell es passieren kann, dass jemand ungerechtfertigt eine Unterstützung bezieht. Deshalb werden in den Versen 9 und 10 klare Voraussetzungen aufgeführt, die eine Witwe erfüllt haben musste, um ins Verzeichnis aufgenommen zu werden. Eine gläubige Frau, die in ihren guten Tagen anderen ihre Hilfe erwiesen hat, wird erfahren, dass Gott sie in alten und einsamen Tagen nicht vergisst.
Jüngere Witwen, die materiell gut gestellt sind, aber keine eigentliche Aufgabe mehr haben, stehen in grosser Gefahr, auf ungute Wege zu kommen, die zu ihrem Schaden sind. Das Wort Gottes warnt an verschiedenen Stellen vor Müssiggang. Das geht nicht nur die jüngeren Witwen, sondern uns alle an.
In Vers 14 haben wir einen persönlichen Hinweis des Apostels, den Gott in sein inspiriertes Wort aufgenommen hat. Der Herr möchte nicht, dass jüngere Witwen durch ihr Verhalten den ungläubigen Menschen einen berechtigten Anlass geben, den christlichen Glauben zu schmähen.
Vers 16 wiederholt das in Vers 4 Gesagte und macht klar, dass die örtliche Versammlung kein allgemeiner Unterstützungsverein ist. Die verantwortlichen Brüder sollen sorgfältig darauf achten, wirklich nur solche Witwen zu unterstützen, die keine andere Hilfe haben.
Besonnen urteilen und handeln
Die Verse 17-21 behandeln das Verhalten gegenüber den Ältesten in der örtlichen Versammlung. Es gab solche, die ihre Aufgabe wahrnahmen, ohne öffentlich zu lehren. Andere aber standen durch ihre öffentliche Verkündigung mehr im Rampenlicht und waren dadurch auch mehr der Kritik ausgesetzt.
Mit der doppelten Ehre werden zwei Seiten angesprochen: Es handelt sich einerseits um die Achtung und anderseits um die materielle Unterstützung solcher Männer. Siehe die Zitate in Vers 18.
Älteste sind eher der Kritik ausgesetzt als andere Gläubige. Deshalb sollte eine Klage gegen sie nur dann angenommen werden, wenn sie wirklich gut bezeugt war. Im Weiteren haben Gläubige, die einen Ältestendienst ausüben, eine sehr grosse Verantwortung. Wenn sie in Sünde fallen, müssen sie vor allen überführt werden, um die anderen vorsichtiger zu machen. Der Dienst von Timotheus war nicht leicht. Er durfte sich in keiner Weise beeinflussen lassen, weder für die einen noch gegen die anderen.
Das Auflegen der Hände bedeutet, dass man sich mit einer Person und ihrem Verhalten einsmacht. Um sich dadurch nicht mit etwas Verkehrtem oder Bösem zu verbinden, musste Timotheus beim Händeauflegen sehr vorsichtig sein. Er brauchte aber nicht nur Ermahnung, sondern auch Ermunterung und Zuspruch. Beides erfuhr er von Paulus. – In den Schlussversen finden wir die wichtige Aussage, dass es nichts gibt, das auf die Dauer verborgen bleiben kann. Früher oder später kommt alles ans Licht.
Gottesfrucht und Genügsamkeit
In den Versen 1 und 2 geht es um das Verhalten der Sklaven, die an den Herrn Jesus glaubten. Sie sollten ihre Herren ehren, damit durch ihr Verhalten keine Unehre auf den Namen Gottes und die christliche Lehre fiel. Es gab auch Sklaven, die gläubige Herren hatten. In ihrer Stellung vor Gott waren Sklaven und Herren Brüder in Christus. Diese Vertrautheit durften die Sklaven nicht missbrauchen. Was ihr Platz in der Welt betraf, mussten sie ihre Brüder als Herren (Autorität) anerkennen und ihnen besonders gut dienen.
Heute haben wir «die gesunden Worte, die unseres Herrn Jesus Christus sind», schriftlich in Händen. Sie umfassen das ganze Neue Testament. Wer sich dieser Autorität (des Wortes) nicht beugt, sondern etwas anderes lehrt, fällt unter das Urteil der Verse 4 und 5.
Ein Leben in Gottesfurcht ist ein Gewinn, wenn man mit dem zufrieden ist, was man auf der Erde besitzt. Als Glaubende sind wir nicht von dieser Welt, sondern Himmelsbürger. Zudem haben wir nichts in die Welt hineingebracht und werden auch nichts mitnehmen. Wir sind nur Verwalter von dem, was der Herr uns an irdischen Gütern anvertraut hat.
Vergessen wir nicht, dass wir als Gläubige neben dem neuen Leben noch die alte Natur haben. Die Wurzel der Geldliebe oder Habsucht steckt auch in uns. Sie wird, wenn wir nicht wachsam sind, auch in unserem Leben Schosse treiben. Wie schnell geschieht es, dass auch ein Gläubiger reich werden will! Die aufgeführten Konsequenzen werden nicht ausbleiben.
Der gute Kampf des Glaubens
Was können wir tun, wenn in uns das Verlangen aufkommt, reich zu werden? Vers 11 fordert uns auf, diese Dinge zu fliehen und gleichzeitig nach praktischer Gerechtigkeit, Abhängigkeit vom Herrn, Gottvertrauen, Liebe, Ausharren und Sanftmut des Geistes zu streben.
Es ist nicht so leicht, ein Leben in Gottesfurcht zu führen. Der Feind will nicht, dass Gott durch das Leben der Seinen in dieser Welt geehrt wird. Darum gibt es Kampf. Um in der uns umgebenden verführerischen materialistischen Welt das ewige Leben wirklich auszuleben, ist Energie des Glaubens nötig.
Das Gebot in Vers 14 umfasst alle Anweisungen, dieses Briefes. Es geht um alles, was zu einem Leben echter Gottesfurcht notwendig ist. Wir müssen es bis zum Kommen des Herrn bewahren, d.h. selbst ausleben und anderen weitergeben. Weil es hier um unsere Verantwortung geht, wird die Erscheinung unseres Herrn und nicht sein Kommen zur Entrückung erwähnt.
Den Reichen in Vers 17 hat Gott materiell viel anvertraut, ohne dass sie danach gestrebt haben. Sie sollen ihren Reichtum nicht als Sicherheit betrachten, sondern freigebige Verwalter ihres Besitzes sein.
Das anvertraute Gut umfasst die Glaubenswahrheiten, die Gott uns durch sein Wort übergeben hat. Wir sollen sie treu bewahren und uns von allem wegwenden, was an menschlichen Ideen ins Christentum eingedrungen ist. Für ein solches Leben nach Gottes Gedanken und zur Ehre des Herrn dürfen wir uns ganz auf seine Gnade stützen.
Glaube und Dienst
Dieser Brief ist der letzte inspirierte Brief des Apostels Paulus. Er schrieb ihn aus dem Gefängnis in Rom kurz vor seinem Märtyrertod (2. Timotheus 4,6). Der Verfall des christlichen Zeugnisses war bereits so weit fortgeschritten, dass Paulus von einem grossen Haus anstatt vom Haus Gottes sprach. Doch auch in den Tagen des Niedergangs bleibt der Herr treu. So können die, die Ihm entschieden folgen wollen, stets mit seiner Hilfe, Gnade und Kraft rechnen.
Der Apostel versichert seinem jüngeren Mitarbeiter, den er als sein geliebtes Kind bezeichnet, dass er in seinen Gebeten unablässig an ihn denkt. Auch wir dürfen in der Fürbitte füreinander einstehen, damit keiner, der dem Herrn in persönlicher Treue nachfolgen möchte, den Mut verliert.
Zudem wünschte Paulus, den Timotheus nochmals zu sehen. In 2. Timotheus 4,9 fordert er ihn auf, bald zu kommen. Der Apostel würde sich in seinen traurigen Umständen freuen, diesen treuen Mitarbeiter nochmals zu sehen. Wie schön ist das Zeugnis, das der Grossmutter und der Mutter von Timotheus ausgestellt wird! Sie hatten einen ungeheuchelten Glauben. Ein ebenso echter Glaube wohnte auch in Timotheus.
Timotheus scheint ein zaghafter Mann gewesen zu sein. Darum ermuntert Paulus seinen Mitarbeiter, die vom Herrn empfangene Gabe auch auszuüben. Weil Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, braucht der Gläubige sich in Notzeiten nicht zu fürchten. Er darf in einer Geisteshaltung, die von Kraft, Liebe und Besonnenheit geprägt ist, den Weg gehen.
Festhalten und treu bleiben
Zu jener Zeit war das christliche Zeugnis bereits nicht mehr so kraftvoll wie zu Beginn. Zudem war Paulus, der grosse Prediger des Evangeliums, im Gefängnis. Viele Gläubige hatten sich von ihm abgekehrt (Vers 15). Aber das Evangelium selbst hatte nichts von seiner errettenden Kraft eingebüßt. Timotheus sollte daran denken, auf was für einer unerschütterlichen Grundlage seine Errettung ruhte. Das würde ihm helfen, ohne sich zu schämen, für den Herrn Jesus zu zeugen und Leiden um des Evangeliums willen zu ertragen.
Paulus war im Gefängnis, weil er ein treuer Herold (= Prediger), Apostel (= Gesandter des Herrn) und Lehrer der Nationen war. Aber er schämte sich nicht, denn er wusste, dass er sein Vertrauen auf den Sieger von Golgatha gesetzt hatte und nicht enttäuscht würde.
Die Aufforderung in Vers 13 richtet sich auch an uns. Wir sollen das ganze Wort Gottes festhalten, und zwar in der Form, in der es zu uns gekommen ist. Gott hat uns in der Bibel alle seine Gedanken mitgeteilt. Dazu hat Er über einen Zeitraum von circa 1600 Jahren verschiedene Schreiber benutzt, aber alle durch seinen Geist inspiriert. An uns liegt es, dieses Ganze in seiner göttlichen Form festzuhalten und zu bewahren. Wir wollen keinen Teil der Bibel als unwichtig oder nebensächlich abwerten und beiseite lassen.
Als sich bereits viele Christen vom Apostel abgewandt hatten, gab es solche wie Onesiphorus, der keine Mühe scheute, um den Apostel im Gefängnis zu ermuntern. Der Herr wird ihn dafür belohnen.
Soldat, Sportler, Ackerbauer
Der zweite Timotheus-Brief ist sehr persönlich gehalten. Einerseits schüttet der Apostel seinem treuen Freund das Herz aus, denn der Zustand unter den Christen drückt ihn nieder. Anderseits ermuntert er den Briefempfänger, den Dienst in persönlicher Treue weiterzuführen. Dabei sollte er sich ganz auf die Gnade stützen und in ihr erstarken.
Seitdem das Wort Gottes abgeschlossen ist, gibt es keine neuen Offenbarungen mehr. Jetzt geht es darum, die Lehre des Neuen Testaments weiterzugeben. Timotheus sollte das von Paulus Gehörte solchen anvertrauen, die ihrerseits andere belehren konnten. Das ist bis heute der Weg, auf dem die Wahrheit Gottes unter den Gläubigen weitergereicht wird. Wir alle besitzen eine Bibel. Aber der Herr hat Brüder befähigt, die Lehre verständlich zu machen und zu erklären. Auf sie sollen wir hören, um Fortschritte im Verständnis der Gedanken Gottes zu machen.
In den Versen 3-6 gebraucht der Apostel drei Bilder aus dem täglichen Leben, um verschiedene Merkmale eines guten Dieners des Herrn aufzuzeigen. Der Soldat, der sich als Söldner anwerben lässt, löst sich vom zivilen Leben, um sich ganz für den einzusetzen, der ihn angeworben hat. Der sportliche Wettkämpfer muss sich an die Regeln halten, wenn er gewinnen will. Andernfalls wird er disqualifiziert. Der Ackerbauer muss arbeiten und Geduld haben, bevor er Früchte ernten kann. – Wer dem Herrn dienen möchte, muss es von Herzen für Ihn tun, sich an die Anweisungen der Bibel halten und mit Geduld und Ausdauer arbeiten.
Gute und schlechte Arbeiter
Der Inhalt des Evangeliums, das Paulus verkündigt hatte, war eine Person. Es ist der auferstandene Erlöser, der als Nachkomme Davids auch einen Anspruch auf den Thron Gottes auf der Erde hat. Weil Paulus dieses gepredigt hatte, war er nun im Gefängnis. Aber dadurch war die Botschaft nicht gebunden. Andere übernahmen die Verkündigung. Paulus erduldete alle diese Leiden, damit das Evangelium weiter gefestigt und verbreitet wurde. Aber die sühnenden Leiden unseres Herrn am Kreuz waren nötig, damit überhaupt ein Evangelium gepredigt werden kann.
In den Versen 11-13 haben wir die Regierungswege Gottes, d.h. sein Handeln mit uns entsprechend unserer Verantwortung. Aber seine Regierungswege mit uns gehen nie gegen seine Vorsätze und seine Gnade. Das sagt Vers 13: «Er bleibt treu.» Welch ein Trost!
Eine Warnung an uns alle finden wir in Vers 14. Diskussionen über die Bibel führen nie zum Ziel. Sie nützen den Diskutierenden nichts und schaden den Zuhörern. Unsere Aufgabe ist es, das Wort der Wahrheit wie ein Arbeiter, der seinen Beruf beherrscht, recht zu teilen oder «in gerader Richtung zu schneiden». Es ist also wichtig, dass wir eine fundierte Kenntnis des Wortes Gottes und der Zusammenhänge in der Bibel haben. Dann werden wir in der Lage sein, ihre Botschaft klar verständlich weiterzugeben. – Wenn das Wort Gottes aber falsch geteilt wird, werden die Hörer verwirrt und in Zweifel gestürzt, so dass ihr Glaube ins Wanken gerät. Siehe das Beispiel in den Versen 16-18!
Gefässe zur Ehre und zur Unehre
Der Verfall des christlichen Zeugnisses in der Welt und die Untreue von uns Menschen sind gross. Wo finden wir Halt? Auf dem festen Grund Gottes. Er hat ein doppelseitiges Siegel. Auf der einen Seite steht: «Der Herr kennt die, die sein sind.» Auch wenn wir im Wirrwarr der Christenheit nicht immer wissen, ob jemand wirklich Leben aus Gott hat oder nicht, der Herr weiss es. Auf der Rückseite des Siegels steht: «Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit.» Das ist unsere persönliche Verantwortung. Jeder Glaubende wird zu einem Leben nach Gottes Willen aufgefordert und das bedeutet Trennung von jeder Art von Bösem.
Die Verse 20-22 zeichnen ein Bild der heutigen Situation in der Christenheit. Gläubige und Ungläubige leben nebeneinander. Alle nennen sich Christen. Wer in diesem grossen Haus zur Ehre und zum Nutzen des Hausherrn leben möchte, muss sich von den Gefässen zur Unehre absondern. Er darf mit denen zusammen einen gemeinsamen Glaubensweg gehen, die den Herrn ebenfalls aus reinem Herzen anrufen und in persönlicher Reinheit vorangehen wollen.
Streitfragen zu erörtern führt nur zu Streitigkeiten. Ein guter Knecht des Herrn soll nicht streiten, auch nicht mit Worten. Es wird unter den Gläubigen zwar immer wieder Konflikte geben. Da ist es wichtig, dass ein Diener des Herrn milde reagiert, das Wort gut kennt und die Widersacher in Sanftmut zurechtweist. Vielleicht schenkt es dann der Herr, dass solche, die verkehrt liegen, zur Einsicht und zur Umkehr kommen.
Verfall und Verführung
Was wir zu Beginn von Kapitel 3 finden, sind Merkmale unserer Tage. Die ab Vers 2 beschriebenen Menschen haben eine Form der Gottseligkeit, indem sie sich Christen nennen. Aber sie verleugnen deren Kraft, d.h. sie haben nicht Buße getan und sind nicht von neuem geboren. Es sind also dem Bekenntnis nach Christen – keine Juden, Moslems oder Heiden. Heute leben wir in einer Umgebung, in der Egoismus, Habsucht, Eigendünkel, Hochmut, Undankbarkeit normal sind. Man verachtet alles, was von Gott kommt. Ehe und Familie im biblischen Sinn betrachtet man als überholt. Wichtig sind die Selbstverwirklichung und das Vergnügen.
Wie soll sich da ein gläubiger Christ verhalten? «Von diesen wende dich weg.» Das bedeutet persönliche Trennung vom Bösen. Unsere Aufgabe als Kinder Gottes ist nicht, all das Unbiblische in der Welt anzuprangern und Moral zu predigen, sondern den Menschen das Evangelium zu bringen. Wir wollen ihnen den Heiland der Welt vorstellen, der auch ihr Erretter sein will. Aber nur ein Leben echter Gottesfurcht kann unseren Worten das nötige Gewicht geben.
In den Versen 6-9 werden verführerische Irrlehrer beschrieben, die heute viele Menschen betören. Ähnliches gab es schon zur Zeit Moses. Die Zauberer vor dem Pharao, die Mose widerstanden, versuchten das nachzuahmen, was Gott wirkte (2. Mose 7,10-13.22; 8,3). Die heutigen Irrlehrer kommen meistens auch mit der Bibel. Doch sie verdrehen die Worte Gottes. Der Herr wird ihre Verkehrtheit einmal offenbar machen.
Hilfsquellen für den Diener
Nach der Beschreibung der schweren Zeiten der letzten Tage folgt ein persönliches Wort des Apostels an Timotheus: «Du aber …» Das darf jeder von uns für sich nehmen.
Beachten wir die Reihenfolge in Vers 10! Die christliche Lehre, wie wir sie im Neuen Testament finden, ist die Grundlage für ein Gott wohlgefälliges Verhalten. Das Leben von Paulus war von Gottvertrauen, Langmut, Liebe und Geduld geprägt. Aber weil er seinem Herrn so treu nachfolgte und das Evangelium der Gnade freimütig verkündigte, wurde er vielerorts von Juden und Heiden verfolgt. Wie viele Leiden hat er für seinen Herrn erduldet! Je entschiedener wir unserem Herrn nachfolgen und nur für Ihn leben wollen, umso eher werden auch wir etwas von der Ablehnung und Verfolgung von Seiten der Menschen um uns her zu spüren bekommen.
Doch wir wollen nicht aufgeben, sondern dem Herrn und seinem Wort treu bleiben. Wie wichtig sind die Verse 15-17! Die Bibel, auf die wir uns stützen, ist kein gewöhnliches Buch. Alle 66 Bücher, aus denen die Bibel besteht, sind wörtlich von Gott inspiriert. Sein Wort ist absolut verlässlich.
Das geschriebene Wort Gottes zeigt uns den Weg zum Heil. Es weist uns auf den alleinigen Erlöser Jesus Christus hin. Und wer an Ihn glaubt, empfängt aus Gottes Wort Belehrung, Zurechtweisung und Unterweisung für seinen Glaubensweg. Die Bibel gibt Antwort auf alle Fragen und zeigt uns den richtigen Weg. Der Heilige Geist, der in jedem Glaubenden wohnt, schenkt täglich die Kraft, dem Wort zu gehorchen.
Vollführe den Dienst!
Der Apostel Paulus sah den Niedergang des christlichen Zeugnisses auf der Erde voraus. Der Verfall begann, als er noch lebte. Doch er wusste, dass sich der Zustand verschlimmern würde. Heute erleben wir die Realität von Vers 3. Es ist erschreckend, wie viele Ideen und Lehren in der Christenheit zirkulieren. Da gelten die Worte des Apostels an Timotheus auch uns. Er sollte in aller Nüchternheit das Wort Gottes predigen. Wenn er gläubige Zuhörer hatte, sollte das Wort zu ihrer geistlichen Auferbauung dienen, und wenn die Zuhörer noch ungläubig waren, durfte er ihnen das Evangelium, die herrliche Botschaft vom Heiland der Welt, weitersagen. Diese Doppelverantwortung haben auch wir. Vielleicht merken wir, dass Gläubige um uns her in Gefahr stehen, verführt zu werden und sich von der Wahrheit abzukehren. Dann gilt es zu überführen, vielleicht auch zurechtzuweisen und mit aller Langmut und Lehre zu ermahnen.
Paulus sieht in den Versen 6-8 seinen Märtyrertod vor sich. Sein Glaubenslauf ist beinahe zu Ende. Den Kampf des Glaubens hat er gekämpft, das Glaubensgut verteidigt und bewahrt. Er weiss, dass der Herr Jesus ihn am Richterstuhl mit der Krone der Gerechtigkeit belohnen wird. Aber nicht nur ihn. Die Krone der Gerechtigkeit ist die Anerkennung des Herrn für ein Leben, das Ihm wohlgefällt. Diese Belohnung liegt für jeden der Seinen bereit, der in Treue und Hingabe für Ihn gelebt hat. Spornt uns diese Krone nicht an, uns mehr für Ihn einzusetzen?
Der Herr bleibt treu!
Wie ergreifend sind die persönlichen Worte des Apostels an Timotheus, mit denen dieser Brief schliesst! Es war sein Herzenswunsch, ihn vor seinem Tod nochmals zu sehen. Weil der Winter bevorstand, bat er ihn, den Mantel mitzubringen, so dass er sich in der Gefängniszelle ein wenig gegen die Kälte schützen konnte (2. Timotheus 4,13.21). Auch die Bücher und Pergamente sollte er mitbringen. Ihr Inhalt war sicher zum Trost und zur Ermunterung des Herzens des Apostels.
Gott schenkte ihm auch Ermunterungen. Lukas harrte in diesen schweren Tagen bei ihm aus. Markus, der einst als Diener versagt hatte, war ihm jetzt nützlich zum Dienst.
Doch er musste kurz vor seinem Tod manches Schwere erleben. Demas, einer seiner Mitarbeiter, war von der Welt angezogen worden. Alexander war böse gegen ihn aufgetreten. Zu seiner ersten Gerichtsverhandlung begleitete ihn keiner der Glaubensbrüder. Schämten sie sich oder hatten sie Angst?
Aber er durfte den Beistand und die Hilfe seines Herrn erfahren. Er bekam sogar eine Gelegenheit, vor dem kaiserlichen Gericht das Evangelium zu verkündigen. Er verteidigte sich nicht, sondern stellte jenen hochrangigen Römern den Herrn Jesus als Heiland vor. Mit dem Rachen des Löwen, aus dem er gerettet wurde, ist sicher die Gewalt des Kaisers gemeint. Doch Paulus erwartete keine Errettung mehr aus den Umständen. Er schaute vorwärts ans Ziel. Die Zurückbleibenden vertraute er der Gnade des Herrn an (Vers 22).
Einleitung
Obwohl Jesus Christus als rechtmässiger König zu seinem Volk kommt, wird Er abgelehnt. Trotzdem wirkt Er in Israel weiter. Er belehrt seine Jünger über das Reich der Himmel und die zukünftige Gerichtszeit. Schliesslich wird Er gefangen genommen und zum Tod verurteilt. Er leidet und stirbt am Kreuz. Am dritten Tag wird Er auferweckt. Bevor Er in den Himmel zurückkehrt, verspricht Er seinen Jüngern: «Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.»
Kapitel 13 – 20: Der abgelehnte König dient weiter.
Kapitel 21 – 25: Der König wirkt in Jerusalem.
Kapitel 26 – 28: Der König vollendet seinen Dienst.
Kapitel 21 – 25: Der König dient in Jerusalem
Kapitel 26 – 28: Der König vollendet seinen Dienst
Der Sämann sät das Wort
Nachdem die Kapitel 11 und 12 erwiesen hatten, dass Jesus Christus von seinem Volk verworfen war, ging Er nun aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Mit dieser Handlung machte Er deutlich, dass Er ab sofort eine neue Stellung einnahm. Er stellte sich nicht mehr als König Israels vor, sondern war nur noch der Herr seiner Jünger. Alle, die Ihm nachfolgten und Ihn als Herrn anerkannten, befanden sich in seinem Reich und unter seiner Herrschaft. Die Volkszugehörigkeit spielte dabei keine Rolle mehr. Darum beschränkte sich sein Dienst nicht mehr auf Israel (= Haus), sondern richtete sich an alle Menschen (= See).
Eine weitere Veränderung zeigt uns das Gleichnis vom Sämann. Der Herr fordert nicht mehr Frucht vom Volk Israel, sondern streut den Samen des Wortes Gottes aus, damit im Leben derer, die das Wort hören und aufnehmen, Frucht für Gott entstehe. Auch in diesem Punkt hat seine Verwerfung die Wende herbeigeführt. Das Kommen des Herrn Jesus in Gnade war die letzte göttliche Erprobung des Menschen. Wie würde er auf die Gnade reagieren? Wir wissen es: Er lehnte sie bewusst ab! Seine ganze Verdorbenheit kam ans Licht. Der letzte Beweis war erbracht, dass im Menschen gar nichts Gutes steckt. Darum verlangt Gott nichts mehr von ihm. Anstatt zu fordern, wirkt der Herr nun selbst durch das Wort die Frucht, die Gott gefällt. Beim Ausstreuen des Wortes trifft Er verschiedene Herzenszustände an, die uns durch die vier Böden vorgestellt werden. Welche Wirkung das Wort in den jeweiligen Herzen hervorbringt, erklärt der Herr in den Versen 18-23.
Warum redet der Herr in Gleichnissen?
Die Jünger verstanden nicht, warum Jesus Christus in Gleichnissen zum Volk redete. Deshalb fragten sie Ihn danach. Auch wir dürfen Ihm unsere Fragen stellen, wenn wir beim Lesen der Bibel etwas nicht verstehen.
In seiner Antwort machte der Herr eine Unterscheidung zwischen der ungläubigen Masse des Volkes und den Jüngern, die an Ihn glaubten:
- Die Vielen, die Christus nicht annahmen, sollten seine bildhafte Rede nicht verstehen. Damit traf sie ein göttliches Gericht, das Jesaja bereits vorausgesagt hatte. Weil sie den Messias im Unglauben verwarfen, verloren sie auch alle Vorrechte, die sie als irdisches Volk Gottes besassen (Vers 12).
- Die Jünger hingegen sollten die Gleichnisse verstehen. Der Herr nahm sich in unserem Kapitel zweimal Zeit, um ihnen diese Bilder zu erklären (Matthäus 13,18-23.36-43). Weil sie Christus im Glauben angenommen hatten, gab Gott ihnen noch mehr: Sie empfingen den überfliessenden Segen des Reichs (Vers 12).
Die «Geheimnisse des Reichs der Himmel» (Vers 11) betreffen die neue Zeit, in der das Reich Gottes nach der Rückkehr des Königs in den Himmel in einer verborgenen Weise auf der Erde weiter bestehen wird. Es ist die christliche Zeit, die im Alten Testament prophetisch nicht erwähnt wird.
Viele Gläubige des Alten Testaments hatten gehofft, den angekündigten Messias zu sehen und zu hören. Die Jünger waren nun die Glücklichen, die sein Kommen miterlebten.
Die Erklärung zum Gleichnis vom Sämann
Der festgetretene Boden illustriert ein hartes Herz, das sich der göttlichen Botschaft bewusst verschliesst. Hier hat der Feind ein leichtes Spiel. Weil das Wort nicht eindringen kann, nimmt er es weg. Darum bringt es weder eine Wirkung noch Frucht für Gott hervor.
Der steinige Boden spricht von einem schwachen Herzen. Weil das Gefühl oder der Verstand vom Wort Gottes angesprochen sind, wird die Botschaft mit Freuden aufgenommen. Man möchte gern dem Herrn Jesus nachfolgen, ist aber nicht bereit, Buße zu tun. Weil das Gewissen nicht tätig wird, ist die Wirkung nur oberflächlich und vorübergehend. Sobald Probleme auftauchen, gibt man auf.
Der dornige Boden beschreibt ein geteiltes Herz. Man hört das Wort und schenkt ihm eine gewisse Aufmerksamkeit. Aber es wird von den Sorgen der Welt und dem Betrug des Reichtums verdrängt. So vieles erscheint einem wichtiger als die göttliche Botschaft. Deshalb entsteht keine Frucht.
Der gute Boden veranschaulicht ein aufrichtiges Herz, das den Samen des Wortes Gottes bereitwillig aufnimmt. Man will es verstehen und verwirklichen. Bei diesem inneren Zustand kann das Wort eine Wirkung im Leben erzielen und Frucht für Gott bringen.
Bei der Verkündigung des Wortes Gottes hat der Herr damals diese unterschiedlichen Herzenszustände angetroffen. Nicht alle nahmen seine Botschaft an. Das ist heute auch so. Wir müssen deshalb nicht enttäuscht sein, wenn unsere Bemühungen nur wenig Frucht bringen.
Das Unkraut im Acker
In den Versen 24-43 zeigt der Herr Jesus durch drei Gleichnisse, wie sich das Reich der Himmel während seiner Abwesenheit unter der Verantwortung des Menschen entwickelt. In dieser Zeit regiert Er indirekt vom Himmel her, indem Er im Herzen und Leben seiner Jünger Herr sein will. Sie sind aufgefordert, seine Rechte über ihr Leben anzuerkennen und Ihm zu gehorchen. Wie werden sie diesem Auftrag entsprechen?
Im Gleichnis vom Unkraut im Acker ist Jesus Christus wieder der Sämann. Nachdem Er in den Himmel gegangen ist, lässt Er Gottes Wort (= guter Same) durch seine Diener in der Welt (= Acker) verkünden. Leider sind die Menschen in seinem Reich geistlich eingeschlafen. Anstatt mit wachem Herzen auf die Rückkehr des Herrn zu warten, haben sie sich innerlich von Ihm distanziert. Der Teufel hat dies ausgenutzt und in der Christenheit Unkraut gesät. Durch falsche Lehren sind Menschen zum Christentum gekommen (blosse Bekenner), die kein Leben aus Gott besitzen. So ist durch menschliches Versagen eine Vermischung zwischen Gut und Böse, zwischen echten und unechten Jüngern entstanden.
Die Knechte wollten das Unkraut ausreissen. Aber weil es wie Weizen aussah, bestand die Gefahr, dass sie auch die gute Frucht ausrauften. Genauso ist es heute. Leider ist nicht mehr deutlich sichtbar, wer ein wiedergeborener Christ ist und wer sich nur dem Namen nach zu Christus bekennt. Erst am Ende der christlichen Zeit kommt es zu einer klaren Unterscheidung, wenn der Weizen in die Scheune gesammelt werden wird.
Das Senfkorn und der Sauerteig
Das Gleichnis vom Senfkorn beschreibt, wie sich das Christentum auf der Erde ausgebreitet hat. Nach der Himmelfahrt des Herrn befand sich nur eine geringe Zahl von Glaubenden in Jerusalem. Sie sind ein Bild dieses kleinen Senfkorns, das ein Mensch auf seinen Acker säte. Doch das, was am Anfang unscheinbar und klein war, entwickelte sich äusserlich zu einer Weltreligion. Die Christen gaben ihren Charakter als Fremde auf und nahmen bald eine einflussreiche Stellung in der Welt ein. Als Folge davon kamen Vögel und liessen sich in den Zweigen dieses Baumes nieder. Das spricht davon, dass viel Ungutes in die Christenheit Eingang fand.
Das Gleichnis vom Sauerteig zeigt die innere Entwicklung der Christenheit unter der Verantwortung des Menschen. Sauerteig ist in der Bibel immer ein Bild vom Bösen (siehe Matthäus 16,12; 1. Korinther 5,6; Galater 5,9). Hier spricht er von den bösen Lehren, die das christliche Bekenntnis so durchdrungen haben, dass sie die ganze Masse kennzeichnen. Weil wir die Christenheit nicht verlassen können, sind wir persönlich angesprochen, uns von allem Bösen zu trennen (2. Timotheus 2,19).
In den Versen 36-43 erklärt der Herr das Gleichnis vom Unkraut im Acker und macht noch zusätzliche Ausführungen über das zukünftige Los der echten und unechten Jünger. Vor der öffentlichen Aufrichtung des Reichs werden die Ungläubigen daraus entfernt und gerichtet werden. Die Gerechten hingegen werden im himmlischen Teil des Reichs einen herrlichen Platz einnehmen.
Der Schatz, die Perle und das Netz
Die drei Gleichnisse in unserem Abschnitt stellen uns das vor, was für Gott im Reich der Himmel wertvoll ist. Wenn wir als Glaubende die negative Entwicklung in der Christenheit auch nicht aufhalten können, so wollen wir uns mit Christus an dem freuen, was in dieser Zeit kostbar für Ihn ist.
Das Gleichnis vom Schatz im Acker beschreibt, wie der Herr Jesus den Menschen, die im Reich der Himmel persönlich an Ihn glauben, einen hohen Wert beimisst. Aus Freude über diesen Schatz ging Er ans Kreuz und verkaufte dort alles, was Er hatte, um sich als Mensch ein Anrecht auf die Welt zu erwerben. Seither besitzt Er eine Machtbefugnis über alle Menschen auf der Erde, denn Er hat sie erkauft. Aber die Glaubenden hat Er erlöst, sie bilden den Schatz, an dem Er sich freut.
Die sehr kostbare Perle spricht von der Versammlung Gottes. Weil Jesus Christus, der Kaufmann, ihren unermesslichen Wert kannte, ging Er in den Tod, um sie für sich zu erwerben. Seit Pfingsten wird die Versammlung aus allen gebildet, die an das Evangelium der Gnade glauben. Der Herr wird sie in der Zukunft sich selbst in ihrer ganzen Schönheit darstellen (Epheser 5,27).
Das Gleichnis vom Netz und den Fischen illustriert die Arbeit im Evangelium. Die Menschenfischer verkünden diese gute Botschaft, so dass viele Leute zu Jesus Christus kommen. Aber nicht alle bekehren sich. Darum sollen sich die Mitarbeiter anschliessend mit den «guten Fischen» beschäftigen, d.h. mit solchen, die sich echt bekehrt haben.
Jesus Christus in seiner Vaterstadt
Nachdem der Herr seinen Jüngern anhand der sieben Gleichnisse die neue Zeitepoche des Reichs vorgestellt hatte, fragte Er sie: «Habt ihr dies alles verstanden?» Diese Frage stellt Er auch uns, denn vom Verständnis der göttlichen Gedanken über die jetzige Form seines Reichs hängt unser Verhalten im Alltag ab.
Damit wir dieses Thema gut verstehen, müssen wir sowohl die «alten» Informationen der Propheten als auch die «neuen» Mitteilungen des Herrn Jesus über das Reich kennen. Beides zusammen bildet den Schatz, den wir in unseren Herzen bewahren und anderen weitergeben sollen.
Dann zog sich Jesus zurück und kam in seine Vaterstadt. Er wirkte weiter unter dem Volk, indem Er in ihrer Synagoge lehrte und Wunder tat. Doch die Leute von Nazareth sahen in Ihm nur den Sohn des Zimmermanns. Ihre Wahrnehmung ging nicht über die natürlichen Beziehungen hinaus. Obwohl sie seine ausserordentliche Weisheit und Macht anerkennen mussten, wollten sie Ihn nicht als den von Gott gekommenen Messias annehmen. So entlarvten die vielen Fragen ihren Unglauben. Anstatt sich darüber zu freuen, dass der Herr Jesus in Gnade unter ihnen tätig war, ärgerten sie sich an Ihm.
Auch die Verachtung durch seine nächsten Volksgenossen ertrug der Heiland geduldig. Er erlebte, was viele Propheten vor Ihm schon erfahren hatten: In seiner Vaterstadt wird ein Prophet nicht geehrt. Ihr Unglaube hatte Folgen für diese Menschen: Zu ihrem eigenen Verlust wirkte Jesus in Nazareth nicht viele Wunder.
Johannes der Täufer wird getötet
Der Herr Jesus führte seinen Dienst in Israel fort, obwohl Er verworfen war und seine Jünger über die neue Zeit unterrichtet hatte (Matthäus 13). Noch war Er als Messias da und offenbarte Gottes Gnade. Als Herodes von den Wunderwerken Jesu hörte, erwachte sein Gewissen. Weil er keine Beziehung zu Gott hatte, war er abergläubisch und meinte, Johannes der Täufer sei von den Toten auferstanden und wirke jetzt in Israel.
Der Geist Gottes berichtet uns nun, wie es zum Tod des Vorläufers des Herrn gekommen war. Dabei wird das Verhalten verschiedener Personen ins göttliche Licht gestellt:
- Johannes der Täufer steht als treuer Zeuge vor uns. Er nahm keine Rücksicht auf sein Leben und redete, ohne die Person anzusehen. Er hielt dem König seine Sünde genauso vor wie den Zöllnern oder Soldaten (Lukas 3,12-14).
- Herodias war die treibende Kraft des Bösen. In ihrem Hass wartete sie auf eine Gelegenheit, da sie Johannes beseitigen konnte. Skrupellos verlangte sie am Geburtstag des Königs durch ihre Tochter das Haupt des gefangenen Propheten auf einer Schale.
- Herodes war nicht völlig gegen Johannes eingestellt. Er liess ihn zwar verhaften, hörte ihn aber gern. Seine Botschaft nahm er jedoch nicht an. In seinen Handlungen liess er sich von der Gunst des Volkes und seinen eigenen Begierden leiten, so dass er schliesslich wegen eines falschen Ehrgefühls den Propheten töten liess. Diese schreckliche Tat war die Folge eines sündigen Weges, den er nicht verlassen wollte.
Die Speisung der 5000
Jesus empfand den Tod von Johannes zutiefst. Er wusste: Wenn sie seinen Vorläufer ablehnten und töteten, würden sie auch Ihn verwerfen und kreuzigen. Darum zog Er sich vom Volk zurück und suchte in der Einsamkeit die Gemeinschaft mit seinem Gott, die Er jeden Moment seines Lebens völlig genoss.
Als viele Leute zu Ihm kamen, wurde Er innerlich bewegt über sie, weil Er ihre grossen Bedürfnisse sah. Er offenbarte sich nun als Der, der die Armen mit Brot sättigt (Psalm 132,15). Das war ein weiterer Hinweis, dass Er als Messias in Gnade unter dem Volk Israel anwesend war. Die Volksmenge bewunderte zwar seine Macht und Güte, nahm Ihn aber nicht im Glauben an.
Mit diesem Wunder wollte der Herr auch seinen Jüngern eine Lektion erteilen. Konkret forderte Er sie auf: «Gebt ihr ihnen zu essen.» In ihrem Kleinglauben blickten sie zuerst auf sich selbst und auf ihre Möglichkeiten. So kamen sie zum Schluss: «Wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische.» Doch gerade dieses Wenige, das sie besassen, wollte der Herr zum Segen von weit mehr als 5000 Menschen gebrauchen. Darum sagte Er: «Bringt sie mir her.» Nach einem Dankgebet vermehrte Er die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie diese Nahrung an die Leute verteilten. So erlebten sie, wie alle davon assen und satt wurden.
Genauso will der Herr heute durch seine Diener die Glaubenden mit geistlicher Nahrung versorgen. Wenn wir Ihm das Wenige, das wir haben, bringen, kann Er es zum Segen seines Volkes einsetzen.
Jesus wandelt auf dem See
Diese Schifffahrt der Jünger illustriert eindrücklich die Erfahrungen, die die Glaubenden in der Zeit der Abwesenheit ihres Herrn auf der Erde machen. Nachdem Jesus die Volksmenge entlassen hatte, stieg Er auf den Berg, um zu beten. Das spricht davon, dass Er in den Himmel zurückgekehrt ist und sich dort für die Seinen verwendet. Diese erleben auf dem Weg der Jüngerschaft manche Schwierigkeiten, die durch die Wellen und den Gegenwind angedeutet werden. Doch der Herr Jesus überlässt sie nicht ihrem Schicksal. Er kommt zu ihnen in ihre Probleme hinein und macht ihnen durch seine Gegenwart und seine Worte Mut.
Das Handeln von Petrus zeigt uns den Charakter der christlichen Zeit und das Ziel jeder Glaubensprüfung:
- Die ersten Christen befanden sich noch im jüdischen Boot, denn sie hielten sich täglich im Tempel auf. Doch schon bald wurden sie aufgefordert: «Lasst uns zu ihm hinausgehen, ausserhalb des Lagers, seine Schmach tragend» (Hebräer 13,13). Sie mussten das Judentum verlassen und sich im Glauben um einen unsichtbaren Herrn versammeln.
- Petrus wollte auf den Wassern zu Jesus Christus gehen. Das spricht von unserem Glaubensleben. Durch die Schwierigkeiten im Leben kommen wir dem Herrn innerlich immer näher.
Verse 32-36: Wenn Christus in der Zukunft in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, wird für den glaubenden Überrest die Not aufhören und für die Erde eine herrliche Segenszeit beginnen.
Jüdische Überlieferungen
Die Pharisäer und Schriftgelehrten griffen den Herrn Jesus an, weil seine Jünger die Überlieferung der Ältesten nicht beachteten. Der Heiland nahm dies zum Anlass, um das heuchlerische Verhalten der religiösen Juden anzuprangern.
Die Schriftgelehrten hatten neben dem Gesetz viele zusätzliche Vorschriften aufgestellt, die ein Jude beachten musste. Diese Anordnungen betrafen vor allem Äusserlichkeiten und widersprachen in ihren Auswirkungen oft den Geboten Gottes. Das machte der Herr an einem Beispiel deutlich. Gott hatte geboten: «Ehre den Vater und die Mutter!» Die jüdischen Überlieferungen aber sagten: Du kannst das, was du den Eltern schuldest, Gott opfern, dann bist du viel frömmer! Aber eine solche Verehrung, die das Gebot Gottes ungültig macht, findet nie seine Anerkennung.
Ab Vers 10 behandelt Jesus Christus das Thema der Verunreinigung. Nicht das, was beim Essen in den Menschen hineingeht, sondern das, was aus ihm herauskommt, beschmutzt ihn. Es ist also nicht die Umgebung, die den Menschen böse macht, sondern sein verdorbenes Herz. Aus dieser schlechten Quelle entstehen falsche Gedanken, böse Worte und sündige Taten, die den Menschen verunreinigen.
Wir lernen aus diesem Abschnitt zweierlei:
- Lassen wir uns nicht von Traditionen und Menschengeboten, sondern allein vom Wort Gottes leiten.
- Achten wir auf unser Herz und verurteilen wir jede Regung der alten Natur, damit wir nicht in Sünde fallen und uns dadurch beschmutzen.
Die kananäische Frau
Nachdem Jesus die Heuchelei der jüdischen Religion verurteilt hatte, distanzierte Er sich auch äusserlich davon, indem Er sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurückzog.
Dort begegnete Ihm eine kananäische Frau, deren Tochter schlimm besessen war. Sie gehörte zu den Menschen, denen die Israeliten beim Einzug in das Land keine Gnade entgegenbringen durften (5. Mose 7,1.2). Weil sie sich vom Heiland Hilfe für ihre Tochter erhoffte, sprach sie Ihn mit «Herr, Sohn Davids» an. Doch der Herr antwortete ihr nicht, weil sie als Kanaaniterin kein Anrecht am Sohn Davids hatte. Als Messias war Er nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gekommen. Im Lauf des Gesprächs offenbarte die Frau dann zwei positive Eigenschaften:
- Sie fiel demütig vor Ihm nieder und akzeptierte mit den Worten «Ja, Herr!», dass sie keinen Anspruch auf die Segnungen Israels stellen konnte.
- Sie vertraute auf die Gnade Gottes, die sich in Jesus Christus nicht auf das Volk Israel beschränken würde.
Wenn wir mit dieser Einstellung zum Herrn Jesus kommen und Ihn um Hilfe in unseren Schwierigkeiten bitten, wird Er uns nicht im Stich lassen.
Bei dieser Frau zeichnete Er wie einst beim römischen Hauptmann den grossen Glauben aus (Matthäus 8,10). Beide waren Heiden und hatten keine äussere Beziehung zu Gott. Aber in ihren Herzen war echter Glaube an Ihn vorhanden. Darum erfuhren sie, wie der Herr ihrer Bitte entsprach und ihnen half.
Die Speisung der 4000
Jesus kehrte wieder nach Galiläa zurück und war trotz seiner Verwerfung weiter für sein Volk da. Jeder, der krank war oder ein körperliches Gebrechen hatte, konnte zu Ihm kommen und wurde von Ihm geheilt. So kam es zu einer ersten Teilerfüllung der Prophezeiung Hesekiels: «Siehe, ich bin da, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen» (Hesekiel 34,11). Die Leute verwunderten sich über die Wunderheilungen des Herrn und verherrlichten den Gott Israels. So fiel durch den Dienst von Christus jede Ehre auf Gott, der Ihn dazu in die Welt gesandt hatte (Johannes 7,18).
Dem Herrn Jesus lag nicht nur die Ehre Gottes, sondern auch das Wohl der Menschen am Herzen. Darum wollte Er sie nicht hungrig entlassen. Wie bereits in Matthäus 14 bezog Er die Jünger mit ein. Zuerst offenbarte Er ihnen sein Mitgefühl für die hungernde Volksmenge. Sein Beispiel sollte sie anspornen, ein offenes Auge für die Nöte und Bedürfnisse ihrer Mitmenschen zu haben. Dann nahm Er die sieben Brote und die Fische, dankte seinem Gott für dieses Essen und liess es durch die Jünger an die Volksmenge verteilen.
Nachdem alle satt geworden waren, hoben sie sieben Körbe voll Brocken auf. So ist es immer, wenn der Herr austeilt. Er gibt mehr als genug. – Daraus entnehmen wir eine praktische Lektion für unsere täglichen Mahlzeiten: Wir werfen das Essen, das übrig bleibt, nicht gedankenlos weg. Gott hat es uns gegeben, darum heben wir die Reste auf und essen sie zu einem späteren Zeitpunkt.
Der Unglaube der Pharisäer und Sadduzäer
Die Pharisäer und Sadduzäer waren nicht dabei, als Jesus Christus unter dem Volk in Galiläa Wunder gewirkt hatte. Wahrscheinlich hatten sie aber davon gehört und kamen nun zu Ihm, um Ihn zu versuchen. Ohne persönliche Bedürfnisse und ohne Glauben forderten sie von Ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Doch der Herr ging nicht darauf ein, sondern stellte ihren Unglauben bloss. Die Anzeichen des Wetters konnten sie beurteilen. Aber trotz all dem, was Er bis anhin gewirkt hatte, wollten sie nicht glauben, dass Er der von Gott gesandte Messias war. Darum erinnerte Er sie nur an das Zeichen Jonas – ein Hinweis auf seinen Tod und seine Auferstehung – und verliess sie.
Als der Herr mit seinen Jüngern allein war, warnte Er sie vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Doch die Jünger waren mit einem anderen Problem beschäftigt: Sie hatten nichts zu essen mitgenommen. Aus diesem Grund verstanden sie seine Erklärungen zuerst nicht.
Im Gegensatz zu den hochgestellten Juden waren die Jünger aber nicht ungläubig, sondern kleingläubig. Darum bemühte sich der Herr Jesus um sie:
- Er erinnerte sie an die beiden Wunder zur Speisung der Volksmenge. Wenn Er damals so viele Menschen ernährt hatte, konnte Er auch jetzt seine Jünger versorgen.
- Er warnte sie vor der bösen Lehre der Pharisäer, die dem Wort Gottes eigene Gedanken hinzufügten, und vor der falschen Lehre der Sadduzäer, die gewisse Teile des Wortes wegnahmen.
Die Versammlung und das Reich Gottes
Im Matthäus-Evangelium kommt sowohl die «Versammlung» als auch das «Reich» Gottes vor. Diese beiden Begriffe beinhalten nicht dasselbe. Worin liegen die Unterschiede?
|
Versammlung Gottes |
Reich Gottes |
|
Die Versammlung Gottes hat ein himmlisches Ziel. Sie wird auf der Erde gebildet, verbringt die Ewigkeit jedoch im Himmel. |
Das Reich Gottes bezeichnet den Herrschaftsbereich auf der Erde, in dem die göttlichen Rechte gelten und anerkannt werden sollten. |
|
Zur Versammlung Gottes gehören alle Erlösten der Gnadenzeit. Sie haben eine lebendige Glaubensbeziehung zu Christus. |
Im Reich Gottes befinden sich alle Menschen, die sich äusserlich zum Herrn Jesus stellen. Ihr Bekenntnis kann echt oder unecht sein. |
|
Der Herr Jesus ist das Haupt des Leibes, der Versammlung. Von Ihm geht jedes Wachstum und jeder Segen aus. |
Im Reich Gottes macht Jesus Christus als Herr seine Autorität geltend. |
|
Die Versammlung gehört zum Geheimnis Gottes, weil sie zur Zeit des Alten Testaments noch nicht bekannt war. |
Das Reich Gottes wird im Alten Testament an vielen Stellen angekündigt und ist Bestandteil der Prophetie. |
Der Sohn Gottes und die Versammlung
Der Herr Jesus stellte seinen Jüngern zwei Fragen:
- Wer sagen die Menschen, dass Ich sei? Die Antworten darauf zeigen, wie vielfältig und menschlich die Überlegungen der Leute waren. Sie bildeten sich eine Meinung über Ihn, ohne an Ihn zu glauben. Doch damit blieben sie ohne Beziehung zu Ihm.
- Wer sagt ihr, dass Ich sei? Wie schön ist die persönliche Antwort von Petrus: «Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.» Petrus hatte sich nicht eine eigene Meinung über Jesus gemacht, sondern an die Offenbarung des Vaters über den Sohn geglaubt. So war Petrus ein glücklicher Mensch, der eine lebendige Beziehung zu Christus hatte.
In Vers 18 spricht der Herr zum ersten Mal von der Versammlung Gottes, die an Pfingsten durch das Kommen des Geistes entstanden ist und seither von Jesus Christus gebaut wird. Der ewige Sohn Gottes ist der Fels oder die Grundlage dieses geistlichen Hauses. Das gibt der Versammlung eine Sicherheit, die selbst Satan nicht antasten kann. Die Bausteine dieses Hauses sind alle Menschen, die wie Petrus in der Zeit der Gnade an den Herrn Jesus glauben.
In Vers 19 vertraute der Herr seinem Jünger Petrus die Schlüssel des Reichs der Himmel an, d.h. Er gab ihm die Autorität, Menschen in den christlichen Bereich einzulassen oder davon auszuschliessen. In der Apostelgeschichte benutzte Petrus diese Schlüssel, um sowohl Juden als Heiden die Tür zum Reich der Himmel zu öffnen.
Die Folgen seiner Ablehnung für die Jünger
In Vers 21 spricht der Herr zu seinen Jüngern ganz offen von seiner totalen Verwerfung. Er würde in Jerusalem von der jüdischen Führerschaft nach vielen Leiden getötet werden. Aber mit der Ankündigung seiner Auferstehung deutete Er die neue Zeitepoche an, in der die Versammlung gebildet wird. Die endgültige Ablehnung von Jesus Christus durch sein irdisches Volk machte es einerseits unmöglich, dass die Verheissungen an Israel sogleich in Erfüllung gehen konnten. Anderseits versetzte sie seine Jünger in eine neue Situation: Wenn ihr Meister verworfen war, würden auch sie Spott, Verachtung und Ablehnung erfahren.
Diese Veränderung wollte Petrus nicht so ohne Weiteres hinnehmen. Aber der Herr musste ihm klarmachen, dass der Weg ans Kreuz und in den Tod dem Willen Gottes entsprach. Wenn sein Jünger Ihn auf diesem Weg des Gehorsams aufhalten wollte, war er ein Werkzeug Satans, der schon in der Wüste den Herrn vom Weg Gottes abbringen wollte.
In Vers 24 stellt der Herr Jesus die beiden grossen Aspekte der Jüngerschaft während der Zeit seiner Verwerfung vor: Es gilt, sich selbst zu verleugnen und die Schmach der Welt zu tragen. Wer bereit ist, diesen Verzicht auf sich zu nehmen, wird jetzt ein glückliches, erfülltes Leben haben (Vers 25) und in der Zukunft einen Lohn empfangen (Vers 27). Beneiden wir nicht die Ungläubigen, die für sich selbst leben und in der Welt vieles erreichen! Sie werden ewig verloren gehen, weil sie sich nie um das Heil ihrer Seele gekümmert haben (Vers 26).
Die Herrlichkeit auf dem Berg
Der Herr hatte im vorherigen Abschnitt die Bedingungen für Jüngerschaft genannt. Da sie nicht leicht sind, machte Er nun Petrus, Jakobus und Johannes durch eine Vorausschau auf die zukünftige Herrlichkeit seines Reichs Mut, Ihm konsequent nachzufolgen. Diese Szene auf dem hohen Berg spornt auch uns an: Wir sind Jünger eines Herrn, der einmal auf der Erde alle Macht und Herrlichkeit besitzen wird. Darum wollen wir uns auch in der Zeit seiner Verwerfung zu Ihm stellen.
Jesus Christus wurde vor seinen Jüngern verwandelt. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Das deutet darauf hin, dass Er im Tausendjährigen Reich als grosser König die zentrale Person sein wird. Dann erschienen Mose, der Gesetzgeber, und Elia, der Prophet. Sie beide werden auch am Friedensreich teilnehmen. Doch dieses Reich wird nicht auf der Grundlage des Gesetzes oder der Propheten aufgerichtet werden. Darum mussten diese beiden wichtigen Personen des Alten Testaments wieder verschwinden. Keinesfalls durften sie mit dem geliebten Sohn des Vaters, der sein ganzes Wohlgefallen besitzt, auf eine Stufe gestellt werden. Denn nur Er, der Sohn Gottes, hat durch seinen Tod am Kreuz die Voraussetzung geschaffen, damit alle Pläne Gottes im Blick auf sein Reich in Erfüllung gehen können.
Diese Szene belehrt uns, dass die Zeit des Gesetzes und der Propheten abgelaufen war. Der Sohn war nun da und würde nach seiner Auferstehung eine neue Epoche einführen, in der die Glaubenden Gott als Vater kennen. Es ist die Zeit der Gnade, in der wir leben.
Das Elend auf der Erde
Was die drei Jünger auf dem Berg erlebt hatten, mussten sie noch eine Weile für sich behalten. Erst durch den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus waren die Voraussetzungen geschaffen, dass das zukünftige Reich Wirklichkeit werden konnte. So erwähnt Petrus in seinem zweiten Brief dieses Erlebnis auf dem heiligen Berg, um unseren Glauben auf das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit zu befestigen (2. Petrus 1,16-19).
Auf dem Weg vom Berg hinunter beschäftigte die Jünger eine Frage: Wer war der angekündigte Elia, der als Vorläufer des Messias vor Ihm kommen musste (Maleachi 3,23.24)? Die Antwort des Herrn macht deutlich, dass die volle Verwirklichung dieser Prophezeiung noch zukünftig ist. Johannes der Täufer war zwar eine Teilerfüllung von Elia, aber es wird nochmals ein Wegbereiter kommen, der die Ankunft von Christus in Macht und Herrlichkeit vorbereiten wird.
Sobald sie unten ankamen, trat ein Vater mit seiner Not zu Jesus: Sein Sohn war von einem Dämon besessen. Die Jünger konnten ihn nicht heilen, obwohl sie die Macht dazu besassen (Matthäus 10,1). Der Heiland musste ihnen zuerst ihren Mangel an Glauben vorhalten. Doch dann heilte Er in seiner Barmherzigkeit den Jungen. Die Verse 20 und 21 zeigen uns, wie wir heute die Macht und Gnade des Herrn zur Errettung unserer Kinder in Anspruch nehmen können: im schlichten Glauben an Gott, der alles kann. Dieses Vertrauen drücken wir in einem intensiven Gebet zu Gott aus und verzichten dabei auf persönliche Wünsche, die uns zustehen.
Die Tempelsteuer
In den Versen 22 und 23 teilt Jesus Christus seinen Jüngern zum dritten Mal mit, was mit Ihm in Jerusalem geschehen würde (siehe Matthäus 16,21; 17,12). Statt als König die Herrschaft über Israel anzutreten, würde Er getötet werden. Der Unglaube im Volk war so gross, dass sein Reich nicht öffentlich aufgerichtet werden konnte. Er musste sterben und auferstehen, damit Er auf der Grundlage seines Erlösungswerks in der Zukunft eine neue Beziehung zu Israel eingehen kann. Durch diese Mitteilung wurden die Jünger sehr betrübt, denn sie hofften, dass Christus sein Volk vom römischen Joch erlösen würde (Lukas 24,21).
Die Begebenheit ab Vers 24 macht deutlich, dass diese Hoffnung sich noch nicht erfüllen sollte. Als Petrus gefragt wurde, ob sein Herr die Tempelsteuer bezahle, antwortete er ohne zu überlegen mit Ja. Er dachte, Jesus würde als guter Israelit seinen Verpflichtungen bestimmt nachkommen. Doch der Herr stellte mit seiner Frage die Angelegenheit ins richtige Licht. Er als König und seine Jünger als Söhne des Reichs wären eigentlich von jeder Steuer befreit. Aber weil Er verworfen war und seine Jünger mit Ihm, mussten sie wie Ausländer Zoll und Steuer zahlen. Petrus sollte deshalb mit dem Geldstück, das er im Maul des gefangenen Fisches finden würde, die geforderte Steuer für Jesus Christus und für sich selbst begleichen.
Auch wir sind als Jünger des Herrn Fremde auf der Erde. Mit seiner Hilfe sollen wir unseren Verpflichtungen gegenüber dem Staat nachkommen (Römer 13,7).
Unterweisungen über Kinder
Als die Jünger den Herrn Jesus fragten, wer wohl der Grösste im Reich der Himmel sei, bekamen sie eine doppelte Antwort:
- Jeder Mensch muss wie ein Kind werden, wenn er überhaupt ins Reich eingehen will (Vers 3). Nur wer zu Gott umkehrt und sich vor Ihm demütigt, bekommt neues Leben und hat damit teil am Reich.
- Echte Grösse im Reich Gottes ist eine demütige und gnädige Einstellung (Matthäus 18,4.5). Wer diese Gesinnung in seinem Verhalten offenbart, gleicht Jesus Christus.
In den Versen 6-9 warnt der Herr uns vor zwei Gefahren:
- Wir sollen denen, die noch jung im Glauben sind und die Bibel nicht so gut kennen, keinen Anstoss geben. Durch ein schlechtes Beispiel oder durch falsche Belehrung können sie leicht zu Fall kommen.
- Wir sollen bei uns selbst jede schlechte Handlung (= Hand), jeden falschen Weg (= Fuss) und jedes böse Begehren (= Auge) konsequent verurteilen. Dieses Selbstgericht ist bei uns Glaubenden so wichtig, weil die Ungläubigen wegen dieser Sünden, die sie nie verurteilt haben, ins ewige Gericht kommen.
Ab Vers 10 spricht der Herr Jesus wieder über die kleinen Kinder. Wir sollen sie nicht verachten, weil sie für Gott sehr wertvoll sind. Auch Jesus Christus misst ihnen einen grossen Wert bei, denn Er ist gekommen, um sie zu erretten. Wenn sie im Kindesalter – bevor sie für ihre Taten vor Gott verantwortlich sind – sterben, gehen sie nicht verloren, denn der Heiland ist auch für sie am Kreuz gestorben.
Die örtliche Versammlung
In diesem Abschnitt spricht der Herr von der örtlichen Versammlung. Sie umfasst alle Glaubenden, die sich an einem Ort befinden. Wenn sie im Namen des Herrn Jesus versammelt sind, zeugen sie von der weltweiten Versammlung, die aus allen Erlösten besteht.
Der Ausgangspunkt dieser Belehrungen ist ein Problem oder eine Sünde zwischen zwei Glaubenden. Der Herr erklärt, wie diese Angelegenheit behandelt werden muss. Zuerst gilt es, diese Sache unter vier Augen zu ordnen. Ist das nicht möglich, so sollen bei einer Aussprache der beiden Betroffenen zwei oder drei Zeugen anwesend sein, damit die Sünde im kleinen Kreis bereinigt werden kann. Wenn diese Bemühungen auch nicht zum Ziel führen, muss sich die örtliche Versammlung damit beschäftigen. Sie besitzt von Gott Autorität, ein Urteil zu fällen.
Vers 18 stellt einen doppelten Grundsatz vor. Die Versammlung hat einerseits die Befugnis, einen Bösen aus der Gemeinschaft der Glaubenden auszuschliessen (1. Korinther 5,13). Anderseits ist sie auch berechtigt, jemand zur Gemeinschaft am Tisch des Herrn zuzulassen. Damit eine Entscheidung der örtlichen Versammlung im Himmel anerkannt wird, muss sie in Übereinstimmung mit Gott handeln. Das kann nur in Abhängigkeit von Ihm geschehen. Darum ist das Gebet der Versammlung so wichtig (Vers 19).
In Vers 20 stellt der Herr den wichtigsten Grundsatz der örtlichen Versammlung vor: Wenn die Glaubenden in seinem Namen versammelt sind, indem sie Ihm alle Rechte geben, ist Er persönlich in ihrer Mitte.
Der unbarmherzige Knecht
Petrus fragte den Herrn, wie oft er seinem Bruder vergeben solle, und beschränkte es auf siebenmal. Darauf erklärte Jesus Christus, dass unserer Bereitschaft zum Vergeben keine Grenzen gesetzt sind. Er unterstrich seine Worte mit einem Gleichnis.
Der König ist Gott, bei dem wir alle eine grosse Schuld hatten. Doch bei unserer Bekehrung erfuhren wir, wie Er uns den ganzen Betrag, den wir niemals hätten zurückzahlen können, erlassen hat. Nun geschieht es im Leben, dass andere Menschen uns Unrecht tun und sich dadurch bei uns verschulden. Wie begegnen wir ihnen?
Sind wir auch so hart und unbarmherzig wie der böse Knecht in Vers 30? Dann werden wir es direkt mit Gott zu tun bekommen. Er wird uns in seinen gerechten Regierungswegen die zeitlichen Folgen unserer eigenen Sünden spüren lassen. Unsere ewige Errettung steht dabei nicht auf dem Spiel, denn Jesus Christus hat am Kreuz dafür alles gut gemacht. Denken wir jedoch an die grosse Schuld, die Gott uns vergeben hat, so fällt es uns leichter, unseren Mitmenschen das Unrecht, das sie uns zugefügt haben, bereitwillig zu verzeihen.
Die Mitknechte in Vers 31 sind uns ein Beispiel. Sie sahen, wie grausam der unbarmherzige Knecht mit seinem Mitknecht umging. Traurig gingen sie zu ihrem Herrn und erzählten ihm alles. Auch wir erleben leider, wie sich Christen ungerecht, böse oder lieblos verhalten. Dann wollen wir uns über diese Verunehrung des Herrn schämen und Ihm das Vorgefallene im Gebet mitteilen.
Die Ehe nach Gottes Gedanken
Dieses Kapitel behandelt die Ehe (Matthäus 19,2-12), die Kinder (Matthäus 19,13-15) und den Besitz (Matthäus 19,16-30). In seinen Unterweisungen zeigt uns der Herr, wie ein Jünger zu diesen Fragen des irdischen Lebens stehen soll.
Der traurige Anlass, um über die Ehe zu reden, ist eine Frage über Scheidung. In seiner Antwort geht Jesus Christus zum Anfang zurück und stellt die Gedanken des Schöpfers über die Ehe vor: Ein Mann heiratet eine Frau und bildet mit ihr für das ganze Leben auf der Erde eine Einheit. Das war von Beginn an der göttliche Wille für die Ehe. Darum soll der Mensch das, was Gott zusammengefügt hat, nicht scheiden.
In der Zeit des Gesetzes hat Mose die Ehescheidung wegen der Herzenshärte des Menschen unter gewissen Umständen gestattet. In der Zeit der Gnade begeht aber jeder, der sich scheiden lässt, eine schlimme Sünde. Eine einzige Ausnahme bildet der Fall, wenn die Ehe bereits durch Hurerei gebrochen ist. Dann besteht das Wort Gottes nicht darauf, dass die Ehe nicht geschieden werden darf.
Aufgrund dieser Belehrungen und des menschlichen Versagens in der Ehe kommen die Jünger zum Schluss, dass es besser ist, nicht zu heiraten. Aber der Herr belehrt sie anders: Die Ehe ist für die meisten Menschen der normale Stand. Es gibt jedoch drei Gründe, warum jemand nicht heiratet: Erstens weil er körperlich oder geistig dazu nicht in der Lage ist. Zweitens weil andere es ihm unmöglich machen. Drittens weil er freiwillig darauf verzichtet, um dem Herrn zu dienen.
Kinder und ein junger Mann
Unter dem Eindruck der Gnade des Herrn Jesus brachten einige Eltern ihre Kinder zu Ihm. Sie erkannten, dass Er auch für die Kleinen ein offenes Herz hat. Doch die Jünger wiesen sie ab. Die Worte ihres Meisters in Matthäus 18 über die Kinder waren noch nicht in ihre Herzen gedrungen. Da griff der Herr selbst ein, tadelte seine Jünger und segnete die Kleinen. Nochmals macht Er deutlich, dass Kinder einfacher zum Heiland kommen als Erwachsene. Das liegt sowohl an ihrem kindlichen Vertrauen als auch an ihrem Leben, das noch nicht durch viele Sünden verhärtet ist.
In Vers 16 kommt ein junger, rechtschaffener Mann zu Jesus, der an das Gute im Menschen glaubt. Er meint, die Voraussetzungen zu besitzen, um das ewige Leben selbst zu erwerben. Der Herr begegnet ihm auf dieser Ebene und fordert ihn auf, die Gebote zu halten, die das äussere Verhältnis der Menschen zueinander regeln. Alle diese Vorschriften hatte der Mann von Jugend an beachtet. In der Gesellschaft galt er als gerecht. Trotzdem merkte er, dass dies nicht genügte.
Jesus Christus wusste, was diesem jungen Mann zur Errettung fehlte: Er hatte kein Herz für Gott und für Christus. So sprach Er zu ihm: «Verkaufe deine Habe … und komm, folge mir nach!» Damit erklärte Er ihm: Lass alles los, was dein Herz gefangen nimmt, und übergib dein Leben Mir! Ewiges Leben bekommst du nur, wenn deine innere Beziehung zum Sohn Gottes in Ordnung ist. Leider war der Mann dazu nicht bereit. Sein Besitz war ihm mehr wert als der Herr Jesus.
Belohnung für die Nachfolge
Nachdem der reiche, rechtschaffene Mann den Herrn Jesus verlassen hatte, beschäftigte die Jünger die Frage: «Wer kann dann errettet werden?» In ihren Augen hatte dieser Mensch, der so nahe am Reich Gottes war und doch nicht eintrat, die besten Voraussetzungen dazu.
Aus dieser Begebenheit und den Worten des Herrn erkennen wir drei Punkte, die auf diese Frage eine Antwort geben:
- Äussere Vorzüge wie Anständigkeit und Rechtschaffenheit bieten keinen Vorteil für die Errettung. Jeder Mensch befindet sich in einem verlorenen Zustand und hat den Heiland nötig.
- Der Reichtum ist ein Hindernis für die Errettung, weil er dem Menschen Ansehen, Macht und Bequemlichkeit gibt (Vers 23).
- Was für den Menschen unmöglich ist, kann Gott bewirken. Durch seinen Geist vermag Er Menschenherzen zu verändern und für die Errettung durch den Herrn Jesus empfänglich zu machen (Vers 26).
Im Gegensatz zum jungen Mann hatten die zwölf Jünger alles aufgegeben, um dem Herrn Jesus nachzufolgen. Würde sich dieser Verzicht für sie lohnen? Ja, bestimmt! Gott wird es ihnen in der Zukunft mit einer speziellen Auszeichnung im Reich vergelten (Vers 28).
Vers 29 bezieht sich auf jeden Glaubenden, der für den Herrn Jesus auf irdische Vorteile verzichtet. Der zukünftige Lohn wird hundertmal grösser sein als die Nachteile, die er jetzt für Christus auf sich nimmt.
Die Arbeiter im Weinberg
Mit diesem Gleichnis illustriert der Herr Jesus den Satz: «Viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein» (Matthäus 19,30). Wenn wir wie Petrus meinen, wir würden dem Herrn besonders treu nachfolgen und hätten deshalb eine Belohnung verdient, dann werden wir erfahren, dass seine Bewertung anders ist. Er blickt auf den Beweggrund unseres Handelns und teilt den Lohn nach seiner Gnade aus.
Die ersten Arbeiter unterscheiden sich deutlich von den anderen, denn sie sind für einen vereinbarten Lohn im Weinberg tätig. Am Abend meinen sie, sie hätten am meisten geleistet. Als abgerechnet wird, bekommen sie das, was sie verdient haben. Doch sie sind neidisch auf die anderen, die gleichviel erhalten, und können die Güte des Hausherrn nicht akzeptieren.
Mit allen anderen Arbeitern fixiert der Herr, der sie engagiert, keinen Lohn. Sie arbeiten im Vertrauen auf seine Gnade, die ihnen das geben wird, was recht ist. Sie werden nicht enttäuscht. Am Abend bekommen sie mehr Lohn, als sie verdient haben.
Für die Arbeit im Werk des Herrn lernen wir hier einige Lektionen:
- Es ist Gnade, dass wir für unseren Erlöser tätig sein dürfen.
- Wir arbeiten nicht um Lohn, sondern aus Liebe zu Jesus Christus.
- Es kommt nicht so sehr auf den Umfang der Arbeit an. Der Herr bewertet vielmehr unsere innere Einstellung.
- Den Lohn, den wir empfangen werden, haben wir nicht verdient.
Hochmut und Neid
Zum vierten Mal teilt der Herr Jesus seinen Jüngern mit, was Ihn in Jerusalem erwarten wird. Zuerst deutet Er den Verrat von Judas an, der Ihn für Geld an die Hohenpriester und Schriftgelehrten überliefern wird. Diese Führer des Volkes werden Ihn zum Tod verurteilen und anschliessend den Römern übergeben, die Ihn verspotten, geisseln und kreuzigen werden. Doch das wird nicht das Ende sein. Christus wird nach drei Tagen auferstehen.
Nachdem der Herr so seinen Leidensweg beschrieben hat, kommt die Mutter von Jakobus und Johannes mit einer Bitte zu Ihm. Sie will für ihre beiden Söhne im zukünftigen Reich die besten Plätze. Wie taktlos und egoistisch ist ihr Wunsch! Sie denkt nur an ihre Ehre, während Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, um dort zu leiden und zu sterben. Mit der Frage: «Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?», macht der Herr den beiden Jüngern klar, dass sie zur zukünftigen Herrlichkeit auf dem gleichen Weg unterwegs sind wie Er. Es ist ein Weg der Leiden von Seiten der Welt (Matthäus 20,18.19). Im Blick auf ihren Wunsch erklärt Er demütig: Die Ehrenplätze im Reich werden nicht von mir, sondern vom Vater vergeben.
Als die anderen Jünger über das unverschämte Verhalten von Jakobus und Johannes unwillig werden, stellt Jesus Christus ihnen nochmals vor, welche sittlichen Wertmassstäbe in seinem Reich gelten: Echte Grösse zeigt sich in einer demütigen Einstellung. Ein Jünger, der dem Herrn gleichen will, nimmt wie Er den letzten Platz ein. Dort gibt es kein Gedränge!
Von Jericho nach Jerusalem
Mit Vers 29 beginnt die letzte Etappe des Lebensweges von Jesus Christus. Er ging als König nach Jerusalem, um dort sein letztes Zeugnis vor seinem Volk abzulegen. Doch es lehnte Ihn ab und kreuzigte Ihn.
Ausserhalb von Jericho sassen zwei Blinde am Weg, die Ihn als Messias anerkannten. Laut riefen sie: «Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids!» Die Leute wollten sie zum Schweigen bringen. Aber dieser Widerstand spornte sie umso mehr an, ihren Glauben an Jesus Christus zu bezeugen und Ihn bei dieser letzten Gelegenheit um Hilfe anzurufen.
Der Herr reagierte auf ihren Ruf ganz anders als die Volksmenge, denn Er hatte ein Herz für das Elend der Menschen. Er rief die beiden Blinden zu sich und heilte sie. Diese bestätigten ihren Glauben, indem sie ihrem Retter, unbeeindruckt von der Meinung anderer, auf dem Weg nach Jerusalem nachfolgten. – Stellen wir uns auch so konsequent auf die Seite unseres Herrn?
Von Bethphage aus zog Jesus als König auf einem Esel reitend in Jerusalem ein. Er besass die Autorität, über dieses Tier zu verfügen, offenbarte aber gleichzeitig seine Demut. Er ritt nicht hoch zu Ross in die Königsstadt ein, sondern auf einem Eselsfohlen. Wieder erfüllte sich eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Die Leute bejubelten Ihn als König Israels. Als sie aber in der Stadt gefragt wurden, wer Jesus sei, offenbarten sie ihre Unkenntnis und ihren Unglauben: Sie sahen in Ihm nur einen Propheten aus Nazareth.
Die Tempelreinigung und der Feigenbaum
Als Sohn Davids hatte Jesus das Recht, alles zu beurteilen, was im Zentrum des jüdischen Gottesdienstes vor sich ging. So trieb Er alle zum Tempel hinaus, die dort verkauften und kauften, weil sie den Ort der Anbetung Gottes zu einem Platz machten, wo der Mensch habgierig sein Geld vermehrte. Seine Entschiedenheit gegen das Böse war jedoch mit einer Güte vereint, in der Er bereitwillig die Blinden und Lahmen heilte.
Die Hohenpriester und Schriftgelehrten ärgerten sich über seine Wunder und das Lob der Kinder. Beides bezeugte Ihn als Messias, darum lehnten sie es ab. Sie wollten Jesus Christus unter keinen Umständen als König anerkennen.
Aufgrund dieses hartnäckigen Unglaubens verliess Er die Stadt und übernachtete in Bethanien. Am nächsten Morgen kam Er an einem Feigenbaum vorbei. Weil Er Hunger hatte, suchte Er Frucht an ihm, fand aber keine. Darauf verfluchte Er den Feigenbaum, so dass er sofort verdorrte.
Der Feigenbaum spricht vom Volk Israel, das unter den Forderungen des Gesetzes für Gott Frucht bringen sollte. Aber es trug nur eine religiöse Fassade zur Schau (= Blätter). Weil Gott in diesem Volk nichts fand, was Ihn freute, stellte Er es als Fruchtbringer auf die Seite. Der Glaube konnte dies an der Tatsache erkennen, dass das Volk Israel (= Berg) im Jahr 70 n.Chr. ins Meer der Nationen geworfen und die Juden in alle Länder zerstreut wurden. In der Zukunft wird dieses Volk auf der Grundlage der Gnade und unter der Herrschaft von Jesus Christus Frucht für Gott tragen.
Verschiedene Fragen
Die Hohenpriester fühlten sich durch die Tempelreinigung des Herrn in ihrer Autorität angegriffen. Anstatt ihr Versäumnis in der Aufsicht des Tempels einzusehen, gingen sie zum Gegenangriff über und fragten Ihn: In welchem Recht tust du dies? Es erstaunt uns, mit welcher Ruhe und Weisheit Jesus Christus darauf reagierte. Wenn sie sich schon für den jüdischen Gottesdienst zuständig hielten, so sollten sie Ihm eine Frage beantworten: «Die Taufe des Johannes, woher war sie, vom Himmel oder von Menschen?»
Nun sassen sie wegen ihres Unglaubens und ihrer Menschenfurcht in der Falle. Hätten sie den Dienst von Johannes als von Gott kommend anerkannt, dann wären sie verpflichtet gewesen, Jesus als Messias anzuerkennen. Um einer Stellungnahme auszuweichen, heuchelten sie Unwissenheit. Doch wenn sie diese Frage nicht beantworten konnten, hatten sie auch kein Recht, die Autorität von Christus infrage zu stellen.
Mit dem Gleichnis der beiden Kinder stellte der Herr ihnen in einem Spiegel ihr Verhalten vor Augen:
- Der erste Sohn, der seinem Vater zuerst nicht gehorchen wollte und danach doch in den Weinberg ging, spricht von den Zöllnern und Sündern. Sie führten ein gottloses Leben. Doch als Johannes sie zur Buße mahnte, glaubten viele seiner Botschaft und kehrten zu Gott um.
- Der zweite Sohn, der seinem Vater leichtfertig erklärte: «Ich gehe!», ihm aber nicht gehorchte, illustriert die religiösen Menschen in Israel. Sie redeten fromm, folgten dem Ruf zur Buße jedoch nicht.
Die bösen Weingärtner
Das Gleichnis von den Weingärtnern illustriert das Verhalten der israelitischen Führungsschicht zur Zeit des Gesetzes bis zum Kommen des Sohnes Gottes. Der Weinberg ist ein Bild vom Volk Israel, wie uns bereits das Alte Testament deutlich macht (Jesaja 5,1-7; Psalm 80,9). Nachdem Gott die Israeliten aus Ägypten erlöst und ins Land Kanaan gebracht hatte, konnte Er mit Recht Frucht von ihnen verlangen. Deshalb sandte Er Propheten zu ihnen. Doch sie wurden nicht aufgenommen, sondern geschlagen und getötet.
Zuletzt sandte Gott seinen Sohn als letzten Prüfstein zu seinem Volk. Würden sie Ihn annehmen und dadurch Gott die Frucht geben, die Ihm zusteht? Nein! Sie verwarfen Ihn, führten Ihn zur Stadt hinaus und kreuzigten Ihn (Vers 39).
Da die Juden die Bedeutung des Gleichnisses noch nicht begriffen, fällten sie mit ihrer Antwort ihr eigenes Urteil (Vers 41). Der Herr Jesus machte darauf deutlich, was das für sie bedeutete: Durch die Verwerfung des Sohnes Gottes verloren sie alle Anrechte auf das Reich Gottes. Eine andere Nation – nämlich der glaubende Überrest Israels in der Zukunft – wird ins Reich eingehen und Frucht für Gott bringen, weil diese Glaubenden den verworfenen Christus als Eckstein anerkennen werden.
Vers 44 beschreibt ein doppeltes Gericht: Alle, die sich damals im Unglauben am Herrn Jesus stiessen, zogen die göttliche Strafe auf sich. Und alle, die Ihn in der Zukunft ablehnen werden, werden von Ihm selbst gerichtet werden.
Der König macht seinen Sohn Hochzeit
Dieses Gleichnis beschreibt uns, wie die Juden sich gegenüber der Einladung der Gnade verhalten haben. Zweimal forderte Gott sie auf, am Hochzeitsfest seines Sohnes teilzunehmen:
- Die erste Einladung erfolgte zur Zeit, als Jesus auf der Erde lebte. Seine Jünger verkündeten das Reich und predigten die Buße. Doch die Juden wollten die Gnade nicht (Vers 3).
- Die zweite Einladung richtete sich in der Apostelgeschichte an das Volk Israel. Jetzt war alles bereit, weil das Erlösungswerk vollbracht war. Auch diesmal schlugen sie die Gnade aus (Matthäus 22,4.5).
Weil die Juden auch die Botschaft der Apostel ablehnten, kam mit der Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70 n.Chr. das göttliche Gericht über sie (Vers 7).
In der Apostelgeschichte erkennen wir, wie das Angebot der Gnade Gottes auf alle Völker ausgedehnt wurde. Seither werden Menschen aus der ganzen Welt eingeladen, zum Herrn Jesus zu kommen. Durch die Gnade angezogen, kommen Gute und Böse (Vers 10). Die «Guten» tun Buße und nehmen die Errettung in Jesus Christus glaubensvoll an. Dadurch besitzen sie das Hochzeitskleid. Die «Bösen» kommen nur äusserlich zu Ihm. Sie finden ihre eigene Gerechtigkeit gut genug, um vor Gott zu bestehen. Doch der Moment wird kommen, an dem Er ihnen klar machen wird, dass sie ohne persönlichen Glauben an den Herrn Jesus nicht zu Ihm passen. Weil sie nur äusserlich Christen geworden sind, aber die Errettung nicht für sich in Anspruch genommen haben, werden sie ewig verloren gehen (Vers 13).
Soll man dem Kaiser Steuern zahlen?
In Matthäus 22,15-40 kommen vier verschiedene Personengruppen zum Herrn Jesus und wollen Ihn mit drei Fragen in seiner Rede fangen:
- Verse 15-22: Die Pharisäer und Herodianer bedrängten Ihn mit der Steuerfrage.
- Verse 23-33: Die Sadduzäer versuchten, Ihn mit der Auferstehungsfrage in die Enge zu treiben.
- Verse 34-40: Ein Gesetzgelehrter stellte Ihm die Gesetzesfrage.
Jesus Christus begegnete allen diesen Angriffen in göttlicher Weisheit, so dass die Fragesteller beschämt schweigen mussten.
Was die Pharisäer und Herodianer in Vers 16 über den Herrn sagen, stimmte, aber sie glaubten es nicht. Sie wollten Ihm nur schmeicheln, damit Er in ihre Falle tappte. Aber unser Heiland war nicht empfänglich für Schmeichelei.
Ihre Frage betreffs der Steuer war äusserst raffiniert. Mit «Ja» würde Jesus seine Anrechte als Messias infrage stellen. Mit «Nein» würde Er als Aufrührer gelten. Doch der Herr kam nicht in Verlegenheit. Auf seine Aufforderung hin brachten sie Ihm einen Denar. Damit bewiesen sie, dass sie selbst das Geld des Kaisers verwendeten, weil sie wegen ihrer Untreue gegen Gott unter dem römischen Joch standen. Darum gab es jetzt nur einen Weg: «Gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.» Sie mussten die Folgen ihres Versagens tragen und die römische Steuer bezahlen. Gleichzeitig sollten sie aber Gott ihr Leben zur Verfügung stellen.
Gibt es eine Auferstehung?
Die Sadduzäer waren Vernunftmenschen, die weder an Engel noch an die Auferstehung glaubten (Apostelgeschichte 23,8). Mit ihrer Geschichte, die sie Jesus erzählten, versuchten sie die Auferstehung als etwas Unmögliches darzustellen und ins Lächerliche zu ziehen.
Bevor der Herr konkret auf die Frage der Auferstehung einging, zeigte Er ihnen die doppelte Ursache ihres Unglaubens: Sie stellten Gottes Wort und Gottes Kraft infrage. Aus diesen beiden Gründen werden heute auch andere Tatsachen wie z.B. der biblische Schöpfungsbericht geleugnet.
Die Erklärung in Vers 30 macht klar, dass im Leben nach der Auferstehung die natürlichen Beziehungen der Ehe und Familie nicht mehr bestehen werden. In dieser Hinsicht werden die Glaubenden dann wie Engel sein, die nicht heiraten und sich nicht fortpflanzen.
In Vers 32 beweist der Herr die Auferstehung mit einem Zitat aus dem zweiten Buch Mose. Obwohl die drei Patriarchen gestorben waren, existierten sie weiter. Ihr Geist und ihre Seele befinden sich im Totenreich. Für Gott sind sie deshalb Lebende. Er wird sie in göttlicher Kraft auferwecken, um das Versprechen, das Er ihnen gemacht hatte, wahr zu machen (Hebräer 11,13-16). Dann wird sich Gottes Wort durch Gottes Macht erfüllen.
Die Leute, die Jesus zuhörten, waren überrascht, wie Er den Sadduzäern die Tatsache der Auferstehung erklärte. Leider müssen wir annehmen, dass die meisten trotz dieses Erstaunens nicht an Ihn glaubten.
Welches ist das wichtigste Gebot?
Nun verbanden sich alle religiösen Gruppierungen der Juden zu einem verbalen Angriff gegen Jesus Christus. Ein Gelehrter fragte Ihn nach dem wichtigsten Gebot im Gesetz. Darauf stellte der Herr mit zwei Zitaten die beiden Schwerpunkte des Gesetzes vor:
- Du sollst mit der ganzen Kapazität deines Lebens Gott lieben.
- Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst.
Diese beiden Anweisungen umschliessen alle Gebote. Ihre Reihenfolge zeigt, dass Gottes Ansprüche vor den Bedürfnissen der Mitmenschen kommen.
Der Israelit konnte also nicht auswählen, welche Gebote er halten wollte. Er musste das ganze Gesetz beobachten und zwar mit einem Herzen, das für Gott und die Mitmenschen schlug. Da musste jeder aufrichtige Jude zum Schluss kommen, dass es ihm unmöglich war, diesen hohen göttlichen Massstab zu erreichen.
Diese Antwort hatten die Pharisäer nicht erwartet. Als sie nun schweigend vor Jesus standen, stellte Er ihnen eine Frage: Wessen Sohn ist Christus? Damit lenkte Er ihre Gedanken auf sich selbst:
- Als Sohn Davids stammte Er von diesem König ab und hatte deshalb Anrecht auf den Thron in Jerusalem.
- Als Herr Davids nahm Er nach seiner Verwerfung und Kreuzigung den Platz zur Rechten Gottes ein und stand somit über David. Dort besass Er einen Herrschaftsanspruch über die ganze Schöpfung.
Jesus Christus konnte beide Titel auf sich vereinen, weil Er sowohl Gott als Mensch in einer Person ist. Wie gross und herrlich ist Er!
Warnung vor den Schriftgelehrten
In diesem Kapitel spricht der Herr über die Pharisäer und Schriftgelehrten. In den Versen 1-12 warnt Er die Volksmenge und die Jünger vor diesen religiösen Menschen. Ab Vers 13 verurteilt Er sie direkt mit einem siebenfachen «Wehe euch».
Die Schriftgelehrten galten als Vertreter des Gesetzes. Darum sollten die Jünger, die sich damals noch im Judentum befanden, das tun, was jene lehrten. Aber das Verhalten der Schriftgelehrten war nicht nachahmenswert, denn sie verwirklichten nicht, was sie predigten. Zudem waren ihre Vorschriften und Anweisungen für die Zuhörer eine schwere Last: Sie sprachen nur von Gerechtigkeit, aber nie von Gnade.
Sie legten viel Wert auf äussere Frömmigkeit, weil sie die Anerkennung bei den Menschen suchten. Zudem war ihnen die eigene Ehre in der Gesellschaft wichtiger als die Ehre Gottes.
In den Versen 8-10 spricht der Herr seine Jünger direkt an und macht ihnen deutlich, dass die ehrgeizige und hochmütige Einstellung der Pharisäer mit seiner Nachfolge nicht vereinbar ist:
- «Lasst euch nicht Rabbi nennen.» Das ist die eine Gefahr: Als Jünger des Herrn dürfen wir uns nie über die anderen erheben.
- «Nennt auch niemand auf der Erde euren Vater.» Das ist die andere Gefahr: Wir sollen andere Jünger nie verehren.
Der Herr rundet das Thema in Vers 12 mit einem zweiteiligen Grundsatz ab, den wir durch die ganze Bibel hindurch bestätigt finden.
Die Verurteilung der Schriftgelehrten (1)
Das erste Wehe betraf den Widerstand der Schriftgelehrten gegen den Herrn Jesus. Durch ihre unbußfertige Haltung und ihren Unglauben verschlossen sie für sich selbst die Tür zum Reich der Himmel. Zudem hinderten sie mit ihrer Einstellung auch andere, ins Reich einzugehen.
Das zweite Wehe prangerte ihren falschen Eifer für das Judentum an. Sie versuchten Menschen für den jüdischen Glauben zu gewinnen, um sie dann unter ihre religiöse Gewalt zu bekommen. Es ging ihnen keineswegs um das Heil dieser Leute.
Das dritte Wehe verurteilte ihre Wortklauberei, mit der sie das Gesetz verdrehten und so dem Wort Gottes die Kraft wegnahmen.
Das vierte Wehe tadelte ihre überspitzte Anwendung der göttlichen Gebote. Sie legten vor allem Wert auf das haargenaue Einhalten von äusseren Vorschriften. Aber die wichtigen Anweisungen, die ihr Herz betrafen, vernachlässigten sie.
Das fünfte Wehe stellte ihre Heuchelei bloss. Sie legten ein scheinheiliges Verhalten an den Tag, während sie in ihrem Herzen böse Gedanken kultivierten.
Den Ernst dieser Mitteilungen wollen wir auch auf uns wirken lassen. Vielleicht stehen wir als «gute» Christen da. Doch wie sieht es in unserem Herzen aus? Entspringt unser Verhalten einer brennenden Liebe zum Herrn? Oder wollen wir vor den Menschen etwas gelten? Gott sieht und beurteilt unsere Motive. Er kann uns zeigen, ob da eine Korrektur nötig ist.
Die Verurteilung der Schriftgelehrten (2)
Mit dem sechsten Wehe führte der Herr den Gedanken der Heuchelei weiter, den Er bereits im fünften Wehe angeprangert hatte. Er machte klar, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten mit ihrer Frömmigkeit das Böse bewusst verdecken wollten. Doch Gott konnten sie nichts vormachen. Er sah auch das Böse hinter der weissen Fassade.
Das siebte Wehe offenbarte den entscheidenden Punkt: Sie lehnten die Propheten ab, die ihnen das Wort Gottes brachten. Anstatt ihre Botschaft ernst zu nehmen und sich unter den schlimmen Zustand in Israel zu beugen, schmückten sie heuchlerisch die Gräber der Boten Gottes, die ihre Vorfahren umgebracht hatten.
Nach seinem Tod und seiner Auferstehung sandte der Herr seine Apostel und Propheten mit einer Botschaft zum Volk Israel (Vers 34). Doch die religiösen Führer lehnten sie ab und behandelten sie grausam. Stephanus töteten sie sogar. Damit bewiesen sie deutlich, dass sie nicht besser waren als ihre Vorfahren, die die Propheten des Alten Testaments getötet hatten. Das göttliche Gericht würde deshalb nicht ausbleiben.
Ab Vers 37 spricht der Sohn Gottes in ergreifender Weise über Jerusalem. Wie oft hatte Er sich bereits im Alten Testament durch die Propheten um diese Stadt bemüht. Jetzt war Er selbst da – aber die Bewohner Jerusalems lehnten Ihn ab und kreuzigten Ihn. Darauf brach Gott für eine Zeit seine Beziehung zu Israel ab. Erst wenn ein Überrest Christus bei seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit annehmen wird, wird Jerusalem wieder der Wohnort Gottes sein.
Der Anfang der Wehen
Als Jesus mit seinen Jüngern den Tempel verliess, wiesen sie Ihn auf die imposanten Gebäude des Hauses Gottes hin. Doch der Herr war davon nicht beeindruckt. Er musste vielmehr die totale Zerstörung des Tempels ankündigen, die sich im Jahr 70 durch die Römer erfüllte: Sie liessen keinen Stein auf dem anderen!
Durch die Frage der Jünger veranlasst, spricht Jesus ab Vers 4 über eine noch zukünftige Gerichtszeit. Sie unterscheidet sich klar vom römischen Angriff im ersten Jahrhundert, denn sie wird erst nach der Entrückung der Versammlung und vor seiner Erscheinung über das Volk Israel hereinbrechen. Die Beschreibung bis Vers 14 gleicht dem Bericht von Offenbarung 6. Beide Abschnitte schildern den Anfang der Wehen, also die erste Hälfte der Drangsalszeit.
Die gläubigen Juden, die hier durch die Jünger repräsentiert werden, werden dann grossen Gefahren ausgesetzt sein. Einerseits werden Verführer behaupten, sie seien der Christus, um diese Treuen von ihrem Glauben an Gott abzubringen. Anderseits werden Kriege und Kriegsgerüchte die Erde erschüttern und die Menschen in grosse materielle Not stürzen.
Wegen ihrer Treue zum wahren Christus werden jene Glaubenden aus dem Volk Israel verfolgt und bedrängt werden. Das wird sie aber nicht daran hindern, auf der ganzen Erde das Evangelium des Reichs zu verkünden. Sie werden den Menschen sagen: Tut Buße, damit ihr bereit seid, wenn der Messias erscheint und sein Reich aufrichtet!
Die grosse Drangsal
Dieser Abschnitt beschreibt die zweite Hälfte der 7-jährigen Drangsalszeit. Diese dreieinhalb Jahre beginnen mit einem abscheulichen Ereignis: Der Antichrist schafft die jüdischen Opfer ab und stellt ein Götzenbild in den Tempel (vergleiche Vers 15 mit Daniel 9,27).
Nun sollen die treuen Juden sofort ins Ausland fliehen, denn die Drangsal wird so gross sein, dass für die Glaubenden ein Überleben in Jerusalem fast unmöglich ist. Mit dieser schrecklichen Gerichtszeit – die es vorher nie gegeben hat und nachher nie mehr geben wird – verfolgt Gott zwei Ziele: Einerseits bestraft Er die ungläubigen Juden, weil sie dem Antichristen nachlaufen. Anderseits erprobt Er den gläubigen Überrest, damit er innerlich für Christus zubereitet wird.
Durch grosse Zeichen und Wunder wird das Volk Israel verführt, damit sie dem falschen Christus folgen. Doch die Treuen sollen nicht darauf achten, denn der wahre Christus wird nicht heimlich kommen (in der Wüste oder in den Gemächern). Nein, Er wird wie der Blitz plötzlich und für alle sichtbar erscheinen.
Mit dem Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit wird die Drangsalszeit zu Ende gehen. Die gläubigen Juden werden bei seinem Anblick erkennen, dass sie Ihn einst verworfen und gekreuzigt haben. Darüber werden sie Leid tragen (Sacharja 12,10). Weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Stämme in Israel sein werden, wird der Herr seine Engel aussenden, um alle Glaubenden aus seinem Volk nach Jerusalem zu bringen.
Aufruf zum Wachen
Nachdem der Herr Jesus die zukünftigen Ereignisse bis zu seinem Kommen in Herrlichkeit beschrieben hat, gibt Er in unserem Abschnitt Belehrungen dazu.
Der Feigenbaum, der Blätter hervortreibt, ist ein Bild vom Volk Israel, das im 20. Jahrhundert in sein Land zurückgekehrt ist. Es lebt dort im Unglauben und bringt keine Frucht für Gott. Dennoch ist seine Rückkehr ins verheissene Land ein Zeichen, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht.
Zwei weitere Punkte geben uns Sicherheit im Blick auf die Zukunft Israels:
- Dieses Volk wird trotz vieler Angriffe nie ausgerottet werden, sondern als eigenständiges Volk bestehen bleiben (Vers 34).
- Das Wort Gottes, das viele prophetische Aussagen über Israel macht, wird ewig bestehen bleiben und sich bestimmt erfüllen (Vers 35).
Nur Gott kennt den genauen Zeitpunkt des Kommens von Christus. Darum wird Er in der Zukunft – wenn wir bereits im Himmel sein werden – die Menschen durch seine Boten vor dem Gericht warnen, das mit der Erscheinung des Herrn über die Erde hereinbrechen wird. Doch sie werden wie die Zeitgenossen Noahs diese Warnung nicht ernst nehmen, sondern sorglos weiter leben. Darum wird das Gericht plötzlich alle Ungläubigen wegraffen. Nur die Glaubenden werden auf der Erde gelassen, denn sie sind bereit, um ins Tausendjährige Reich einzugehen. Ihnen gilt deshalb der Appell zur Wachsamkeit in Vers 42: Sie sollen beständig auf das Kommen ihres Herrn warten.
Der treue und kluge Knecht
Ab Vers 45 spricht Jesus Christus über die Zeit seiner Abwesenheit. Dabei hat Er nicht mehr das Volk Israel im Blickfeld, sondern die Christen. Auch sie warten auf Ihn – nämlich auf sein Kommen zur Entrückung. Bis Matthäus 25,30 erzählt Er drei Gleichnisse, um uns deutlich zu machen, wie wir Ihn erwarten sollen:
- Der treue und der untreue Knecht (Matthäus 24,45-51).
- Die klugen und die törichten Jungfrauen (Matthäus 25,1-13).
- Die Knechte und die Talente (Matthäus 25,14-30).
Der treue Knecht in unserem Abschnitt repräsentiert alle, die dem Auftrag des Herrn nachkommen und dem himmlischen Volk Gottes geistliche Nahrung austeilen. Sie tun es in der Erwartung seines Kommens und möchten Ihm dabei treu bleiben. Weil sie Christus lieben, tragen sie auch Sorge für die Seinen: Unter der Leitung des Heiligen Geistes verkünden sie das Wort Gottes, damit die Versammlung zur rechten Zeit die richtige geistliche Nahrung bekommt. Als Belohnung für ihren Dienst werden sie mit Christus über das Universum (= seine Habe) regieren.
Der böse Knecht stellt alle dar, die zwar predigen, aber sich nicht um das geistliche Wohl des Volkes Gottes kümmern. Sie denken in ihren ungläubigen Herzen: Der Herr bleibt aus! Darum vernachlässigen sie ihre Aufgabe und verbinden sich mit der Welt: Anstatt Nahrung auszuteilen, essen und trinken sie mit den Betrunkenen. Wie genau hat sich das in der Christenheit erfüllt! Wenn der Herr wiederkommt, wird Er sie dafür bestrafen.
Die zehn Jungfrauen
Das Gleichnis der zehn Jungfrauen beschreibt die ganze christliche Zeit. Bei den ersten Christen war das Kommen des Herrn zur Entrückung eine lebendige Realität. Weil sie Ihn täglich erwarteten, verliessen sie das Judentum und trennten sich von der Welt. Sie hatten keine Gemeinschaft mit solchen, die ihren Heiland ablehnten.
Doch unter diesen Christen befanden sich nicht nur Erlöste, die den Heiligen Geist (= Öl) in sich wohnend hatten. Es schlossen sich ihnen auch Menschen an, die sich nur äusserlich zu Christus bekannten. Sie hielten zwar eine Lampe in der Hand, hatten aber kein Öl bei sich, weil sie nicht von neuem geboren waren und den Heiligen Geist nicht besassen.
Im Lauf der Zeit ging die Erwartung auf das Kommen des Herrn im christlichen Zeugnis verloren. Alle – die echten und unechten Bekenner – schliefen ein. Doch im 19. Jahrhundert schenkte Gott von neuem Licht über die Entrückung. Mit dem lauten Ruf: «Siehe, der Bräutigam!», wurden die Christen aus ihrem geistlichen Schlaf geweckt. Aufs Neue warteten sie auf ihren Herrn. Damit kam auch an den Tag, wer kein Öl, also keine echte Beziehung zu Christus hatte.
Bei der Entrückung nimmt der Herr nur die mit, die Ihm gehören. Die christlichen Bekenner, die kein Leben aus Gott haben, bleiben zurück.
Diese Geschichte spornt uns an, mit wachen Herzen auf unseren Herrn zu warten. Eine lebendige Erwartung seines Kommens wird einen starken Einfluss auf unsere Lebenspraxis haben.
Die Talente
Die Geschichte in unserem Abschnitt macht klar, dass der Herr Jesus uns Christen eine Aufgabe gibt, die wir während der Zeit seiner Abwesenheit erfüllen sollen.
Damit wir für Ihn arbeiten können, hat der Herr uns Talente anvertraut. Sie sprechen von den geistlichen Fähigkeiten, die Er uns entsprechend unseren natürlichen Begabungen geschenkt hat (Epheser 4,7). Nicht jeder Christ hat gleich viel empfangen, aber jeder hat den Auftrag, seine Gabe einzusetzen, damit sie für den Herrn einen Gewinn erzielt (Matthäus 25,16-18). Dabei sind nicht grosse Werke, sondern Treue und Hingabe gefragt. Beides entspringt unserem Vertrauen zu Christus. Weil wir seine Liebe und Güte kennen, dienen wir Ihm treu.
Wenn der Herr wiederkommt, erfolgt die Abrechnung. Seine Belohnung für einen hingebungsvollen Dienst hat drei Aspekte:
- Erstens die Anerkennung des Herrn: «Wohl du guter und treuer Knecht!»
- Zweitens der Lohn, der immer grösser ist als unsere Treue: «Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen.»
- Drittens die Gemeinschaft mit Christus: «Geh ein in die Freude deines Herrn.»
Der dritte Knecht ist ein Ungläubiger, der sich als Christ ausgibt. Er besitzt auch ein Talent, aber er setzt es nicht ein. Er kennt seinen Herrn nicht. Er bezeichnet Ihn als einen harten Mann, weil er sich nie vor Ihm gebeugt und deshalb seine rettende Gnade nicht erfahren hat. Darum kommt er ins ewige Gericht.
Die Schafe und die Böcke
In Vers 31 nimmt Jesus den prophetischen Faden von Matthäus 24,31 wieder auf. Er zeigt, was nach seiner Erscheinung auf der Erde mit den Menschen aus den Nationen geschieht, die die Kriege und Gerichte überlebt haben. Als König wird Er sie zu einer Gerichtssitzung vor sich versammeln und sie in zwei Gruppen aufteilen, so wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet.
Die Schafe zu seiner Rechten sind die «Gesegneten des Vaters». Sie haben ein Anrecht, ins Tausendjährige Reich einzugehen. Warum? Weil sie während der Drangsalszeit die gläubigen Juden, die im Auftrag von Christus das Evangelium des Reichs verkünden, aufnehmen. Sie glauben nicht nur ihrer Botschaft, sondern versorgen sie auch mit Nahrung und Kleidern. Mit der Aufnahme dieser bedrängten und verfolgten Juden heissen sie auch Christus willkommen. Es bewahrheitet sich dann das Wort des Herrn an seine Jünger: «Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf» (Matthäus 10,40). Darum sagt Er hier: Alles, was ihr meinen Brüdern getan habt, habt ihr mir getan (Vers 40).
Die Böcke zur Linken werden von Christus verflucht, weil sie in der Drangsalszeit seine Boten ablehnen und ihrer Not nicht abhelfen. Mit diesem Verhalten gegenüber den Juden verwerfen und beleidigen sie den Herrn Jesus selbst. Darum trifft diese Menschen aus den Völkern das ewige Gericht.
Für uns lernen wir aus dieser Gerichtssitzung der Lebendigen folgenden Grundsatz: Wenn wir den Gläubigen helfen, tun wir etwas für den Herrn Jesus!
Feindschaft und Wertschätzung
Jesus wusste im Voraus, wann Er gekreuzigt werden würde: am Passahfest, denn das war Gottes Plan. Die Juden, die Ihn töten wollten, hatten eine andere Absicht: «Nicht an dem Fest, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht.»
Doch sie konnten nichts gegen den göttlichen Vorsatz ausrichten: Die Entscheidung des Volkes vor Pilatus, ihren Messias zu kreuzigen, fiel am Passahfest. So machten sich die vielen Juden, die zu diesem Fest nach Jerusalem gekommen waren, für die Ermordung des Herrn Jesus verantwortlich.
Während sich der Hass seiner Feinde zuspitzte, befand sich Jesus in Bethanien und genoss dort die Gemeinschaft mit den Seinen. Da kam eine Frau zu Ihm, die Ihm ihre ganze Wertschätzung entgegenbrachte, indem sie Ihn mit einem sehr kostbaren Öl salbte. Was musste diese Verehrung und Hingabe für den Heiland bedeutet haben! Da war ein Herz, das für Ihn schlug und mit Ihm empfand, als sein Weg immer einsamer und schwieriger wurde.
Leider betrachteten die Jünger – angeführt vom geldgierigen Judas Iskariot – diese Handlung als eine Vergeudung. Ihnen war der Herr Jesus nicht so viel wert. Doch der Herr nahm die Frau sofort in Schutz und rechtfertigte ihre hingebungsvolle Tat.
Heute dürfen wir Jesus Christus unsere Hochachtung entgegenbringen, indem wir jeden Sonntag beim Brotbrechen an Ihn denken und Ihn anbeten. Er schätzt es, wenn wir Ihm so unsere erste Liebe schenken.
Das Passah
Drei Jahre war Judas mit dem Herrn Jesus zusammen gewesen. Doch sein Herz blieb für die Gnade des Heilands verschlossen. Nun öffnete es sich dem Satan, um unter seinem Einfluss eine schreckliche Tat zu vollbringen (Lukas 22,3). Dieser habsüchtige Jünger war bereit, seinen Herrn für 30 Silberstücke an die Hohenpriester zu verraten.
«Wo willst du, dass wir dir bereiten, das Passah zu essen?» Diese Frage der Jünger offenbarte zweierlei: Einerseits wollten sie sich bei der Passahfeier ganz nach den Wünschen ihres Herrn richten. Anderseits sollte dieses Zusammensein völlig Ihm gewidmet sein. Beides können wir auf das Mahl des Herrn übertragen:
- Er gibt uns im Wort Gottes Anweisungen, wo und wie wir heute sein Mahl halten sollen. Beachten wir sie?
- Wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen, denken wir an unseren Erlöser und bringen Ihm unseren Dank und unsere Anbetung.
Während der Herr mit seinen Jüngern das Passah ass, entlarvte Er den Verräter. Ausserdem warnte Er Judas vor dem furchtbaren Verderben, das ihn wegen seiner Sünde treffen würde (Vers 24).
Keiner der Zwölf hatte gemerkt, dass Judas ein falscher Jünger war. Mit seiner Frage: «Ich bin es doch nicht, Rabbi?», spielte er sein heuchlerisches Spiel bis zum Ende. Doch den Herrn hatte er nie täuschen können. Dieser hatte immer gewusst, wie es um Judas stand, hatte ihn aber in grosser Geduld ertragen.
Das Gedächtnismahl und Warnungen
Nach dem Passah, das ein Vorausbild auf die Leiden und den Tod des Heilands war, setzte Er das Gedächtnismahl ein. Er hat es uns Christen gegeben, damit wir uns jeden Sonntag daran erinnern, dass Er am Kreuz für uns gestorben ist.
Das Brot spricht von seinem Körper, den Er für uns in den Tod gegeben hat. Der Kelch ist ein Sinnbild seines Blutes, das für viele vergossen wurde. Beim Essen des Brotes und Trinken aus dem Kelch beschäftigen wir uns also mit den furchtbaren Leiden, die Er in seinem Sterben für uns erduldet hat.
Wir denken aber auch an die Ergebnisse seines Opfertodes. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, besitzt Vergebung seiner Sünden. Zudem wird Gott mit Israel auf der Grundlage des Erlösungswerks von Christus eine neue Beziehung eingehen. Dann wird Er nichts mehr von ihnen fordern, sondern ihnen in Gnade seinen ganzen Segen ausschütten.
Auf dem Weg zum Ölberg erklärte Jesus seinen Jüngern, dass sie in den kommenden, schweren Stunden Anstoss an Ihm nehmen und Ihn verlassen würden. Ihre natürliche Beziehung zum Messias würde zu Ende gehen und einer neuen Beziehung zum auferstandenen Christus Platz machen.
Petrus wollte diese Worte nicht für sich wahrhaben. Er meinte, seine Liebe zum Herrn sei grösser als die seiner Mitjünger und stärker als die bevorstehenden Schwierigkeiten. So musste er mit der Verleugnung seines Meisters traurig erfahren, wie er trotz seiner Behauptungen völlig versagte.
Im Garten Gethsemane
Jesus ging mit seinen Jüngern nach Gethsemane, um das, was vor Ihm lag, im Gebet seinem Vater zu sagen. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit, die bereits auf dem hohen Berg seine Herrlichkeit gesehen hatten (Matthäus 17,1-8). Hier sollten sie einen Eindruck von seinen Leiden bekommen. In beiden Begebenheiten schliefen sie ein. Wie beschämend!
In Gedanken stand das ganze Geschehen am Kreuz vor dem Herrn: seine Leiden und sein Tod. Seine Seele war sehr betrübt, wenn Er daran dachte, dass Er zur Sünde gemacht würde und sterben müsse. Er war doch der einzige Mensch, der nie gesündigt und darum den Tod nicht verdient hatte!
Satan versuchte Jesus davon abzuhalten, Gott bis zuletzt zu gehorchen, indem er Ihm den Schrecken des Todes vorstellte. Doch der Heiland nahm seine Zuflucht im Gebet zu Gott. Dreimal teilte Er seinem Vater die ganze Not mit, unterstellte sich aber völlig seinem Willen. Er nahm den Kelch dieser bitteren Leiden aus der Hand des Vaters, denn Er war entschlossen, bis zum Ende den Weg des Gehorsams zu gehen. So wurde der Feind auch diesmal geschlagen.
Als Jesus zwischendurch zu den Jüngern kam, fand Er sie eingeschlafen. Deshalb forderte Er sie auf: «Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt.» Bald würden sie einer schweren Erprobung ausgesetzt sein. Diese konnten sie nicht in eigener Kraft bestehen. Darum war es nötig, dass sie wachsam waren und Gott um Hilfe anriefen.
Gefangennahme
Nach seinem intensiven Gebet zum Vater trat Jesus seinen Feinden in Ruhe entgegen. Sie kamen mit Schwertern und Stöcken, um den von Gott gesandten Messias zu verhaften. Angeführt wurde die Menge durch den Verräter Judas, aber hinter diesem Anschlag stand die religiöse Führerschaft.
Judas verriet seinen Meister mit einem Kuss. Welch ein Missbrauch dieses Zeichens der Liebe! Doch Jesus blieb taktvoll und sprach zu ihm: «Freund, wozu bist du gekommen!» Damit stellte Er ihm die ganze Tragweite seiner Tat vor: Für ein wenig Geld lieferte Judas den Sohn Gottes an seine Feinde aus!
Sofort traten die Soldaten herzu und nahmen Jesus gefangen. «Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird», liess Er dies über sich ergehen (Jesaja 53,7). Er tadelte sogar seinen Jünger Petrus, als dieser mit dem Schwert dem Knecht des Hohenpriesters das Ohr abschlug. Der Wille seines Vaters und die Erfüllung des Wortes Gottes waren für Ihn entscheidend (Matthäus 26,53.54). Darum war Er bereit, alle diese Demütigungen auf sich zu nehmen.
Trotzdem stellte Er seinen Feinden ihr feiges, niederträchtiges Verhalten vor. Er war doch kein Räuber, der das Tageslicht scheuen musste! Täglich war Er im Tempel gewesen, aber sie hatten Ihn aus Angst vor einer Reaktion des Volkes nicht festgenommen.
Als die Jünger merkten, dass es brenzlig wurde, flohen sie und liessen ihren Meister allein. Es erfüllte sich ein Wort aus den Psalmen: «Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach» (Psalm 102,8).
Verhör und Verleugnung
Der hohe Rat der Juden suchte einen Grund, um Jesus zu Tode zu bringen. Er liess bewusst viele falsche Zeugen vortreten, um den Schein einer Gerichtsverhandlung zu wahren, obwohl das Urteil bereits gefällt war. Einst hatte Jesus gesagt: «Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten» (Johannes 2,19). Damit meinte Er nicht das Gebäude in Jerusalem, sondern sich selbst. Die Juden würden Ihn töten, Er aber würde nach drei Tagen auferstehen. In ihrem Unglauben verstanden sie seine Aussage damals nicht. Jetzt glaubten sie, darin einen Anklagegrund zu finden, indem sie seine Worte verdrehten: «Dieser sagte: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in drei Tagen aufbauen.» Zu dieser absurden Anschuldigung schwieg der Heiland.
Erst als der Hohepriester mit einem Schwur eine Antwort über seine Person forderte, brach Jesus sein Schweigen und bezeugte klar, dass Er sowohl der Christus als auch der Sohn Gottes sei. Zudem kündigte Er den Juden seine zukünftige Herrlichkeit als Sohn des Menschen an. Mit diesem deutlichen Zeugnis stand die religiöse Führerschaft vor der letzten Entscheidung: Würden sie die Wahrheit über die Person von Jesus Christus annehmen? Nein! Sie legten seine Aussage als Lästerung aus und hatten damit einen Grund, Ihn zum Tod zu verurteilen.
Im Hof des Hohenpriesters befand sich Petrus mitten unter den Feinden seines Herrn. Da wurde er dreimal auf sein Verhältnis zu Jesus angesprochen und verleugnete Ihn dreimal.
Das Ende von Judas Iskariot
Nachdem in der Nacht die erste Verhandlung stattgefunden hatte (Matthäus 26,59-68), fand am Morgen die offizielle Versammlung des Synedriums statt, wo das bereits gefällte Urteil bestätigt wurde. Da die Juden ein Todesurteil nicht selbst ausführen durften, brachten sie nun die Angelegenheit vor den römischen Statthalter Pilatus.
Mit dieser Entwicklung hatte Judas nicht gerechnet. Nun reute ihn seine gemeine Tat. Doch er ging mit seinem Bekenntnis zu den falschen Personen. In seinem Gewissen getroffen, legte er vor den Hohenpriestern ein Zeugnis über die Unschuld des Herrn Jesus ab, wurde aber von diesen harten, gefühllosen Leuten abgewiesen.
Nun sah Judas keinen Ausweg mehr. Vom Teufel verführt und unter seiner Macht stehend, ging er hin und erhängte sich. Doch das war nicht sein Ende. Auch er wird einmal vor dem grossen weissen Thron stehen, um dort das Urteil zu empfangen: die ewige Strafe in der Hölle (Offenbarung 20,11-15).
Seine Geschichte ist eine Warnung an alle, die viel vom Herrn Jesus hören, aber nicht an Ihn glauben wollen. Dadurch wird das Herz unempfindlich für die göttliche Gnade und empfänglich für die Versuchungen Satans, der seine Beute immer ins Unglück stürzen will.
Wie gross war die Heuchelei der Hohenpriester! Das Geld, das sie selbst für den Verrat von Jesus ausgegeben hatten, durfte keine Opfergabe für den Tempel sein. Sie kauften damit einen Acker und erfüllten so unbewusst eine Prophezeiung.
Pilatus verurteilt Jesus zum Tod
Jesus wurde nun von Pilatus verhört. Da Er in diesem Evangelium jedoch besonders als Messias vorgestellt wird, unterstreicht diese Gerichtsverhandlung vor allem die Verantwortung der Juden, die ihren König vor den Römern verleugneten (Apostelgeschichte 3,14).
Der Herr Jesus verhielt sich hier wie vor dem jüdischen Rat. Er bekannte sich vor Pilatus als König der Juden, schwieg aber zu allen Anschuldigungen der Hohenpriester und Ältesten.
Mit seinem Vorschlag, entweder Barabbas oder Jesus freizulassen, stellte Pilatus das Volk Israel vor die entscheidende Wahl: Wollten sie den Raubmörder oder den von Gott gesandten Messias? Man kann es fast nicht glauben: Sie wählten Barabbas! Damit lehnten sie nicht nur Christus ab, sondern rebellierten auch gegen Gott und offenbarten das böse, menschliche Herz, das die Finsternis mehr liebt als das Licht.
Pilatus befand sich nun in einem Zwiespalt. Beunruhigt durch die Nachricht seiner Frau hätte er Jesus gern freigelassen. Da dies nach der Wahl des Volkes nicht mehr möglich war, versuchte er sich seiner Verantwortung zu entziehen. Symbolisch wusch er seine Hände und sprach: «Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu.» Seine Schuld am Tod Jesu blieb jedoch bestehen. Aber die Juden waren um ein Vielfaches schuldiger. Ohne die Tragweite ihrer Aussage zu ermessen, erklärten sie: «Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder!» Dieser Ausspruch hat dem Volk Israel bereits viel Not und Leid eingebracht, denn Gott hat es beim Wort genommen.
Jesus wird verspottet und gekreuzigt
Pilatus übergab Jesus den Soldaten zur Kreuzigung. Diese rohen Menschen nutzten die Gelegenheit, um Ihn zu verspotten und zu quälen. Es erfüllte sich das Wort des Psalmisten: «Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt» (Psalm 22,17).
In ihrer Verachtung machten sie sich über Jesus als König der Juden lustig und fielen in spöttischer Huldigung vor Ihm auf die Knie. Sie wussten nicht, dass einmal der Moment kommen wird, an dem sich jedes Knie in echter Unterwerfung vor Ihm beugen muss (Philipper 2,10).
Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte zwangen sie Simon von Kyrene, sein Kreuz zu tragen. Auf Golgatha boten sie dem Heiland einen Betäubungstrank an. Doch Er lehnte ihn ab, weil Er die Leiden mit einem klaren Sinn erdulden wollte. So gross war seine Hingabe, in der Er das Werk am Kreuz vollbrachte!
Die römischen Soldaten kreuzigten Ihn, indem sie seine Hände und seine Füsse mit Nägeln durchbohrten. Darauf verteilten sie seine Kleider und nahmen Ihm so seinen letzten Besitz weg. Seiner menschlichen Würde beraubt, war Jesus nun den neugierigen Blicken der Volksmenge ausgesetzt.
Auch diese Einzelheiten wurden vorausgesagt: «Sie haben meine Hände und meine Füsse durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen mich an; sie teilen meine Kleider unter sich, und über mein Gewand werfen sie das Los» (Psalm 22,17-19).
Der Heiland leidet und stirbt
Aus Markus 15,25 wissen wir, dass Jesus in der dritten Stunde gekreuzigt wurde. Aufgrund dieser Angabe lässt sich die Zeit, die Er am Kreuz hing, in zwei Abschnitte von je drei Stunden aufteilen.
Die ersten drei Stunden werden uns in den Versen 39-44 beschrieben. Da ergoss sich der ganze Spott aller Bevölkerungsschichten über den Gekreuzigten:
- Die Vorübergehenden lästerten Ihn, indem sie seine Macht als Sohn Gottes infrage stellten. Sie glaubten nicht, dass es Ihm möglich sei, vom Kreuz herabzusteigen.
- Die religiösen Führer machten sein Gottvertrauen als König Israels lächerlich. Da Gott nicht zur Rettung seines Sohnes eingriff, meinten sie, Jesus habe vergeblich an Ihn geglaubt.
- Schliesslich öffneten sogar die gekreuzigten Räuber ihren Mund, um den Heiland zu schmähen.
Die zweiten drei Stunden finden wir in den Versen 45-53. In dieser Zeit wurde es stockdunkel, damit niemand sehen konnte, was der Herr Jesus im göttlichen Gericht über die Sünde erduldete. Sein Ausruf am Ende: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?», lässt uns ein wenig erahnen, wie unsäglich seine Leiden waren, als Gott Ihn wegen uns strafte.
Auf den Tod des Heilands folgten zwei Zeichen, die die Auswirkungen seines Erlösungswerks illustrieren:
- Der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten, weil Jesus den Zugang zu Gott geöffnet hat.
- Es öffneten sich die Gräber der entschlafenen Heiligen, da Christus die Macht des Todes besiegt hat.
Angemessene Grablegung
Einige Frauen bewiesen ihre Hingabe an Jesus Christus bis zum Ende, indem sie von weitem das Geschehen auf Golgatha mitverfolgten und anschliessend bei seinem Begräbnis anwesend waren (Vers 61).
Für den Jünger Joseph von Arimathia kam nun die Gelegenheit, sich öffentlich auf die Seite Jesu zu stellen. Als Ratsherr hatte er im Synedrium der Verurteilung von Jesus Christus nicht zugestimmt (Lukas 23,51). Jetzt stellte er sich sogar offenkundig gegen die Handlung seiner Ratskollegen, indem er seinem Herrn ein würdiges Begräbnis zuteil werden liess. Er bat Pilatus um den Leib Jesu und legte ihn, nachdem er ihn in reines, feines Leinentuch eingewickelt hatte, in seine eigene Gruft. Nur das Beste war gut genug für seinen Heiland.
Die Juden verfolgten ihren Messias über seinen Tod hinaus. In ihrem Unglauben wollten sie verhindern, dass Er auferstehen würde. Sie glaubten zwar nicht an seine Auferstehung, fürchteten sich aber, sie könnte doch Wirklichkeit werden. Darum forderten sie von Pilatus, dass er das Grab von Jesus bewachen liess. Es scheint, dass er ihnen eine Wache gab, das Übrige aber den Juden überliess. So versiegelten sie den Stein und sicherten das Grab mit der Wache. Unter gar keinen Umständen durfte ein leeres Grab die Lehre seiner Auferstehung begründen!
Doch Gott benutzte ihren Hass, um uns einen deutlichen Beweis der Auferstehung seines Sohnes zu geben: Die jüdischen Wachleute waren unfreiwillige Zeugen davon (Matthäus 28,4.11).
Jesus Christus ist auferstanden
Sowohl der Tod als auch die Auferstehung des Herrn Jesus wurden von einem Erdbeben begleitet, um die Wichtigkeit beider Ereignisse zu unterstreichen (Vers 2; Matthäus 27,51). Als Glaubende wissen wir: Sein Tod bildet die Grundlage unserer Errettung und seine Auferstehung gibt uns die Sicherheit unserer Annahme bei Gott (Römer 4,25).
Ein Engel kam aus dem Himmel herab und öffnete das Grab, damit alle sehen konnten: Es ist leer! Jesus Christus war bereits auferstanden und hatte in seinem Auferstehungskörper das Grab verlassen, bevor der Stein weggewälzt wurde. Denn sein Körper war nicht mehr an die Gesetzmässigkeiten der Erde gebunden (siehe auch Johannes 20,19).
Der Engel tröstete die erschrockenen Frauen und erklärte ihnen, dass Jesus auferstanden sei. Der Herr hatte es den Seinen vorausgesagt und das leere Grab bewies es klar. Dann bekamen sie eine Mitteilung an die Jünger. Sie sollten ihnen sagen, dass Christus von den Toten auferstanden war. Weil Er weiterhin verworfen war, würde Er sich mit ihnen nicht in Jerusalem treffen, sondern getrennt von der Welt in Galiläa.
Auf dem Weg zu den Jüngern trafen die Frauen mit dem Auferstandenen zusammen. Weil in diesem Evangelium nicht die neuen, himmlischen Beziehungen im Vordergrund stehen, durften sie die Füsse ihres Herrn umfassen und Ihm so huldigen.
Es beeindruckt uns, wie der Herr die Liebe und den Glauben dieser Frauen, die als Erste zum Grab gingen, mit einer persönlichen Begegnung belohnte.
Der Herr mit den Jüngern in Galiläa
Die Wachleute verkündeten den Hohenpriestern als Augenzeugen, dass Jesus auferstanden sei. Doch diese wollten es gegen besseres Wissen nicht wahrhaben. Mit viel Geld vertuschten sie seine Auferstehung, indem sie eine Lüge verbreiten liessen. Diese unwahre Geschichte hatte aber an sich schon einen Haken: Wie konnten die Soldaten wissen, was geschehen war, wenn sie zur betreffenden Zeit geschlafen hatten?
Das Gerede der Wachleute wurde unter den Juden bekannt, obwohl Beweise seiner Auferstehung vorhanden waren. Die Welt sah den Auferstandenen nie, Er zeigte sich nur den Seinen. Wir lernen daraus: Die herrliche Tatsache seiner Auferstehung muss bis heute im Glauben erfasst werden.
In Galiläa verband sich Jesus Christus als der Auferstandene mit seinen Jüngern. Sie bildeten den Überrest aus dem Volk Israel und bekamen nun den Auftrag: «Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern.» Während der König verworfen und abwesend ist, sollten seine Jünger die Menschen aus allen Völkern einladen, durch Buße und Glauben an Jesus Christus ins Reich Gottes einzugehen. Dieser Auftrag bleibt solange bestehen, bis Christus wiederkommen und sein Reich öffentlich aufrichten wird. In der Zeit der Gnade ist die Botschaft an die Menschen umfänglicher. Sie beinhaltet das ganze Evangelium Gottes.
Als Jünger folgen wir einem Herrn nach, der alle Macht hat (Vers 18) und immer bei uns ist (Vers 20). Das macht uns Mut, in einer Welt, die uns mit Ihm verwirft, für Ihn zu zeugen.
Buchtipp: Bibel-Auslegung zum Matthäus-Evangelium
Einleitung
Das Leben von Abraham kann in drei Teile gegliedert werden:
1. Mose 12 – 14: Seine äussere Geschichte
1. Mose 15 – 21: Seine innere Geschichte
1. Mose 22 – 25,18: Ein prophetischer Ausblick
Abraham kommt nach Kanaan

Der Vordere Orient
Die Vorvergangenheitsform in Vers 1 zeigt, dass der Ruf Gottes bereits früher erfolgt war. Er galt immer noch, auch wenn Abram wegen seines Vaters in Haran stehen geblieben war. Die Rücksicht auf seinen Vater hatte ihn bisher gehindert, den Willen Gottes unverzüglich und ganz zu erfüllen.
In Vers 2 bekommt Abram von Gott grosse, bedingungslose Verheissungen: «Ich will dich zu einer grossen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen gross machen; und du sollst ein Segen sein!» Nun machte er sich im Glauben auf den Weg. Sein Neffe Lot schloss sich ihm an. Abram liess ihn gewähren und nahm ihn mit.
Nachdem Abram in Kanaan angekommen war, bestätigte ihm der Herr, dass er das göttliche Ziel erreicht habe (Vers 7). Als Erstes baute Abram bei der Terebinthe Mores einen Altar. Dieser war der Ausdruck seiner persönlichen Verbindung, die er mit seinem Gott hatte. Weil die Kanaaniter damals im Land wohnten, hielt sich Abram dort als Nomade auf und wohnte in einem Zelt. So sieht auch unser Leben nach unserer Bekehrung aus: Wir halten uns als Fremde in einer Welt auf, zu der wir nicht mehr gehören. Gleichzeitig haben wir eine persönliche Beziehung zu unserem Herrn und Erlöser.
Der zweite Altar, den Abram errichtete, war ein gottesdienstlicher Altar. Dort rief er den Namen des Herrn an. Als die Nachkommen Abrahams später in diesem Land wohnten, wurde der Tempel in Jerusalem zum Ort, wo Gott seinen Namen in Israel wohnen liess und wo Er angebetet wurde (5. Mose 12,4-7; 1. Könige 8,10-14).
Abraham zieht nach Ägypten
Als Abram immer weiter südwärts wanderte, kam die erste Glaubensprüfung: Es entstand eine Hungersnot im Land. Er versuchte, diesem Problem auszuweichen, indem er für eine Zeit nach Ägypten zog. Aber dort drohte eine andere Gefahr: Er fürchtete, man würde ihn wegen seiner schönen Frau töten. Um dies abzuwenden, griff er zu einer Halbwahrheit. Sarai sollte sagen, sie sei seine Schwester. Das war sie auch, doch sie war auch seine Frau (1. Mose 20,12). Solche trügerischen Worte passen nicht zu einem Gläubigen!
Der Pharao, der über Ägypten herrschte, meinte, er sei für sein Tun niemand verantwortlich. So liess er Sarai kurzerhand in sein Haus holen. Abram liess er am Leben. Ja, er tat ihm sogar viel Gutes und beschenkte ihn reich. Nun griff Gott ein, indem Er den Pharao und sein Haus mit grossen Plagen schlug. Dabei verfolgte Er in seiner Barmherzigkeit ein Ziel: Er wollte Abram aus der Welt (Ägypten) in die Gemeinschaft mit sich zurückführen (zum Altar bei Bethel).
Die Erfahrungen, die Abram in Ägypten machte, werden auch wir erleben, wenn wir uns als Gläubige wieder der Welt zuwenden:
- Wir werden zu einem Problem für sie und zu einem Störfaktor für ihre Freuden.
- Wie beschämend für uns, wenn die Welt uns tadeln, korrigieren und schliesslich wegschicken muss.
- Wenn wir durch Gottes Gnade den Weg zum Herrn zurückfinden, bleiben die Folgen unseres Abweichens oft bestehen. Das war auch bei Abram so, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden.
Abraham und Lot trennen sich
Wenn ein Gläubiger vom rechten, Gott gemässen Weg abweicht, muss er bis an den Ausgangspunkt seines Abweichens zurückkehren, damit die Gemeinschaft mit dem Herrn völlig wiederhergestellt wird. Das war bei Abram der Fall (1. Mose 13,3.4).
Als ein Mitläufer war Lot mit Abram auch nach Ägypten gezogen. Nun kamen sie, von der Welt reich beschenkt, nach Kanaan zurück. Doch dieser materielle Reichtum führte zu Zank zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Lots. Abram, der wieder in einer intakten Beziehung mit Gott lebte, versuchte diesen Streit zwischen Brüdern zu lösen. Er dachte dabei sicher auch an die ungläubigen Bewohner des Landes, die diese Auseinandersetzung mitbekamen (1. Korinther 6,6).
Es war Abram klar, dass Lot und er sich trennen mussten. Ihre Herden waren zu gross, um nebeneinander zu bleiben. Abram, der Glaubensmann, suchte nicht seinen eigenen Vorteil. Er liess zuerst seinen Neffen wählen. Lot entschied sich für die fruchtbare Jordanebene. Für ihn war diese Gegend das Paradies auf Erden. Zudem erinnerte sie ihn an das, was er in Ägypten gesehen hatte. Dass die Leute von Sodom «sehr böse und grosse Sünder vor dem Herrn» waren, schien Lot nicht zu stören.
Die Entscheidung Lots war bis zu einem gewissen Grad eine Folge des falschen Weges, den Abram nach Ägypten gegangen war. Da stellt sich die Frage: Ist uns bewusst, dass unser Verhalten andere Gläubige beeinflusst – entweder zum Guten oder zum Schlechten?
Abraham im verheissenen Land
Als Lot vor die Wahl gestellt wurde, «erhob er seine Augen». Dann folgten seine Füsse dem, was seine Augen als begehrenswert entdeckt hatten.
Und Abram? Zog er den Kürzeren? Nein! Er wurde vom Herrn selbst aufgefordert, «seine Augen zu erheben». Er durfte in alle vier Himmelsrichtungen blicken. Das ganze Land, das er sah, wollte Gott ihm und seiner Nachkommenschaft geben, und zwar «bis in Ewigkeit». Auch über seine Nachkommen machte ihm der Herr grosse Verheissungen.
Mit diesen Versprechen Gottes im Herzen durchzog der Glaubensmann das verheissene Land und wohnte dabei in Zelten. Abram wusste: Nach Gottes Plan gehört das Land jetzt schon mir, der volle Segen davon aber liegt noch in der Zukunft.
In dieser Hinsicht gleichen wir Christen Abram. Wir sind auserwählt, um Kinder und Söhne Gottes zu sein, und wir sind es jetzt schon (Epheser 1,4.5; Römer 8,14-16; 1. Johannes 3,1). Doch den vollen Segen unserer Kindschaft und Sohnschaft werden wir erst im Himmel geniessen, wenn wir bei Gott im Vaterhaus daheim sind.
Abram blieb ein Fremder auf der Erde. Er wohnte in seinem Zelt unter den Terebinthen Mamres, die bei Hebron sind. Hebron bedeutet «Gemeinschaft». Hier genoss Abram die Gemeinschaft mit seinem Gott, was durch den Altar angedeutet wird, den er dort dem Herrn baute. Im Schatten des Allmächtigen kam er als Fremder zur Ruhe.
Lot wird verschleppt
In diesem Kapitel lesen wir zum ersten Mal in der Bibel von einem grösseren Krieg. Vier Könige kämpften mit ihren Heeren gegen eine Koalition von fünf Königen. Was war der Auslöser? Die einen Völker waren von den anderen beherrscht und unterdrückt worden. Nun rebellierten sie gegen dieses Joch und versuchten es abzuschütteln. Das hat sich bis heute nicht geändert: Die Anmassung der Herrschenden und die Rebellion der Unterdrückten gehören zu den Ursachen für viele Kriege auf der Erde.
Aber Gott will uns mit den Mitteilungen dieses Kapitels nicht in erster Linie über die Ereignisse informieren, die sich damals in jenen Gegenden abspielten. Es geht Ihm vielmehr um den gläubigen Lot, der sich in Sodom aufhielt. Weil er in jener Stadt wohnte, wurde er in den Konflikt hineingezogen (Vers 12). Der Heilige Geist benutzt die Situation von Lot, um uns Christen auf eine ernste Gefahr hinzuweisen.
Wovor will der Herr uns warnen? Sodom und das böse, sündige Verhalten seiner Bewohner sind ein Bild der Welt. Lot liebäugelte zuerst nur mit dem Wohlstand der Welt. Er meinte, von der Fruchtbarkeit der Ebene des Jordan profitieren zu können, ohne von Sodom und seinen Bewohnern beeinflusst zu werden. Aber er täuschte sich. Wenn wir der Welt den kleinen Finger geben, nimmt sie schnell die ganze Hand. So wurde Lot richtiggehend in die Stadt Sodom hineingezogen, bis er schliesslich dort wohnte. Nun traf ihn auch das Schicksal von Sodom. Möchten wir uns warnen lassen und uns entschieden von der Welt getrennt halten!
Abraham rettet Lot
Abram, der abgesondert von der Welt unter den Terebinthen Mamres wohnte, wurde nicht in die kriegerischen Auseinandersetzungen der Völker hineingezogen. Als er jedoch hörte, dass Lot in Gefangenschaft geraten war, unternahm er sofort etwas, um ihn zu retten. Wie Abram mit 318 Mann das Heer Kedorlaomers und seiner Verbündeten besiegen und die verschleppten Bewohner von Sodom befreien konnte, wissen wir nicht. Sicher ist, dass Gott den Glauben Abrams mit diesem Sieg belohnte.
Als Abram vom Kampf zurückkehrte, kam ihm Melchisedek, der König von Salem, entgegen und stärkte ihn mit Brot und Wein. Dann segnete er ihn im Namen Gottes, des Höchsten. Dadurch bestätigte Gott das Verhalten des Patriarchen gegenüber seinem Bruder Lot und stärkte ihn im Blick auf die Gefahr, die ihm durch das Angebot von der Welt drohte. Abram merkte, dass Melchisedek ein Priester Gottes war, und gab ihm den Zehnten von der Beute. Aus Hebräer 7,1-3 wissen wir, dass diese Person ein Vorausbild auf den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, ist. In der Zukunft wird Er seinen Priesterdienst nach der Weise Melchisedeks ausüben.
Nach dem Zusammentreffen mit Melchisedek begegnete Abram dem König von Sodom. Dieser machte ihm einen Vorschlag: «Gib mir die Seelen, und die Habe nimm für dich.» Da lehnte Abram entschieden ab und entzog sich damit dem Einfluss der Welt, der sich bei Lot so verheerend ausgewirkt hatte. Seine Verbündeten im Kampf mochten ihren Anteil haben, doch er wollte von der Welt nichts annehmen.
Gott verspricht Abraham einen Sohn
War Abram zu weit gegangen, als er das Angebot der Welt zurückgewiesen hatte? Nein! Gott beruhigte ihn mit dem tröstlichen «Fürchte dich nicht!» Weil Abram den Herrn geehrt hatte, wurde er nun von Gott selbst geehrt. Er wusste zwar nicht, wie das gehen sollte, da er gar keinen Sohn hatte.
Aber als der Herr ihn aus dem Zelt herausführte und seine Blicke zum Sternenhimmel lenkte, glaubte er dem, was der Herr ihm versprochen hatte. Ja, sein Glaube war «gegen Hoffnung» und «auf Hoffnung» (Römer 4,18). Gott belohnte dieses Vertrauen, indem Er es ihm zur Gerechtigkeit rechnete (Vers 6; Römer 4,20-22).
Die Verse 9-21 sind die göttliche Antwort auf die Frage Abrams: Woran soll ich erkennen, dass ich das Land Kanaan besitzen werde? Die erwähnten Tiere finden wir in 3. Mose bei den Anweisungen der verschiedenen Opfer wieder. Sie alle reden vom Opfertod des Herrn Jesus als der Grundlage für die Erfüllung der göttlichen Verheissungen. Am Schluss des Abschnitts lesen wir vom Bund, den Gott mit Abram schloss – ein Bund, bei dem Gott keine Bedingungen an den Menschen stellte, sondern sich allein verpflichtete. Es war ein Bund der Gnade, der auf der Grundlage von Golgatha dem Volk Israel das verheissene Land zusicherte!
Bis zum Zeitpunkt, an dem die Nachkommen Abrams das Land Kanaan in Besitz nehmen würden, sollte noch viel passieren. Die Verse 12-14 reden von der Versklavung des Volkes Israel in Ägypten. Nach 400 notvollen Jahren würde Gott sie aus Ägypten erlösen und ins verheissene Land zurückführen.
Hagar und Ismael
In Kapitel 15 wurde Abrams Glaube sichtbar. Hier aber finden wir seinen Unglauben. Der Mangel an Geduld und Ausharren bewogen Sarai und Abram, selbst zu handeln. Unglaube und Ungeduld gehen oft Hand in Hand. Aber echter Glaube wartet auf den Herrn. «Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen» (Jesaja 28,16).
Sarai und Abram meinten, Gott nachhelfen zu müssen. Doch aus ihrem eigenmächtigen Handeln entstanden nur Probleme. Wir sehen, wie alle Beteiligten fleischlich, d.h. aus ihrer alten Natur heraus, handelten.
Als Hagar ihre Herrin verachtete, wurde sie hart behandelt. Da floh sie in die Wüste. Obwohl sie ihre missliche Lage zum Teil selbst verschuldet hatte, war sie doch die schwächste von den Dreien. Gott begegnete ihr in seinem Erbarmen durch einen Engel. Dieser hiess sie, zu Sarai zurückzukehren, und gab ihr Verheissungen im Blick auf den Sohn, den sie gebären würde. Da nannte sie den Herrn: «Du bist ein Gott des Schauens», denn Er hatte ihr in ihrem schwierigen Leben wieder eine Perspektive gegeben.
Im Neuen Testament finden wir die geistliche Bedeutung von Hagar und Sarai. Hagar ist ein Bild des Bundes vom Sinai und damit ein Hinweis auf den Grundsatz des Gesetzes. Der Hochmut Hagars zeigt den Stolz des Menschen, der sich auf das Gesetz etwas einbildet. Ihre spätere Flucht macht klar, dass der Mensch nicht bereit ist, sich dem Willen Gottes im Gesetz zu unterstellen. Sarai dagegen spricht von der Gnade, unter der wir jetzt leben (Galater 4,22-31).
Gott wiederholt sein Versprechen
Zwischen 1. Mose 16,16 und 17,1 liegen 13 Jahre des Lebens Abrams. Über diese Zeit berichtet uns die Bibel nichts.
Nun stellte sich der Herr dem Patriarchen als der Allmächtige vor. Abraham und Sara konnten in ihrem Alter biologisch gesehen kein Kind mehr bekommen (Römer 4,19). Aber der Allmächtige vermag auch da Leben zu geben, wo es aus der Sicht des Menschen nicht mehr möglich ist. «Da fiel Abram auf sein Angesicht.» Er demütigte sich vor Gott über seinen mangelhaften Glauben in Kapitel 16. Nun wollte er mit dem Allmächtigen rechnen.
Da bekam der Patriarch einen neuen Namen: Abraham (= Vater einer Menge). Gott wollte den irdischen Nachkommen Abrahams, dem Volk Israel, das Land Kanaan geben. Gleichzeitig sollte Abraham auch der Vater aller werden, die glauben würden wie er (Römer 4,12).
Als Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham und seinen Nachkommen hier schloss, sollte jeder Männliche bei ihnen beschnitten werden. Dieses äussere Zeichen, das Gott bestimmte und forderte, hat eine wichtige geistliche Bedeutung für uns. Die Beschneidung spricht von der vollständigen Verurteilung unseres natürlichen Zustands. Das Fleisch in uns ist zu gar nichts Gutem fähig. Alles, was wir aus uns selbst heraus tun, ist wertlos und unbrauchbar für Gott. Dies einzusehen, ist ein schmerzhafter Prozess. Doch er ist nötig, damit wir als Glaubende für Gott nützlich werden. Wir müssen dahin kommen, alles von Gott und unserem Herrn zu erwarten (Johannes 15,5).
Die Beschneidung
Auch Sarai bekommt von Gott einen neuen Namen. «Sara (= Fürstin) soll ihr Name sein.» Von ihr würde Abraham einen Sohn bekommen. Durch diesen Nachkommen soll der von Gott verheissene Segen wahr werden.
Das kann Abraham nicht fassen. Lachend fällt er auf sein Angesicht und sagt zu Gott: «Möge doch Ismael vor dir leben!» Doch der Allmächtige erklärt ihm mit aller Deutlichkeit: Die unfruchtbare und alt gewordene Sara soll einen Sohn gebären. Dieser soll Isaak (= Lacher) heissen. Er wird der Träger der Verheissungen sein.
Der souveräne Gott vergisst auch Ismael nicht. Er soll ebenfalls gesegnet sein. Doch den Bund wird der Herr mit Isaak, dem Sohn von Sara, errichten.
In den Worten, die Gott in den Versen 15-21 an Abraham richtet, erkennen wir, wie Er dem Kleinglauben und den väterlichen Empfindungen seines Knechtes mit herzlichem Erbarmen und grenzenloser Güte begegnet.
Der Patriarch gehorcht den Worten des Allmächtigen und beschneidet alle Männlichen seines grossen Haushalts: Abraham selbst wird als 99-Jähriger beschnitten, ebenso sein 13-jähriger Sohn Ismael. Dann werden auch alle seine Knechte und die Fremden, die nur für eine Zeit als Arbeiter bei ihm sind, beschnitten. Alle werden in diesen Bund eingeschlossen. Seine geistliche Bedeutung gilt für jeden von uns: Das Fleisch, d.h. die gefallene menschliche Natur, nützt nichts (Johannes 6,63).
Gott besucht Abraham
Kurze Zeit nachdem Gott sich dem Patriarchen als der Allmächtige offenbart hat, bekommt Abraham Besuch von drei Männern. Der alte Mann muss gemerkt haben, dass einer von ihnen der Herr selbst ist. Er redet Ihn entsprechend an: «Herr, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen …» Man hat den Eindruck, dass dieser hohe Besuch eine göttliche Antwort auf den Glaubensgehorsam von Abraham in Kapitel 17 ist.
Die Gastfreundschaft Abrahams ist beeindruckend. Er bietet den Männern Erfrischung an und lädt sie zum Essen ein. Die ganze Szene zeugt von Energie und Sorgfalt, aber auch von Ehrerbietung. Abraham weiss, wen er vor sich hat, und zeigt ein gutes Empfinden für das, was in der Gegenwart des Herrn angemessen ist.
Während der Herr mit Abraham spricht, zeigt Sara ihren Kleinglauben. Ein unhörbares Lachen des Unglaubens ist ihre Antwort auf die Worte des Herrn: «Sara, deine Frau, wird einen Sohn haben.» Und der Herr? Er beweist, dass Er auch ein Lachen im Innern sieht, fügt dann aber ein Wort hinzu, das von seiner Allmacht und Güte zeugt: «Ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar?» Wie mancher geprüfte Gläubige ist seither durch dieses Wort ermuntert worden!
Bereits in 1. Mose 15,4 hat der Herr Abraham einen eigenen Sohn versprochen. In 1. Mose 17,19 hat Gott sein Wort wiederholt und hinzugefügt, dass er ihn Isaak nennen soll. Hier redet Gott zum dritten Mal davon und sagt zweimal: «Sara wird einen Sohn haben.» Wie gnädig ist doch unser Gott! Wie viel Geduld hat Er mit uns!
Abraham tritt für Sodom ein
Nach dem Essen machen sich die Männer auf den weiteren Weg. Abraham begleitet sie ein Stück weit. Sie blicken in Richtung Sodom. Was haben sie dort im Sinn? Der Herr weiht den Glaubensmann, der in der Bibel mehrmals als Freund Gottes bezeichnet wird (2. Chronika 20,7; Jesaja 41,8; Jakobus 2,23), in seine Pläne ein. Das sündige Verhalten der Bewohner von Sodom und Gomorra hat ein solches Mass erreicht, dass das göttliche Gericht kommen muss.
Abraham weiss, dass sein Neffe Lot in Sodom wohnt. Früher, als Lot mit der Welt in Gefangenschaft geraten war, zog Abraham in grosser Eile aus, um ihn zu befreien. Leider blieb Lot nach seiner Befreiung in Sodom. Jetzt steht das Gericht Gottes bevor. Kann Abraham noch irgendetwas für Lot tun? Ja, er kann vor dem Herrn in Fürbitte für ihn einstehen. Und das tut er auch, indem er Gott fragt: «Willst du den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen?» Er denkt dabei an den unglücklichen, aber gläubigen Lot, der sich in der Welt verloren hat (2. Petrus 2,7.8).
Wie schön ist die Haltung Abrahams vor dem Herrn! Er bekennt: «Ich bin Staub und Asche.» Staub zeigt auf, wie klein der Mensch vor Gott ist. Abraham ist sich bewusst, dass er wohl in Fürbitte zu Ihm beten darf, aber Ihm nichts vorschreiben kann. Asche spricht von Buße. Abraham demütigt sich vor Gott, weil er eine gewisse Mitschuld am verkehrten Weg seines Neffen erkennt. Ist vielleicht durch die Reise nach Ägypten in Lot das Verlangen nach der Welt geweckt worden (1. Mose 13,10)?
Lot bekommt Besuch
Zu Beginn des Kapitels erfahren wir, dass die beiden Männer, die den Herrn begleitet und mit Ihm Abraham besucht haben, Engel sind. Während Abraham in Fürbitte vor dem Herrn stehen geblieben ist, sind die beiden als Ausführer des göttlichen Gerichts nach Sodom weitergegangen.
Dort treffen sie Lot, wie er im Tor, d.h. in der Stadtverwaltung, sitzt. Er lädt die beiden Männer spontan ein. Doch sie lehnen ab. Erst auf das Drängen Lots kehren sie in sein Haus ein. Das Einzige, was er ihnen vorsetzt, sind ungesäuerte Kuchen. Welch ein Unterschied zum festlichen Essen bei Abraham!
Dann zeigt sich die ganze Bosheit der Bewohner Sodoms. Sie umringen das Haus von Lot und wollen sich an den Fremden vergehen. Und Lot? Er versucht seine Gäste zu verteidigen, indem er den Männern von Sodom etwas vorschlägt, das vor Gott ebenso böse ist. Hat Lot kein Empfinden für die Sünde mehr?
In dieser Auseinandersetzung muss Lot auch das Urteil der Welt über sich anhören: Sie hat ihn nie als einen der Ihren angesehen. Hätten die Engel nicht eingegriffen, wäre Lot selbst ein Opfer der aufgebrachten Menge geworden.
Nun erfährt er von ihnen, dass sie zum Gericht gekommen sind. Er bekommt die Gelegenheit, seine Schwiegersöhne und verheirateten Töchter auf die Gefahr hinzuweisen. Doch es zeigt sich jetzt, dass seine warnenden Worte wegen seines weltlichen Lebens wirkungslos sind: «Er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt.»
Lot flieht nach Zoar
Merkt Lot nicht, wie ernst die Lage ist? Er hat zwar seine Verwandten gewarnt. Aber er selbst zögert, die böse Stadt zu verlassen. Schliesslich müssen die beiden Engel sowohl Lot als auch seine Frau und seine beiden unverheirateten Töchter an der Hand nehmen und gewaltsam aus Sodom hinausbringen. Weil Lot an den Herrn glaubt, erfährt er das göttliche Erbarmen (Vers 16). Doch er gehört zu den Glaubenden, von denen es in 1. Korinther 3,15 heisst, dass sie «gerettet werden, doch so wie durchs Feuer». Es bleibt ihm nur das nackte Leben, sonst nichts – auch nichts für Gott und keinerlei Lohn! Wie traurig und welch eine ernste Warnung an uns!
Lot fürchtet sich, auf das Gebirge zu fliehen. Will er einer Begegnung mit Abraham ausweichen? Schliesslich darf er sich in der kleinen Stadt Zoar in Sicherheit bringen. Doch seine Frau kommt nicht ans sichere Ziel. Sie handelt gegen die klare Anweisung des Engels: «Sieh nicht hinter dich, und bleib in der ganzen Ebene nicht stehen!» Sie schaut zurück und wird zur Salzsäule. Ihr Schicksal dient als ernste Warnung für alle, die mit den Gläubigen mitlaufen, ohne sich je zu bekehren. Sie besitzen kein göttliches Leben und werden deshalb ewig verloren gehen. «Erinnert euch an Lots Frau!» (Lukas 17,32).
Als Lot in Zoar ankommt, fällt das Gericht Gottes in Form von Feuer und Schwefel auf die Städte Sodom und Gomorra. Gott kehrte diese Städte um (Vers 25). Heute liegt in jener Ebene das Tote Meer.
Lot und seine Töchter
Als Abraham früh am nächsten Morgen in Richtung Sodom und Gomorra blickt, sieht er Rauch aufsteigen, «wie der Rauch eines Schmelzofens». Da weiss er, dass es nicht einmal zehn Gerechte in jenen Städten gehabt hat (1. Mose 18,32). Ob er erfahren hat, dass Lot gerettet wurde, teilt uns die Bibel nicht mit. Was wir aber sicher wissen, steht in Vers 29: «Gott gedachte an Abraham und entsandte Lot mitten aus der Umkehrung.» Gott hat auf die Fürbitte Abrahams geantwortet. Lot wurde gerettet. So wollen auch wir nicht aufhören, für gläubige Angehörige und Bekannte zu beten, die sich in der Welt verloren haben.
Die Schlussverse des Kapitels beschreiben das traurige Ende von Lot. Sie zeigen uns etwas von den Folgen eines Lebens in der Welt: Furcht anstatt Ruhe in Gott (Vers 30) und schreckliche Unmoral. Diese geht oft Hand in Hand mit übermässigem Alkoholgenuss. Die Töchter Lots denken und handeln ganz «nach der Weise aller Welt».
Die Söhne der Töchter Lots, die von ihrem Vater schwanger geworden sind, werden die Stammväter von zwei Völkern: Moab und Ammon. Beide Nationen werden zu ständigen Feinden des irdischen Volkes Gottes. Über den Tod von Lot teilt uns die Bibel nichts mit.
Beim Lesen dieser Mitteilungen in Gottes inspiriertem Wort denken wir an einen Vers aus dem Neuen Testament: «Alle diese Dinge … sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist» (1. Korinther 10,11).
Abraham bei Abimelech
Auf seinen Zügen durch das Land Kanaan kam Abraham nach Gerar, ins Gebiet des Philisterkönigs Abimelech. Dort fiel er wieder in die gleiche Sünde wie zur Zeit, als er nach Ägypten gezogen war: Er verleugnete seine Frau und sagte, sie sei seine Schwester. Weshalb log er zum zweiten Mal? Die Antwort scheint in Vers 13 zu liegen. Als der heidnische König ihn wegen seines Betrugs zur Rede stellte, teilte ihm Abraham die trügerische Übereinkunft zwischen sich und seiner Frau mit, die sie schon in Ur getroffen hatten. Sie bestand immer noch und war die Wurzel der Sünde, die er nun ein zweites Mal beging. Bis jetzt hatte er sie noch nicht verurteilt. So etwas gehört aber nicht ins Leben eines Gläubigen. Es muss gerichtet und beseitigt werden.
Glücklicherweise griff Gott ein. Er drohte Abimelech mit dem Tod, weil er Sara einfach genommen hatte, und hinderte den König daran, die Sünde des Ehebruchs zu begehen. So bekam Abraham seine Frau wieder zurück, ohne dass ihr etwas passiert war. Aber Gott konnte Abraham den Vorwurf aus dem Mund des heidnischen Mannes nicht ersparen. Wenn die Welt uns Gläubige zu Recht tadeln muss, ist das immer beschämend und keineswegs zur Ehre Gottes. Möge der Herr uns jeden Tag helfen, gerecht vor Ihm zu leben.
Trotz der Untreue Abrahams bekannte sich Gott zu ihm, denn Er sagte zu Abimelech: «Er ist ein Prophet und wird für dich bitten.» Als Abraham dann zu Gott betete, wirkte der Allmächtige zu Gunsten des heidnischen Königs und seines ganzen Hauses (Vers 17).
Isaak wird geboren
Zu der von Gott bestimmten Zeit wird Isaak geboren. Man kann sich die Freude der hochbetagten Eltern gut vorstellen. Das Lachen Saras ist kein Lachen des Unglaubens mehr, sondern ein Lachen des frohen Glaubens. Das Wort des Herrn: «Ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar?», hat in ihrem Herzen Glauben hervorgebracht (Hebräer 11,11). Und Gott hat in seiner Güte und Treue ein Wunder gewirkt.
Sobald Isaak heranwächst, gibt es Probleme mit seinem älteren Bruder Ismael, der den Kleinen verspottet. Die Reaktion Saras ist menschlich genauso verständlich wie die Empfindungen Abrahams, der beide Söhne liebte. Nun greift Gott ein und sagt, was zu tun ist. Hagar und ihr Sohn müssen weggeschickt werden. Doch die Verse 14-21 zeigen, wie Gott seine Verheissungen über Ismael erfüllt.
Für uns ist es wichtig, die geistliche Bedeutung zu verstehen, die in Sara und Isaak beziehungsweise Hagar und Ismael liegt, wie Galater 4,22-31 sie uns zeigt. Hagar illustriert das Gesetz vom Sinai. Ismael stellt den Menschen nach dem Fleisch dar, der versucht, aus eigener Kraft das Gesetz zu halten und so die Anerkennung Gottes zu finden. Doch wegen der Sünde, die im Menschen wohnt, schafft das keiner. Sara steht für den Grundsatz der Gnade. Isaak ist ein Bild derer, die die Gnade im Glauben für sich in Anspruch nehmen.
Die beiden Grundsätze – Gesetz und Gnade – sind unvereinbar. Wer meint, der geschenkten Errettung durch sein Tun noch etwas hinzufügen zu müssen, zerstört die Gnade.
Abrahams Bund mit Abimelech
Dieser Abschnitt weist prophetisch auf das Tausendjährige Reich hin. Abimelech stellt die Nationen und Abraham das Volk Israel dar, das in der Zukunft eine Vorrangstellung einnehmen wird. So wie Abimelech anerkennt, dass Gott in allem mit Abraham ist (Vers 22), so werden einmal die Völker der Erde anerkennen, dass Gott mit Israel ist und seine Ansprüche an die Erde durch dieses Volk geltend machen wird.
Abimelech sucht das Wohlwollen Abrahams. In der Zukunft werden die Nationen wissen, dass sie nur dann gesegnet werden, wenn sie Israel und seinen Gott ehren. Deshalb werden sie Jahr für Jahr zum Laubhüttenfest nach Jerusalem hinaufziehen (Sacharja 14,16-19).
Wir können aus diesen Versen auch praktische Belehrungen für uns entnehmen. In Abraham sehen wir einen Gläubigen, der zwar versagt hat (1. Mose 20), sich sonst jedoch vorbildlich verhält, so dass die Welt anerkennend sagt: «Gott ist mit dir in allem, was du tust.» Wie schön wäre es, wenn auch wir ein so gutes Zeugnis von denen hätten, die draussen sind (1. Timotheus 3,7).
Vers 25 gibt uns eine weitere praktische Lektion. Der Glaubende kämpft nicht für seine Rechte in dieser Welt (Matthäus 5,40). Aber er darf auf ein Unrecht, das ihm zugefügt worden ist, aufmerksam machen (Johannes 18,23).
Wie ermunternd ist Vers 33! Abraham pflanzte eine Tamariske und bezeugte dadurch seinen Glauben an die Verheissungen Gottes. Das Land sollte einmal seinen Nachkommen gehören.
Abrahams Glaube wird erprobt
Wir haben hier einerseits den Höhepunkt im Glaubensleben von Abraham und anderseits einen prophetischen Hinweis auf das, was am Kreuz von Golgatha geschah, als der Herr Jesus den Opfertod erlitt. Mit Ehrfurcht denken wir an beide Seiten.
Durch die Prüfung, die Gott über Abraham brachte, zeigte sich, dass der Glaube des Patriarchen auch der grössten Belastungsprobe standhielt. Gott verlangte wohl das Schwerste von Abraham. Doch ohne zu zögern und ohne Fragen zu stellen, stand er frühmorgens auf und machte sich mit Isaak auf den Weg nach Morija. Das letzte Stück des Weges legten Vater und Sohn allein zurück. Da stellte Isaak die Frage nach dem Schaf zum Brandopfer. Die Antwort des Vaters macht klar, wie er seinem Gott unerschütterlich vertraute. Ohne sich zu wehren, liess sich Isaak binden und auf den Altar legen. Als Abraham seine Hand mit dem Messer ausstreckte, griff der Herr ein.
Diese Begebenheit erinnert an Golgatha. Doch wir müssen zugeben, dass wir das Geschehen dort nie ganz erfassen werden. Wir gleichen den Knaben, die zurückbleiben mussten (Vers 5). Das Holz, das Abraham auf Isaak legte, betont, dass ein Mensch am Kreuz unsere Stelle im göttlichen Gericht einnehmen musste, damit unsere Sünden gesühnt werden konnten. Das Feuer und das Messer reden vom Gericht, mit dem der heilige Gott Sünden bestrafen und die Sünde verurteilen muss. In den drei Stunden der Finsternis am Kreuz entlud sich dieses Gericht über den Heiland. Doch auf dem ganzen Weg gingen Vater und Sohn miteinander (Johannes 16,32).
Abrahams Glaube wird belohnt
Nach bestandener Erprobung seines Glaubens durfte Abraham anstelle seines Sohnes einen Widder opfern, der sich im Gestrüpp verfangen hatte. Mit welcher Erleichterung gab der Patriarch jenem Ort den Namen «Der Herr wird ersehen». Ja, für Isaak hatte Gott einen Ersatz vorgesehen. Doch für unseren Erlöser gab es keinen Stellvertreter. Er musste leiden und sterben. Er allein konnte dieses unermesslich grosse und schwere Werk vollbringen. Wir bewundern Ihn, dass Er es getan hat!
Nun kam der Herr ein zweites Mal in der Gestalt eines Engels zu Abraham und belohnte ihn für seinen Gehorsam. Weil er bis zum Äussersten gegangen war, überschüttete ihn der Herr mit reichem Segen und verhiess ihm eine grosse Nachkommenschaft. Im Blick auf den Herrn Jesus und die Ergebnisse seines Opfertodes denken wir an Jesaja 53,11: «Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen.» Diese Frucht umfasst alle Erlösten!
In Vers 18 ist von einem Nachkommen in Einzahl die Rede. Nach Galater 3,16 ist dieser Nachkomme Christus selbst. Von Ihm, in Ihm und durch Ihn werden im Tausendjährigen Reich alle Nationen gesegnet werden.
In Vers 19 wird zum dritten Mal in diesem Kapitel von einem «Miteinander» gesprochen. Jetzt sind die Knaben – ein Bild der Glaubenden – auch dabei. Ja, «unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus» (1. Johannes 1,3).
In Vers 23 wird Rebekka erwähnt. Sie weist auf die Versammlung hin, die auch zur Frucht des Opfertodes von Jesus Christus gehört.
Saras Tod und Begräbnis
Mit 127 Jahren starb Sara, die Frau Abrahams, mit der er jahrzehntelang den Weg des Glaubens gegangen war. Sie war schon seine Frau, als Abraham in Mesopotamien von Gott berufen wurde, sein Land, seine Verwandtschaft und das Haus seines Vaters zu verlassen, um in das Land zu ziehen, das Gott ihm zeigen wollte. Wie vieles hatten die beiden gottesfürchtigen Eheleute, die selber nicht fehlerlos waren, miteinander und mit ihrem Gott erlebt! Nun war Abraham allein. Wir verstehen seine Trauer und seine Tränen. Aber er glaubte an eine Auferstehung. Deshalb wurde er von der Trauer nicht überwältigt.
Wo sollte er seine Tote begraben? Er besass ja kein Stück Land! Wie Abraham beim Kauf des Feldes mit den heidnischen Bewohnern Kanaans verhandelte, ist sehr lehrreich für unseren Umgang mit ungläubigen Menschen der Welt. Er bekannte von sich: «Ich bin ein Fremder.» Als Himmelsbürger sind wir hier ebenfalls Fremde. Die Kinder Heth antworteten ihm: «Du bist ein Fürst Gottes unter uns.» Sie anerkannten die Würde und das korrekte Verhalten dieses Gläubigen. Zweimal heisst es, dass Abraham sich vor dem Volk des Landes verneigte. Wir sollen unseren Mitmenschen mit der nötigen Ehrerbietung begegnen, ihre Rechte respektieren und ihnen das geben, was ihnen zusteht. Als Ephron ihm das Feld mit der Höhle von Machpela schenken wollte, bestand Abraham darauf, es zum vollen Preis zu kaufen. Er hatte früher schon einmal die Geschenke der Welt abgelehnt (1. Mose 14,21-24). Nachdem der Kauf offiziell abgeschlossen war, konnte Abraham seine Sara begraben.
Abrahams Auftrag an seinen Knecht
In diesem Kapitel zeigt uns der Heilige Geist, was Abraham unternahm, damit sein Sohn die von Gott gewollte Frau bekam. Einerseits können gläubige Menschen, die «im Herrn» heiraten möchten, aus dieser Begebenheit wichtige Grundsätze zur Heirat erkennen. Anderseits ist Rebekka, die die Frau Isaaks wird, ein schönes Bild der Versammlung und ihrer Beziehung zum Herrn Jesus.
Es liegt Abraham sehr daran, dass Isaak keine Kanaaniterin heiratet, sondern jemand aus seiner Verwandtschaft. Deshalb schickt er seinen wichtigsten Knecht mit einem Auftrag nach Mesopotamien, wo die Verwandten Abrahams leben. Der Knecht geht und nimmt «allerlei Güter» mit, die den Reichtum seines Herrn beweisen. Sobald er am Ziel – bei der Stadt Nahors – ankommt, betet er zu Gott, damit Er ihm die richtige Frau zeige.
Die ernsten Worte Abrahams an seinen Knecht unterstreichen die klare Aussage aus 2. Korinther 6,14: «Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen.» Ein Gläubiger oder eine Gläubige soll niemals eine eheliche Verbindung mit einem ungläubigen Partner eingehen. Auf einer solchen Ehe, vor der uns die Bibel warnt, kann der göttliche Segen nicht ruhen.
Ausserdem möchte Gott, dass die Heirat eines gläubigen Mannes mit einer gläubigen Frau von Ihm ausgeht. Wie wichtig ist es daher, dass der Mann diese wichtige Entscheidung zuerst im Gebet mit dem Herrn bespricht, damit Gott ihm die Frau zeigen kann, die Er für ihn vorgesehen hat.
Die Begegnung mit Rebekka
Kaum hat der Knecht Abrahams sein Gebet beendet, kommt eine ihm unbekannte junge Frau zum Brunnen. Sie reagiert genau so, wie er es im Gebet zu Gott gesagt hat. Wir verstehen gut, dass es heisst: «Der Mann sah ihr staunend zu.» War dies bereits die Antwort auf sein Gebet?
Die Verse 15-21 sind eine Ermunterung für jeden gläubigen Mann, der den Weg in die Ehe mit dem Herrn gehen möchte. Wenn du die Angelegenheit zu einem aufrichtigen Gebetsanliegen machst und bereit bist, auf den Herrn zu warten, wird Er dir antworten. Er hat sich seit den Tagen Abrahams nicht verändert.
Was tut der Knecht, nachdem er erfahren hat, wer Rebekka ist? Er dankt dem Herrn und preist Ihn für seine Güte. Und wir? Kommt es nicht manchmal vor, dass wir aus Freude über die Erhörung unserer Bitten das Danken vergessen?
Nun nimmt die Sache, die am Brunnen vor der Stadt ihren Anfang genommen hat, ihren weiteren Verlauf. Nachdem Rebekka zu Hause alles erzählt und die kostbaren Geschenke gezeigt hat, läuft ihr Bruder Laban zur Quelle und lädt den Knecht Abrahams ein.
Rebekka weist in der vorbildlichen Bedeutung auf die Versammlung Gottes hin. Doch in diesen Versen ist sie vor allem ein Bild von jungen Gläubigen, die von Christus und dem geistlichen Reichtum, der in Ihm zu finden ist, noch wenig wissen. Doch der Heilige Geist, den wir im Knecht Abrahams sehen können, bemüht sich, ihre Herzen für den Herrn Jesus zu gewinnen.
Der Knecht berichtet
Nun wird der Knecht Abrahams als Gast ins Haus der Familie von Bethuel aufgenommen und mit allem Nötigen versorgt. Doch vor dem gemeinsamen Essen möchte er seinen Auftrag loswerden. Man ermuntert ihn: «Rede!» Dann erzählt er alles. Er beginnt mit einer Beschreibung Abrahams und seines grossen Reichtums, den er seinem Sohn Isaak übergeben hat. Dann spricht der Knecht von seinem Auftrag. Zuletzt berichtet er von seinen persönlichen Erfahrungen mit Gott und von der Begegnung mit Rebekka. Für ihn ist die Sache klar (Vers 48). Doch entscheiden muss die Familie Bethuels.
Was hat das Verhalten des Knechts einem Mann zu sagen, dem im Gebet und in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus klar geworden ist, wer seine Frau werden soll? Wenn er nun mit dieser Person spricht, ist es wichtig, dass er nicht mit seinen Erfahrungen und seiner Überzeugung beginnt. Damit würde er die Frau, die davon bis jetzt nichts weiss, unter Druck setzen. Der Mann soll wirklich um die Frau werben, wie es hier der Knecht Abrahams tut.
Wenn wir an den Heiligen Geist denken, der uns im Knecht vorgestellt wird, dann sehen wir in seinem Verhalten das Bemühen des Geistes um uns. Er will uns durch das geschriebene Wort den unendlichen Reichtum und die Grösse unseres Gottes und Vaters vorstellen. Er möchte uns aber auch die ewige Beziehung der Liebe zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn, zeigen. Das grosse Ziel seines Wirkens ist, die Zuneigungen unserer Herzen für den Herrn Jesus zu wecken, dem wir durch den Glauben gehören.
Rebekka wird die Frau von Isaak
Nachdem der Knecht ausgeredet hat, anerkennt die Familie Bethuels: «Von dem Herrn ist die Sache ausgegangen.» Für sie gibt es keinen offensichtlichen Grund, der Heirat Rebekkas mit Isaak nicht zuzustimmen. Wie froh ist der Knecht über diese Antwort! Überwältigt von der Güte Gottes beugt er sich zur Erde nieder. Dann packt er die vielen mitgebrachten Kostbarkeiten aus und gibt sie nicht nur Rebekka, sondern auch ihrem Bruder und ihrer Mutter.
Dieser Schmuck spricht bildlich vom «unergründlichen Reichtum des Christus» (Epheser 3,8). Der Heilige Geist stellt uns diesen himmlischen Schatz vor, um unsere Herzen für den Herrn Jesus zu erwärmen und sie mit Ihm im Himmel zu verbinden.
Am nächsten Morgen will der Knecht mit Isaaks Braut zurückkehren. Rebekka ist bereit, zu dem zu gehen, den sie durch die Erzählung des Knechts kennen gelernt und der ihr Herz gewonnen hat. Es ist ihre persönliche Entscheidung (1. Mose 24,57.58).
Über die lange Reise wird uns nichts berichtet. Die Schlussverse des Kapitels beschreiben das Zusammentreffen von Rebekka mit Isaak und wie sie seine Frau wurde, die er lieb hatte. Wie rein und schön ist der Anfang dieser Ehe! Wenn gläubige Menschen sich heute im Blick auf Heirat und Ehe nach den biblischen Anweisungen richten und auf den Herrn warten, werden sie ebenfalls solch schöne Erfahrungen machen. – In der geistlichen Anwendung reden diese Verse vom Augenblick, an dem das «Ausharren des Christus» ein Ende hat und Er die Versammlung zu sich heimholen wird.
Abrahams Tod und Begräbnis
Wann Abraham seine Nebenfrau Ketura geheiratet hat, ist aus dem ersten Buch Mose nicht ersichtlich. Aus 1. Chronika 1,28-34 kann man wohl schliessen, dass Ketura zu Lebzeiten von Sara eine Nebenfrau Abrahams war. Sie wird jedoch erst jetzt erwähnt, um das prophetische Bild vollständig zu machen. Die Söhne der Ketura sprechen von den Nationen, die im Tausendjährigen Reich unter der Regierung des Herrn Jesus in den Genuss des Segens Abrahams kommen (1. Mose 22,18).
Vor seinem Tod regelte Abraham seinen Nachlass. Der Haupterbe war Isaak. Doch auch die Söhne der Nebenfrauen gingen nicht leer aus. Abraham sorgte dafür, dass sie zu seinen Lebzeiten von Isaak wegzogen. Es sollte keinen Streit unter den Erben geben.
Abraham starb im Alter von 175 Jahren. Seine beiden Söhne Ismael und Isaak begruben ihn in der Höhle von Machpela, wo bereits Sara begraben worden war.
Von nun an lag der Segen Gottes auf Isaak, dem Sohn der Verheissung. Er wohnte beim Brunnen Lachai-Roi. Es ist der Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt (1. Mose 16,14). Wir denken an den Herrn Jesus. Er ist der Lebendige, von dem aller Segen zu uns Gläubigen fliesst.
Buchtipp: Abraham – der Freund Gottes
Struktur und Überblick
|
Kapitel 1: |
Der Herr beruft Jeremia zum Propheten. |
|
Kapitel 2 – 29: |
Gott kündigt das Strafgericht über Juda und Jerusalem an. |
|
Kapitel 30 – 33: |
Der Herr verheisst einen neuen Bund und das Friedensreich. |
|
Kapitel 34 – 39: |
Ereignisse und Weissagungen vor dem Fall Jerusalems |
|
Kapitel 40 – 45: |
Ereignisse und Weissagungen nach dem Fall Jerusalems |
|
Kapitel 46 – 51: |
Prophezeiungen über die Nationen |
|
Kapitel 52: |
Jerusalem wird erobert und zerstört. |
Buchtipp: Der Prophet Jeremia
Einleitung
Auf seiner zweiten Missionsreise kam Paulus mit Silas und Timotheus nach Thessalonich. Dort verkündete er an drei Sabbaten in der Synagoge der Juden das Evangelium von Jesus Christus. Einige Juden und viele gottesfürchtige Griechen glaubten dieser Botschaft. So entstand eine örtliche Versammlung. Doch die Juden widerstanden dem Apostel. Darum musste er Thessalonich nach kurzer Zeit wieder verlassen (Apostelgeschichte 17,1-10).
Um den Jungbekehrten weiterzuhelfen, schrieb der Apostel ihnen kurz nacheinander zwei Briefe. Er ermutigte sie, standhaft zu bleiben und für den Herrn zu leben. Zudem belehrte er sie über das Kommen des Herrn. Beide Briefe sind auch heute allen jungen Christen eine Hilfe für den Glaubensweg.
Glaube, Liebe, Hoffnung
Der erste Brief an die Thessalonicher ist ein Hirtenbrief. Darum nennt sich Paulus hier nicht Apostel, sondern stellt sich formlos neben Silvanus und Timotheus. In seiner Anrede erinnert er die Thessalonicher einerseits an ihre Beziehung zu Gott, dem Vater. Als seine Kinder genossen sie seine Liebe. Anderseits standen sie in einer Glaubensbeziehung zum Herrn Jesus Christus. Beides sind grosse Vorrechte aller Erlösten: Sie sind Kinder Gottes und Schafe des guten Hirten.
Paulus hatte viel Grund zum Danken, wenn er für die Thessalonicher zu Gott betete, denn in ihrem Verhalten entfaltete sich das neue Leben. Es waren sichtbare Früchte da (Werk, Bemühung, Ausharren), die aus einem verborgenen Leben des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung hervorkamen.
- Das Werk des Glaubens ist ein praktisches Leben, das von einer Glaubensbeziehung zu Gott gekennzeichnet ist. Alles, was wir tun, sollte einer gelebten Gemeinschaft mit Gott entspringen.
- Die Bemühung der Liebe ist der Einsatz für andere Christen, weil man sie liebt. Unsere Zuneigung zu ihnen ist das Motiv für unser Engagement.
- Das Ausharren der Hoffnung ist ein geduldiges Warten in schwierigen Situationen, weil wir den Herrn erwarten, der uns bald aus aller Not herausnimmt.
Diese Entfaltung des christlichen Lebens war der Beweis, dass Gott diese Glaubenden in der Ewigkeit für das christliche Teil auserwählt hatte (vergleiche Vers 4 mit Epheser 1,4).
Nachahmer, Vorbilder, Zeugen
Vers 5 beschreibt, wie Paulus in Thessalonich gearbeitet hatte. Er verkündete das Wort Gottes nicht in eigener Energie, sondern verhielt sich so, dass die göttliche Kraft unter der Leitung des Heiligen Geistes wirken konnte. Zugleich war er von der Botschaft, die er predigte, überzeugt. Er wusste: Das Evangelium ist die Wahrheit Gottes! Schliesslich stimmte sein Verhalten mit seiner Mitteilung überein. Diese Kennzeichen sind auch heute für jede Arbeit im Werk des Herrn Voraussetzung, damit Segen entstehen kann.
Die Verse 6 bis 8 stellen den Thessalonichern ein ausserordentliches Zeugnis aus. Sie waren Nachahmer von Paulus und des Herrn, indem sie trotz äusserer Anfechtungen das Wort Gottes freudig aufnahmen. So wurden sie durch ihr Verhalten den anderen Christen in Griechenland zu Vorbildern. Auch die Ungläubigen in dieser Gegend nahmen die Veränderung in ihrem Leben wahr. Ihr Glaube war ein eindrucksvolles Zeugnis in der Welt.
Sie hatten sich von den toten Götzenbildern zum lebendigen Gott bekehrt (Vers 9). Die Bekehrung beginnt mit einer Sinnesänderung, indem man sein sündiges Leben verurteilt. Dann folgt eine Umkehr. Man wendet sich vom Verkehrten ab und wendet sich Gott zu. Nach unserer Bekehrung dienen wir Gott, indem wir unser Leben unter seine Herrschaft stellen und Ihm gehorchen. Gleichzeitig warten wir auf das Kommen seines Sohnes, der einst für uns gestorben ist und uns vor den kommenden Zorngerichten zu sich in den Himmel nehmen wird.
Wie eine Mutter
Die Verse 1 bis 12 beschreiben zwei Aufgaben von Paulus. Als Evangelist verkündete er den Verlorenen die Botschaft der Errettung. Als Hirte sorgte er sich um das geistliche Wohl der jungbekehrten Christen.
Paulus war wegen des Evangeliums in Philippi mit vielen Schlägen geschlagen und ins Gefängnis geworfen worden. Trotzdem predigte er es in Thessalonich kühn weiter. Gott schenkte ihm aufs Neue diese Freimütigkeit und seine Arbeit war nicht vergeblich. Viele Menschen nahmen Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland an.
Was war der Ausgangspunkt für seine aufopfernde Arbeit in der Verkündigung des Evangeliums Gottes? Weder Betrug noch Unreinheit noch List veranlassten ihn dazu, sondern die Tatsache, dass Gott sein Auftraggeber war. Dieser hatte ihn mit dem Evangelium betraut. Darum tat er seine Aufgabe in erster Linie für Gott. Ihm wollte er gefallen.
Die Thessalonicher wussten, dass Paulus ihnen bei der Verkündigung des Wortes Gottes nicht geschmeichelt hatte. Und Gott sah in sein Herz und erkannte seine reinen Beweggründe: Er war in seinem Dienst weder auf Geld aus noch suchte er Ehre von Menschen.
Paulus vergleicht sich in Vers 7 mit einer Mutter, die ihre Kinder nährt und pflegt. Genauso versorgte er die jungen Christen mit der richtigen geistlichen Nahrung und kümmerte sich um sie in allen Nöten, die sie am Anfang ihres Glaubenslebens hatten.
Es beeindruckt uns, wie Paulus in Thessalonich wirkte. Ist er uns darin nicht ein grosses Vorbild?
Wie ein Vater
In seinem Verhalten stellt uns Paulus in Vers 8 zwei Voraussetzungen für einen segensreichen Dienst vor: Selbstverleugnung und Liebe zu den Menschen, denen wir helfen möchten. Da gilt es, die eigenen Wünsche aufzugeben, damit wir ganz für die andern da sein können. Wenn wir sie aufrichtig lieben, sind wir motiviert, ihnen in Hingabe zu dienen.
Paulus bewies seine Liebe zu den Thessalonichern dadurch, dass er auf sein Recht verzichtete, durch sie materiell versorgt zu werden (1. Korinther 9,14). Nacht und Tag arbeitete er als Zeltmacher, um ihnen nicht zur Last zu fallen. Sein gerechtes und untadeliges Verhalten gab seinen Worten Gewicht, denn das, was er verkündete, lebte er auch aus.
Wie ein Vater ermahnte er die Thessalonicher. Er stellte ihnen den richtigen Weg vor und warnte sie vor dem falschen. Weiter tröstete er sie. Er machte ihnen Mut, trotz Schwierigkeiten dem Herrn Jesus nachzufolgen. Schliesslich bezeugte er ihnen, würdig des Gottes zu leben, zu dem sie sich bekehrt hatten. Was bedeutet das im Alltag? Durch unser Verhalten soll gesehen werden, dass wir mit dem lebendigen und wahren Gott in Verbindung stehen. Er ist heilig, darum geziemt sich auch uns ein gerechtes und untadeliges Benehmen. Er ist Liebe. Das veranlasst uns, den Mitmenschen in Liebe zu begegnen.
Weil wir in der Zukunft an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilhaben werden, sollte unser Leben heute in Übereinstimmung mit Gott sein.
Widerstand
Als Paulus nach Thessalonich kam, verkündete er den Menschen dort nicht schöne Geschichten, sondern das Evangelium Gottes. Viele nahmen es als Gottes Wort auf und kamen in eine Glaubensbeziehung zu Ihm. Das ist bis heute der einzige Weg, wie Menschen in Verbindung zu Gott treten können.
Jene Glaubenden erlebten die Ablehnung ihrer ungläubigen Mitmenschen, weil sie sich zum lebendigen Gott bekehrt hatten. Das war nichts Neues. Schon die Christen in Judäa hatten den Widerstand der Juden erfahren, die zwar sehr religiös lebten, aber die Gnade verwarfen. In ihrem Hass gegen die Gnade töteten sie den Herrn Jesus und bekämpften solche, die das Evangelium der Gnade allen Menschen anboten. Doch das Urteil Gottes ist ernst: Wer seine Gnade verwirft, zieht sich seinen Zorn endgültig auf sich!
Paulus hatte ein grosses Verlangen, die Glaubenden in Thessalonich zu sehen, denn er stand in einer herzlichen Beziehung zu ihnen. Darum beabsichtigte er zweimal, sie zu besuchen. Aber Satan hat ihn unter der Zulassung Gottes daran gehindert.
Doch der Apostel wusste eins: Er würde sie zu seiner Freude im Himmel wiedersehen. Die Ankunft des Herrn Jesus mit den Seinen in Herrlichkeit würde zudem sichtbar machen, dass sein Einsatz in Thessalonich Frucht für Gott gebracht hatte. Denn die Erlösten aus dieser Stadt würden auch dabei sein. Das ist eine grosse Ermutigung für uns alle: Die Ergebnisse unserer Arbeit für den Herrn werden wir bei seiner Ankunft wiederfinden.
Befestigen und trösten
Aus Liebe zu den Erlösten in Thessalonich und aus Sorge um ihr geistliches Wohl war Paulus bereit, seinen engen Mitarbeiter Timotheus zu entbehren. Er sandte ihn mit zwei Aufträgen von Athen zu ihnen nach Thessalonich:
- Er sollte sie in ihrer Bedrängnis im Vertrauen auf Gott befestigen und trösten (Vers 2).
- Er sollte dem Apostel Bescheid bringen, wie es um ihren Glauben stand (Vers 5).
So war der Widerstand Satans, der Paulus an einem Besuch in Thessalonich hinderte (1. Thessalonicher 2,18), für Gott ein Anlass, ein anderes Werkzeug in Thessalonich zu benutzen. Er kommt nie in Verlegenheit.
Auf dem Glaubensweg des Christen gibt es Schwierigkeiten und Widerstand von Seiten der Welt. Das sagt uns das Wort Gottes voraus (2. Timotheus 3,12). Die Thessalonicher erfuhren es durch Verfolgungen, wir erfahren es heute mehr durch Spott und Verachtung. Damit wir im Glauben nicht wankend werden, haben wir nötig, im Vertrauen auf Gott und sein Wort gestärkt zu werden. Der Herr weiss das und sorgt durch seine Diener dafür.
In Thessalonich trat der Teufel als brüllender Löwe auf (1. Petrus 5,8). Paulus war in Sorge, dass die Erlösten durch den äusseren Druck ihr praktisches Glaubensleben mit dem Herrn aufgaben, um den Verfolgungen aus dem Weg zu gehen. Darum benutzt er seine gute Beziehung zu ihnen, um einen Appell an sie zu richten: Haltet an Gott und seinem Wort fest, damit meine Arbeit bei euch nicht umsonst gewesen ist.
Trost und Freude
Timotheus kehrte mit einer guten Nachricht zum Apostel zurück: Die Thessalonicher lebten trotz äusserem Widerstand in den christlichen Beziehungen. Sie hatten Glauben zum Herrn, also ein vertrauensvolles Verhältnis zu Jesus Christus im Himmel, und Liebe zueinander (Vers 6).
Diese positive Rückmeldung von Timotheus
- war ein Trost für Paulus in den vielfältigen Schwierigkeiten seines Dienstes (Vers 7),
- machte ihm Mut, weil sie am Herrn festhielten und sich vertrauensvoll auf Ihn stützten (Vers 8),
- rief bei ihm Freude über ihre gute geistliche Entwicklung hervor (Vers 9) und
- war ihm ein Ansporn, weiter eifrig für sie zu beten (Vers 10).
Paulus bat Gott intensiv, die Thessalonicher besuchen zu können, um sie über den christlichen Glauben weiter zu belehren, denn sie wussten noch nicht alles. Seine Zuneigung zu ihnen war stark, aber er stellte sich im Blick auf einen Besuch unter den Willen Gottes. Der himmlische Vater, der seine Kinder liebt, und der Herr Jesus, der für seine Versammlung sorgt, würde zur rechten Zeit den Weg zu ihnen öffnen.
In der Zwischenzeit sollten ihre Liebe zueinander und ihre praktische Heiligkeit zunehmen. Warum? Weil die Erlösten bald mit ihrem Herrn erscheinen werden. Dann wird öffentlich sichtbar werden, dass wir Glaubende miteinander verbunden sind und als Heilige getrennt vom Bösen stehen und Gott angehören. Merkmale, die uns jetzt schon kennzeichnen sollten.
Eine heilige Lebensführung
In den Versen 1 bis 12 ermahnt uns Paulus zu einer Gott wohlgefälligen Lebensführung. Unser Verhalten sollte nicht mehr von den schlechten Gewohnheiten, die wir vor der Bekehrung hatten, sondern von Heiligkeit (1. Thessalonicher 4,3-8) und Bruderliebe (1. Thessalonicher 4,9-12) geprägt sein. In jeder Situation unseres Lebens fragen wir uns: Wie kann ich Gott gefallen?
Gott will, dass wir keinen Geschlechtsverkehr ausserhalb der Ehe haben. Unser Körper wird in Vers 4 mit einem Gefäss verglichen, das wir in Heiligkeit und Ehrbarkeit besitzen sollen. Das Gegenteil davon ist das unbeherrschte und sündige Ausleben des geschlechtlichen Triebs, den wir Menschen vom Schöpfer haben. Wir sind von einer Welt umgeben, die sexuelle Sünden verharmlost. Das beeinflusst uns. Darum müssen wir uns immer wieder daran erinnern, wie Gott darüber denkt: Er verurteilt jede sexuelle Unreinheit.
In Vers 6 werden wir vor Ehebruch gewarnt. Ein trauriges Beispiel dafür ist David, der mit Bathseba, der Frau seines Helden Urija, Geschlechtsverkehr hatte und anschliessend ihren Mann ermordete, um die Sünde zu vertuschen. Obwohl David sein Vergehen bekannte und Gott ihm vergab, erfuhr er den Herrn als Rächer. Er musste in seinem Leben die bitteren Früchte seiner Sünde ernten.
Wir haben uns zu einem heiligen Gott bekehrt und durch den Glauben an das Evangelium den Heiligen Geist empfangen, der in uns wohnt. Darum sollen wir ein heiliges Leben führen, indem wir mit der Hilfe des Herrn alles Böse meiden.
Zunehmende Bruderliebe
Weil sich bei den Glaubenden in Thessalonich das christliche Leben in seiner Frische entfaltete, liebten sie einander. So hatte Paulus nicht nötig, ihnen viel über Bruderliebe zu schreiben. Er erinnert sie aber an drei Punkte:
- «Ihr seid von Gott gelehrt.» Bruderliebe ist der Ausdruck der göttlichen Liebe zu den Glaubenden als ein Kennzeichen des ewigen Lebens, das alle Erlösten der Gnadenzeit besitzen.
- Paulus bestärkt sie in der Verwirklichung dieser Liebe, indem er lobend erwähnt: «Ihr tut das auch allen Brüdern gegenüber.» Bruderliebe äussert sich nicht nur in Worten, sondern in Tat und Wahrheit (1. Johannes 3,18).
- Er ermahnt sie, in der tätigen Liebe unter den Erlösten zuzunehmen. Das ganze Leben lang können wir uns darin üben und werden doch nie damit fertig.
Neben der Ausübung der Bruderliebe sind wir auch für unseren persönlichen Lebensunterhalt verantwortlich. Darum sollen wir eifrig unserer Berufsarbeit nachgehen. Die Bruderliebe ist nach den Worten unseres Herrn ein Zeugnis für Ihn. Er sagte: «Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt» (Johannes 13,35). – Aber auch durch unser korrektes Benehmen am Arbeitsplatz dürfen wir auf Jesus Christus hinweisen. Denn die, «die draussen sind», d.h. die ungläubigen Menschen, beobachten uns. Deshalb werden wir in den Versen 11 und 12 aufgefordert, unsere Arbeit fleissig und still zu tun, damit unser Lebenswandel in der Welt anständig ist.
Die Entrückung
Der heutige Bibeltext macht deutlich, dass das Kommen des Herrn in zwei Phasen ablaufen wird. Bevor Er mit allen Erlösten in Herrlichkeit auf der Erde erscheinen wird, wird Er wiederkommen, um sie zu sich in den Himmel zu entrücken.
Der Anlass für die Belehrung über die Entrückung war die Tatsache, dass einige Glaubende in Thessalonich entschlafen waren. Die Zurückgebliebenen fragten sich nun: Was geschieht mit ihnen? Werden sie beim Kommen von Christus in Herrlichkeit benachteiligt? Der Apostel Paulus geht darauf ein, indem er detaillierte Informationen über die Entrückung gibt. Dazu hatte er vom Herrn direkt eine Offenbarung bekommen, denn sein Kommen für die Seinen war im Alten Testament unbekannt.
Der Herr wird persönlich kommen, um die Glaubenden zu sich zu nehmen. Zuerst wird Er mit göttlicher Macht alle Entschlafenen auferwecken. Sie werden einen neuen, himmlischen Körper empfangen. Danach werden wir, die wir bei der Entrückung leben werden, dem Körper nach verwandelt werden. Zusammen mit den Auferstandenen werden wir zum Herrn entrückt werden. Er wird uns ins Haus des Vaters bringen, damit wir für immer bei Ihm sind. Unseren Heiland zu sehen und bei Ihm zu sein – das wird unser zukünftiges, ewiges Glück ausmachen. Mit dieser Hoffnung dürfen wir uns gegenseitig Mut machen, auch im Blick auf unsere Lieben, die entschlafen sind. Weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, werden auch die Entschlafenen, die an Ihn geglaubt haben, auferstehen.
Der Tag des Herrn
Der Begriff «Tag des Herrn» kommt sowohl im Alten als auch im Neuen Testament vor und beschreibt nicht einen Tag von 24 Stunden, sondern einen Zeitraum. Da dieser Begriff im zweiten Thessalonicher-Brief einige Male erwähnt wird, wollen wir anhand von einigen Fragen die Bedeutung dieses Tages ein wenig umschreiben.
- Wann beginnt der Tag des Herrn? Er fängt mit dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit auf die Erde an. Seine Erscheinung wird mit dem Aufgang der Sonne zu Beginn eines neuen Tages verglichen (Maleachi 3,20.21).
- Wie lang dauert der Tag des Herrn? 2. Petrus 3,10 schliesst das Ende der Erde nach Abschluss des Friedensreiches in diesen Tag mit ein. Daraus folgern wir, dass dieser Tag 1000 Jahre dauert.
- Was charakterisiert den Tag des Herrn? In dieser Zeit ist Jesus Christus auf der Erde anwesend und wird als Herr anerkannt. Jede Rebellion gegen Gott wird dann sofort bestraft.
- Was bedeutet der Tag des Herrn für Jesus Christus? Es ist der Tag seiner Machtentfaltung und Herrschaft auf der Erde. Dann wird Er von den Menschen geehrt und bewundert (2. Thessalonicher 1,10).
- Was bedeutet der Tag des Herrn für die Ungläubigen? Er kommt für sie unerwartet und unerwünscht (1. Thessalonicher 5,2), denn er bringt furchtbare Gerichte für alle Gottlosen mit sich (Jesaja 13,9).
- Was bedeutet der Tag des Herrn für die Gläubigen? Für sie ist es die Zeit der Ruhe, der Belohnung und der Mitherrschaft mit Christus.
Mit der Erscheinung des Herrn in Macht und Herrlichkeit beginnt der Tag des Herrn, der 1000 Jahre dauert. In den Versen 1 bis 3 werden uns die Folgen davon für die Ungläubigen aufgezeigt. Die Verse 4 bis 11 beschreiben den Einfluss, den das Kommen des Herrn heute auf das Leben der Glaubenden haben soll.
Für die Menschen, die nicht an Ihn glauben, wird der Herr wie ein Dieb kommen – unerwartet und unerwünscht. Seine Erscheinung wird für sie ein plötzliches und unausweichliches Gericht bedeuten.
Die Verse 4 und 5 reden von unserer christlichen Stellung. Sie steht im Kontrast zur Position der Ungläubigen, die in Finsternis sind und zur Nacht gehören, weil sie ohne Gott leben. Als Erlöste sind wir Söhne des Lichts und Söhne des Tages, weil wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Das hat eine Wirkung auf unser Verhalten (1. Thessalonicher 5,6-8). Trotz der geistlichen Nacht sollen wir wach und nüchtern sein, indem wir auf den Herrn warten und uns durch die Welt und ihre Vergnügungen nicht berauschen lassen. Schutz gegen die weltlichen Einflüsse bieten uns Glauben, Liebe und Hoffnung, wie sie sich in einem Leben mit dem Herrn und den Glaubenden auswirken.
Gott hat uns nicht dazu bestimmt, in die zukünftigen Gerichte zu kommen. Der Herr Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, wird durch die Entrückung unsere Errettung zum Abschluss bringen. Ob wir bei seinem Kommen nun «wachen», d.h. noch leben, oder «schlafen», d.h. bereits gestorben sind: Wir werden alle an seiner zukünftigen Herrlichkeit teilnehmen.
Kurze Ermahnungen
Diese Schlussverse des ersten Thessalonicher-Briefs enthalten kurze und prägnante Ermahnungen. Wer mit dem Herrn lebt, wird sie gern beherzigen.
Zuerst werden wir aufgefordert, die anzuerkennen, die sich um unser geistliches Wohl bemühen und im Volk Gottes Führungsaufgaben wahrnehmen. Wir sollen ihren Dienst, der nicht einfach ist, schätzen und annehmen.
Paulus ermahnt uns weiter, ein Auge für die Bedürfnisse der Glaubenden zu haben und ihnen in Weisheit richtig zu begegnen. Die Unordentlichen müssen zurechtgewiesen werden, die Kleinmütigen brauchen Trost und die Schwachen unsere Hilfe. Im Volk Gottes soll das Böse gestoppt und das Gute gefördert werden.
Für unser persönliches Glaubensleben gilt: «Freut euch allezeit; betet unablässig; danksagt in allem.»
Dann folgen Ermahnungen für die Wortverkündigung: Damit der Geist frei wirken kann, ist kein Eigenwille gestattet. Weissagt ein Bruder, indem er – ohne es zu wissen – direkt in unsere aktuelle Lebenssituation hineinspricht, sollen wir dieses Wort annehmen.
Der Brief endet mit drei Ermutigungen:
- Die Gemeinschaft mit dem Gott des Friedens bewirkt bei uns praktische Heiligkeit. Je näher wir Ihm sind, desto ähnlicher möchten wir Ihm sein (Vers 23).
- Die Ankunft des Herrn Jesus offenbart, in welchem Mass sich das göttliche Leben in uns entfaltet hat. Das spornt uns an, jetzt für Gott zu leben (Vers 23).
- Die Gnade des Herrn steht uns dazu jeden Tag und in jeder Situation zur Verfügung (Vers 28).
Buchtipp: Den Herrn erwarten und die Praxis des Christenlebens
Ausharren in der Bedrängnis
Wie bereits im ersten Brief werden auch hier Paulus, Silvanus und Timotheus zusammen als Absender des Briefs erwähnt. Das zeigt ihr gemeinsames Interesse am Werk des Herrn in Thessalonich.
In Vers 1 werden die Thessalonicher an ihre kollektive Beziehung als Versammlung zu Gott, dem Vater, und zu Jesus Christus erinnert. Daraus fliesst die tägliche Fürsorge Gottes, wie uns Vers 2 zeigt. Wir empfangen jeden Tag Gnade, um uns in der entsprechenden Situation richtig verhalten zu können. Gott schenkt uns auch seinen Frieden, damit wir trotz Schwierigkeiten innerlich ruhig bleiben können.
Das Verhalten der Thessalonicher veranlasste Paulus, Gott für sie zu danken. Ihr Glaubensvertrauen zu Gott nahm zu und ihre Liebe untereinander war überströmend. Beides hatte der Apostel bereits im ersten Brief lobend erwähnt (1. Thessalonicher 1,3). Aber ihre Hoffnung nennt er jetzt nicht mehr. Warum?
Die Thessalonicher wurden schwer bedrängt und verfolgt. Nun wurde ihnen weisgemacht, sie befänden sich in den Gerichten, die den Tag des Herrn begleiten (2. Thessalonicher 2,2). Wie sollten sie da noch auf die Entrückung hoffen? Doch diese Behauptung war falsch. 1. Thessalonicher 1,10 belehrt uns: Jesus errettet uns vor dem kommenden Zorn!
In Vers 5 macht Paulus zudem klar, dass ihre Verfolgungen ein Beweis waren, dass Gott sie für die Herrlichkeit seines Reichs würdig erachtete. Denn «wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen» (Apostelgeschichte 14,22).
Ruhe beim Kommen des Herrn
Es konnte nicht sein, dass der Tag des Herrn schon gekommen war. Denn an diesem Tag, an dem der Herr Jesus zum Gericht erscheinen wird, werden die Rollen vertauscht sein. Die Erlösten, die jetzt Schwierigkeiten und Verfolgungen erdulden, werden dann in Ruhe sein. Die Gottlosen hingegen, die jetzt die Glaubenden bedrängen, werden dann bestraft werden. Gott wird für diesen Wechsel sorgen, denn Er ist gerecht.
Alle Menschen, die sich nicht vor Gott beugen und das Evangelium der Gnade im Herrn Jesus ausschlagen, wird das göttliche Gericht treffen. Es beginnt mit der Bestrafung aller lebenden Ungläubigen bei der Erscheinung des Herrn Jesus als Richter auf der Erde (Vers 8). Aber es erstreckt sich auch auf die ewige Strafe (Vers 9). Vor dem grossen weissen Thron werden alle Toten, deren Namen nicht im Buch des Lebens stehen, zur ewigen Qual und Gottferne in der Hölle verurteilt werden (Offenbarung 20,11-15).
Aber wir, die wir an Jesus Christus geglaubt haben, werden mit Ihm in Herrlichkeit erscheinen. Dann wird öffentlich sichtbar werden, was seine Gnade in uns bewirkt hat: Sie hat uns von verlorenen Sündern zu seinen Heiligen gemacht. So werden die Menschen in uns erkennen, wie gross und herrlich der Herr ist.
Diese Zukunftsperspektive soll in unserem täglichen Leben Auswirkungen haben (2. Thessalonicher 1,11.12). Gott möchte, dass in unserem Verhalten etwas von den Eigenschaften des Herrn Jesus gesehen wird. Seine Gnade steht uns dazu zur Verfügung.
Der Tag des Herrn ist noch nicht da
Weil die Thessalonicher wegen ihres Glaubens verfolgt und bedrängt wurden, behaupteten falsche Lehrer, der Tag des Herrn sei schon gekommen, ihre Schwierigkeiten würden das beweisen (Vers 2). Diese Verführer benutzten drei Mittel, um die Glaubenden zu verunsichern:
- Sie gaben vor, durch den Geist eine göttliche Offenbarung bekommen zu haben.
- Sie behaupteten, ein Sprachrohr Gottes zu sein, indem sie zur Beweisführung sein Wort aus dem Alten Testament heranzogen.
- Sie erdreisteten sich, im Namen des Apostels den Thessalonichern einen Brief zu schreiben. Dadurch wurden die gläubigen Thessalonicher innerlich erschüttert und unruhig.
Der Apostel begegnet diesem Irrtum mit gesunder Belehrung. Er macht klar, dass vor dem Tag des Herrn noch zwei wichtige Ereignisse stattfinden müssen:
- Der Herr wird für die Seinen kommen, um sie alle zu sich in den Himmel zu versammeln (Vers 1).
- Die Menschen werden öffentlich von Gott abfallen. Der Antichrist wird sie dazu verleiten (Vers 3).
Als Mensch der Sünde wird er der Inbegriff des Bösen sein und als Sohn des Verderbens wird er die Menschen ins Unglück stürzen. Vers 4 beschreibt sein Handeln. Er wird sich direkt gegen Gott stellen, indem er sich selbst erhöht und sagt, er sei Gott. Anstelle des christlichen und jüdischen Glaubens wird er eine neue Religion einführen. So werden sich viele vom lebendigen Gott lossagen und den Antichristen als Gott verehren.
Der Antichrist und die Ungläubigen
Die Gesetzlosigkeit ist der Eigenwille und die Auflehnung des Menschen gegen Gott. Beides wirkt jetzt schon in den Ungläubigen, wird aber erst durch den Antichristen zur vollen Entfaltung kommen, denn er ist der Gesetzlose.
Bis heute halten die Regierung – sie ist von Gott eingesetzt (Römer 13,1) – und die Anwesenheit des Heiligen Geistes auf der Erde diese böse Entwicklung auf (2. Thessalonicher 2,6.7). Doch nach der Entrückung sind dem Bösen für eine kurze Zeit keine Schranken mehr gesetzt. Der Antichrist wird sich ins Rampenlicht der Öffentlichkeit stellen und von Satan inspiriert die Menschen mit Wundern zum Abfall gegen Gott verführen. Sein Auftritt wird einen schönen Schein haben, aber in Wirklichkeit von Lug und Betrug gekennzeichnet sein. Doch der Herr Jesus wird bei seiner Erscheinung dem bösen Tun des Antichristen ein Ende setzen. Mit einem Wort aus seinem Mund wird Er ihn beseitigen (Vers 8).
Die Verse 10-12 zeigen uns, dass vor allem die Namenchristen, die nur ein Bekenntnis aber kein Leben aus Gott haben, der Verführung des Antichristen zum Opfer fallen werden. Sie lehnten das Evangelium und die christliche Wahrheit in ihren Herzen ab. Darum haben sie ein offenes Ohr für die Lüge Satans. Zudem sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, damit sie der Lüge glauben müssen. Das wird ein Gericht Gottes sein, weil sie die Wahrheit nicht glauben wollten. – Sie werden die furchtbaren Gerichte durchmachen, die der Christenheit im Buch der Offenbarung prophezeit werden, und in die Hölle kommen.
Befestigung und Trost
Nachdem Paulus über die Menschen, die das Evangelium ablehnen, geschrieben hat (2. Thessalonicher 2,10-12), zeigt er nun den Glaubenden, was sie im Herrn Jesus besitzen und welche Folgen das für ihr tägliches Leben hat.
Zuerst werden wir daran erinnert, dass wir vom Herrn geliebt sind und als Brüder zur Familie Gottes gehören. Dann spricht Paulus über das, was Gott für uns tat und tun wird:
- Gott hat uns vor Grundlegung der Welt für ein herrliches Teil in der Zukunft auserwählt.
- Der Heilige Geist hat an unseren Herzen und Gewissen gewirkt, damit wir das Evangelium der Gnade im Glauben angenommen haben.
- Gott wird dafür sorgen, dass wir an der öffentlichen Verherrlichung des Herrn Jesus teilnehmen werden, nachdem durch die Entrückung unsere Errettung nach Geist, Seele und Körper zum Abschluss gekommen sein wird.
Wenn wir eine solch herrliche Aussicht haben, wollen wir im Glauben feststehen, indem wir das Wort Gottes für uns verbindlich nehmen und ihm gehorchen.
Vers 16 erklärt uns, dass der Vater und der Sohn eins sind:
- in der Liebe zu uns, die sich einst am Kreuz zeigte,
- im ewigen Trost, den wir jetzt in den Schwierigkeiten erfahren und
- in der guten Hoffnung, die bald für uns Wirklichkeit werden wird.
Das macht uns innerlich ruhig und stärkt uns in den äusseren Aktivitäten des Glaubenslebens (Vers 17).
Fürbitte und Bewahrung
In den ersten beiden Versen bittet Paulus um die Gebete der Thessalonicher. Sie sollten für zwei Anliegen beten:
- «Dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde.» Was ist damit gemeint? Das Wort läuft, wenn es verkündet und verbreitet wird. Bitten wir also den Herrn, dass Er Möglichkeiten dazu gibt. Das Wort wird verherrlicht, wenn es bei Zuhörern und Lesern eine Wirkung hervorbringt. So dürfen wir auch um die Bekehrung von Menschen beten.
- «Dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen.» Die Diener des Herrn, die das Wort Gottes verkünden oder in schriftlicher Form verbreiten, sind den Feindseligkeiten von Menschen ausgesetzt, die das Evangelium ablehnen. Darum haben sie unsere Fürbitte um Bewahrung nötig.
Im Blick auf die Thessalonicher, die der Verfolgung und Verführung ausgesetzt waren, setzte Paulus einerseits sein ganzes Vertrauen auf den Herrn (Vers 3). Er würde sie befestigen und bewahren. Anderseits brachte er diesen jungen Glaubenden sein Vertrauen entgegen (Vers 4). Das spornte sie an, seine Anweisungen in diesem Brief zu befolgen. In Vers 5 geht es um unsere innere Grundausrichtung. Unser Blick soll nicht auf die Probleme um uns her, sondern nach oben und nach vorn gerichtet sein:
- Die Liebe Gottes scheint wie die Sonne täglich vom Himmel auf uns herab.
- Der Herr Jesus wartet mit Ausharren auf den Moment, an dem Er uns zu sich heimholen kann.
Anständige Lebensführung
In diesem Abschnitt muss der Apostel noch ein praktisches Problem ansprechen. Einige Thessalonicher «wandelten unordentlich». Was ist damit gemeint? Es handelt sich um ein Fehlverhalten in der Lebensführung, indem man den täglichen Pflichten in Familie und Beruf nicht nachkommt. Man will nicht arbeiten und vernachlässigt die Aufgabe in der Familie. Stattdessen mischt man sich in Angelegenheiten, die einen nichts angehen. Paulus setzt drei Schwerpunkte:
- Er spricht die Betroffenen in den Versen 10-12 an. Zuerst zeigt er ihnen den biblischen Grundsatz: «Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen.» Sodann gebietet er ihnen, still ihre Arbeit zu tun, damit sie ihr eigenes Brot verdienen.
- Er stellt sich in den Versen 7-9 selbst als Vorbild hin. Als er sich mit seinen Mitarbeitern in Thessalonich aufhielt, hatten sie nicht unordentlich gelebt, sondern neben der Evangeliumsverkündigung Nacht und Tag hart für ihren eigenen Lebensunterhalt gearbeitet. Denn sie wollten niemand zur Last fallen und den Jungbekehrten ein Beispiel für eine ordentliche Lebensführung geben.
- Paulus hat auch ein Wort an die Glaubenden, die ihrer Pflicht in Beruf und Familie nachkamen. Einerseits sollten sie zu solchen, die unordentlich lebten, auf Distanz gehen, um diesen zu zeigen, dass sie mit ihrem Verhalten nicht einverstanden sind (Vers 6). Anderseits macht er ihnen in Vers 13 Mut, weiter treu ihre Aufgaben zu erfüllen.
Der Herr des Friedens
In den Versen 14 und 15 handelt es sich um eine Zuchtmassnahme solchen gegenüber, die weiter unordentlich leben, obwohl sie mehrfach auf ihr Fehlverhalten hingewiesen worden sind. Ein solcher Christ muss vor der Versammlung als Unordentlicher bezeichnet werden. Die Glaubensgeschwister werden aufgefordert, keinen Umgang mehr mit ihm zu haben, damit er zur Einsicht kommt und von seinem falschen Weg umkehrt. Vers 15 macht aber klar, dass diese Person weiter als Bruder (oder Schwester) in Gemeinschaft am Tisch des Herrn ist und am Brotbrechen teilnimmt.
Vers 16 ist eine Ermutigung. Jesus Christus ist der Herr des Friedens. Er besitzt persönlich diese göttliche Ruhe, die durch nichts angetastet werden kann. Und Er möchte uns seinen Frieden schenken (Johannes 14,27). Ob wir von der Welt bedrängt werden (2. Thessalonicher 1,4) oder in der Versammlung mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben (2. Thessalonicher 3,6-15): Der Herr Jesus kann unsere Herzen ruhig machen und auch den Frieden unter den Glaubenden bewahren. Zudem gilt uns die Verheissung: Der Herr ist mit uns allen!
Da die Thessalonicher von den Verführern einen gefälschten Brief im Namen von Paulus bekommen haben (2. Thessalonicher 2,2), unterschreibt er jetzt seinen zweiten Brief an sie. Mit einem bestimmten Zeichen macht er klar, dass nur er der Autor dieses Schreibens sein kann. Wieder endet der Brief mit der Gnade unseres Herrn Jesus, die uns bis zu seinem Wiederkommen auf dem Glaubensweg begleitet.
Buchtipp: Der Tag des Herrn und die Praxis des Christenlebens
Einleitung
Die Geschichte von Ruth ist kurz, aber inhaltsreich. Wir finden Ruth an vier verschiedenen Orten:
Ruth 1: Auf dem Weg nach Israel
Ruth 2: Auf dem Feld von Boas
Ruth 3: Auf der Tenne bei Boas
Ruth 4: Im Haus von Boas
Elimelech zieht nach Moab um
Das Buch der Richter hat eigentlich zwei Anhänge. Der erste steht in den Schlusskapiteln 17 – 21 des Buches der Richter. Er zeigt uns die religiöse und moralische Verdorbenheit in Israel. Der zweite Anhang ist das Buch Ruth. Es beginnt mit den Worten: «Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten.» In diesem Buch finden wir die überströmende Gnade Gottes und den persönlichen Glauben.
Die Hungersnot im Land Israel gehörte zu den Züchtigungen Gottes, die Er in jener Zeit über sein Volk brachte, weil es Ihn verlassen und anderen Göttern gedient hatte (Richter 2,13; 3,7). Anstatt sich unter die Hand des Herrn zu beugen, nach den Ursachen der Züchtigung zu fragen und dann zu Gott umzukehren, verliess Elimelech mit seiner Familie die Stadt Bethlehem. Wohin wandte er sich? Ins heidnische Ausland! Ging es ihnen in Moab besser? Im ersten Moment vielleicht. Doch dann starb Elimelech. Einige Jahre später starben auch seine beiden Söhne. Zurück blieb Noomi, die die geringste Verantwortung in der Familie hatte, und die beiden moabitischen Schwiegertöchter.
Die Geschichte Elimelechs lehrt uns, dass wir als Gläubige Gott nicht aus der Schule laufen können. Doch auch wir stehen in Gefahr, die Zusammenkünfte der Gläubigen aufzugeben, wenn wir eine geistliche Hungersnot in der örtlichen Versammlung verspüren. Wohin gehen wir dann? Demas verliess den Apostel Paulus, weil er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hatte (2. Timotheus 4,10).
Noomi will nach Israel zurückkehren
Schliesslich machte sich Noomi mit ihren Schwiegertöchtern auf, um nach Bethlehem zurückzukehren. Trieb die Not sie zurück? Nein, es war die Gnade Gottes, die sie zog. Sie hatte von der Güte des Herrn gehört, der seinem Volk wieder Brot gab. Wir sehen etwas Ähnliches beim verlorenen Sohn in Lukas 15. Nicht das Elend, in dem er sich als Schweinehirt befand, trieb ihn nach Hause, sondern der Gedanke an all das Gute, das es beim Vater gab (Lukas 15,17).
Das Gespräch, das Noomi mit ihren Schwiegertöchtern führte, um sie zur Rückkehr nach Moab zu bewegen, zeigt, wie weit ihr Herz von Gott weggekommen war. Sie argumentierte menschlich. Der Vorschlag, den sie Orpa und Ruth machte, war aus menschlicher Sicht vernünftig. Leider war kaum noch Gottvertrauen in ihrem Herzen. Wie konnte sie sich im Glauben auf einen Gott stützen, mit dem sie gar keine bewusste Verbindung mehr pflegte? Ihre Beziehung zu Gott war auf ein Minimum gesunken.
Gott benutzte die negative, aber realistische Schilderung von Noomi als Echtheitstest für die Zuneigungen von Orpa und Ruth. Wie gnädig ist unser Gott, dass Er aus unseren Fehlern noch etwas Gutes hervorbringen kann! Die Entscheidung Orpas zeigt, dass für einen Weg in der Nachfolge des Herrn die Gefühle nicht ausreichen. Ruths Herzensentschluss ging tiefer. Sie hing Noomi an, weil sie sich für den Gott Israels entschieden hatte. Das sehen wir im nächsten Abschnitt.
Ruth trifft eine Entscheidung
Orpa war zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Nun wollte Noomi auch Ruth zur Rückkehr bewegen. Warum gab sie ihrer Schwiegertochter diesen schlechten Rat? Weil sie weder für sich noch für Ruth eine Hoffnung hatte.
Zum Glück liess Ruth sich nicht mehr von ihrem Entscheid abbringen. Ihrem Herzensentschluss folgten nun auch die Füsse. Das Volk Noomis sollte ihr Volk werden und der Gott Noomis war ihr Gott. Sie machte sich mit dem Volk Gottes eins und setzte ihr Vertrauen auf den Gott Israels. Das erinnert uns an die Kennzeichen des neuen Lebens im Neuen Testament: die Brüder lieben und Gott lieben (1. Johannes 5,1).
Nun gehen die beiden Frauen bis nach Bethlehem. Die Leute der Stadt fragen: «Ist das nicht Noomi?» Ja, die Jahre in Moab haben bei Noomi ihre Spuren hinterlassen. Doch sie beugt sich unter die Hand des Allmächtigen. Sie sieht auch ihren eigenwilligen Weg ein, denn sie sagt: «Voll bin ich gegangen.» Doch trotz dem erfahrenen Verlust bezeugt sie auch die grosse Gnade des Herrn: «Leer hat mich der Herr zurückkehren lassen.» Ihm verdankt sie es, dass sie wieder zu Hause ist.
Nicht nur Noomi, sondern auch Ruth wird als Zurückgekehrte bezeichnet. So sieht es Gott, wenn jemand sich für den Herrn entscheidet und an Ihn glaubt. Die Erwähnung der Gerstenernte zeigt, wie der Herr bereits Segen für die bereit hat, die nicht gesät haben und auch keine Anrechte besitzen.
Ruth liest Ähren auf
Die Situation von Noomi und damit auch von Ruth war nicht so hoffnungslos, wie man aus dem ersten Kapitel hätte schliessen können. In Bethlehem lebte ein vermögender Verwandter: Boas (= in ihm ist Stärke). Dieser Mann weist auf den Herrn Jesus hin, der unser «Verwandter», d.h. Mensch geworden ist, um uns helfen zu können (Hebräer 2,14.15). Unser Herr ist in zweierlei Hinsicht vermögend: Er vermag alles und ist sehr reich (Hebräer 2,18; 2. Korinther 8,9).
Für arme Leute wie Noomi und Ruth war das Ährenlesen die einzige Möglichkeit, um am Segen teilzuhaben. Eigentlich durfte man erst nach der Ernte aufs Feld (3. Mose 23,22). Doch Ruth wollte sehen, bei wem sie «Gnade finden» würde.
Durch Gottes Vorsehung traf sie auf das Feld von Boas. Zweierlei kennzeichnete diesen Ort: Dort gab es Nahrung, und dort hatte er das Sagen. Illustriert dieses Feld nicht die örtliche Versammlung und besonders das Zusammenkommen zur Wortverkündigung? So sind die Schnitter ein Bild derer, die das Wort verkündigen. Der Knecht über die Schnitter stellt den Heiligen Geist dar, der in der Versammlung alles zum Wohl der Anwesenden leiten und wirken will.
Wie schön ist das Gespräch zwischen Boas und dem Knecht über die Schnitter! Sie reden von Ruth. Ihre Einstellung und ihr Fleiss ist dem Knecht nicht entgangen. So kennt der Herr auch uns. Er sieht, mit welcher Einstellung wir dem verkündigten Wort zuhören, wie wir die Bibel lesen und ob wir dabei geistliche Nahrung aufnehmen wollen.
Boas spricht mit Ruth
Nun kommt es zum ersten Kontakt zwischen dem reichen Gutsbesitzer Boas und der armen Moabiterin, die sich aber klar für das Volk Israel und den wahren Gott entschieden hat (Ruth 1,16). Was Boas zu Ruth sagt, entspricht der Aufforderung des Herrn an uns Gläubige. Wir sollen die Gemeinschaft mit den anderen Christen pflegen und die Versammlungsstunden nicht versäumen. Das Feld, «das man schneidet», weist auf die verschiedenen Gelegenheiten hin, das Wort Gottes zu hören oder sich damit zu beschäftigen.
Ruth ist ganz überwältigt von soviel Gnade, die ihr von Boas entgegengebracht wird. Haben wir auch schon so reagiert und uns gefragt: Warum ist der Heiland gerade für mich gestorben? Warum hat Er mich erlöst? Wie dankbar sind wir für dieses Gnadengeschenk?
In den Versen 11 und 12 finden wir die Antwort Gottes auf den Herzensentschluss von Ruth im Land Moab. So wird jeder Mensch, der sein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus setzt, nicht enttäuscht werden. Zudem werden unsere Herzen getröstet, wenn wir uns in der Gegenwart des Herrn aufhalten, wie es Ruth in der Nähe von Boas erfahren hat.
Zur Essenszeit wird sie eingeladen, sich zur Seite der Schnitter zu setzen. Boas selbst bedient sie. Das ist eine schöne Illustration davon, dass alle Glaubenden geistliche Nahrung aus dem Wort Gottes nötig haben. Sie bekommen sie vom Herrn Jesus selbst. Das gilt für den erfahrenen Gläubigen genauso wie für einen, der sich eben erst bekehrt hat.
Ruth arbeitet mit Ausdauer
Nach dem Essen erfährt Ruth eine weitere Gnade. Auf Anweisung des Gutsherrn sollen die Arbeiter auf dem Feld ganze Bündel Ähren für Ruth liegen lassen (Vers 16). So kommt sie schneller voran, so dass sie am Abend etwa ein Epha Körner gesammelt hat. Das ist zehnmal mehr als das, was die Israeliten pro Tag an Manna sammelten (2. Mose 16,16.36).
Ausser der gesammelten Gerste bringt Ruth auch etwas vom Essen für Noomi nach Hause. So dürfen wir den alten und kranken Glaubensgeschwistern, die nicht zur Bibelstunde kommen können, etwas vom Gehörten und Empfangenen nach Hause bringen.
Noomi ist das Bild eines Gläubigen, der schon länger auf dem Glaubensweg ist. Sie hatte zwar versagt und war vom rechten Weg abgekommen, aber jetzt ist sie wiederhergestellt. Nun kann sie Ruth eine Hilfe sein. In Vers 2 hat sie Ruth ermuntert, jetzt nimmt sie Anteil an allem, was ihre Schwiegertochter erlebt hat. Aber vor allem kennt sie Boas. Sie kann Ruth sagen, wer er ist: ein Blutsverwandter oder Löser (Vers 20; 3. Mose 25,25; 4. Mose 35,12; 5. Mose 25,5).
Wie schön, wenn Christen, die schon einen langen Weg mit ihrem Herrn gegangen sind und die Bibel gut kennen, solchen, die jung im Glauben sind, von dem weitergeben, was sie selbst aus Gottes Wort empfangen haben! Und Ruth? Sie hört auf den Rat ihrer Schwiegermutter und legt beim Auflesen der Ähren grosse Ausdauer an den Tag (Vers 23).
Ruhe für Ruth
Einst wollte Noomi ihre Schwiegertochter nach Moab zurückschicken (Ruth 1,9). Doch jetzt möchte sie Ruth mit Boas zusammenbringen, weil sie weiss, dass er der Löser ist, der ihre Angelegenheit in die Hand nehmen kann.
Unser Löser oder Erlöser ist der Herr Jesus. Er will, dass sich unsere Gemeinschaft mit Ihm vertieft. Der Höhepunkt einer solchen Beziehung zum Herrn wird dann erreicht, wenn völlige Harmonie zwischen Ihm und dem einzelnen Erlösten besteht. Dieses Höchstmass wird im Buch Ruth mit der ehelichen Verbindung zwischen Boas und Ruth illustriert.
In Vers 3 gibt Noomi ihrer Schwiegertochter Anweisungen, wie sie sich für die Begegnung mit Boas vorbereiten soll. Das alles hat eine geistliche Bedeutung für uns. Sich zu baden weist auf unsere Reinigung durch das Wort Gottes hin. Sie geschieht dadurch, dass wir das, was wir in der Bibel lesen, auf uns anwenden. Sich salben lässt an ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes denken. Achten wir darauf, dass wir dem Geist Gottes, der in jedem Gläubigen wohnt, nicht hindernd im Weg stehen, damit Er uns mit dem Guten beschäftigen kann (Philipper 4,8). Beim Anziehen der Kleider denken wir an unsere Lebensgewohnheiten, die von unseren Mitmenschen wahrgenommen werden. Leben wir so gottesfürchtig, wie es vor dem Herrn recht ist!
Wenn wir die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus suchen, müssen wir unsere eigenen Wünsche zurückstellen, damit Er uns mitteilen kann, was wir tun sollen (Vers 5b).
Auf der Tenne bei Boas
Weil Ruth merkte, dass Noomi es gut mit ihr meinte, fiel es ihr leicht, ihren Rat zu befolgen. Sie ging zur Tenne hinab und tat alles so, wie Noomi gesagt hatte.
War es recht, dass die alte Frau ihre Schwiegertochter in dieser aufdringlichen Weise zu Boas schickte? Ja, denn es entsprach dem Gesetz (3. Mose 25,25; 5. Mose 25,5). Aus diesem Grund konnte Ruth auf die Frage von Boas freimütig antworten: «Breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter.»
Was ist unter der letzten Güte zu verstehen, die Ruth noch besser erwiesen hat als die erste? Die erste Güte finden wir in Ruth 2,11 beschrieben. Die letzte Güte war, dass sie nicht einfach ihren eigenen Herzenswünschen gefolgt und den jungen Männern nachgegangen war, sondern die Rechte von Boas als Blutsverwandten über sich anerkannte.
Diese zwei Schritte gibt es auch in unserem Leben als Gläubige. Den ersten können wir mit unserer Bekehrung vergleichen. Der zweite erfolgt, wenn wir als glaubende Menschen die Rechte unseres Erlösers über uns anerkennen. Er hat sie in zweifacher Hinsicht: weil Er unser Schöpfer und weil Er unser Heiland ist. Wenn Er wirklich unser Herr ist und wir Ihm die Führung unseres Lebens übergeben, wird dies ähnlich glückliche Folgen haben, wie Ruth sie erfahren durfte.
Nun gab es noch ein Hindernis, damit Boas Ruth lösen und zur Frau nehmen konnte: Das war noch ein anderer, näherer Blutsverwandter. Wir werden in Kapitel 4 sehen, was dieser für uns bedeutet.
Sechs Mass Gerste
Ruth hat die Zusicherung, dass Boas bereit ist, sie zu lösen, sobald die Sache mit dem näheren Blutsverwandten geregelt ist. So bleibt sie bis zum Morgen liegen. Dann steht sie früh auf, bevor jemand merkt, dass sie auf die Tenne gekommen ist. Sie ist ja noch nicht die Frau von Boas. Sie hat ihm nur ihre Sache ans Herz gelegt.
Doch seine Gnade lässt sie nicht leer weggehen. Sechs Mass Gerste schüttet Boas in ihren Überwurf. Das ist viel mehr als sie an einem ganzen Tag beim Ährenlesen sammeln konnte. Doch was sind sechs Mass Gerste im Vergleich zum Reichtum von Boas, den sie mit ihm teilen wird, sobald sie seine Frau geworden ist! Ja, wenn ein Mensch sein Vertrauen auf den Herrn Jesus als seinen persönlichen Erlöser setzt, empfängt er nicht nur die Vergebung der Sünden und ein neues Leben, sondern den ganzen überragenden Reichtum seiner Gnade (Epheser 2,7).
Als Ruth nach Hause kommt, erkundigt sich Noomi nach dem Stand der Dinge. Ruth erzählt ihr alles und zeigt ihr den Beweis der Güte von Boas. Doch die Sache ist noch nicht entschieden. Darum sagt Noomi: Bleibe hier und überlass es ihm! Sie weiss: Boas wird nicht ruhen, bis er die Sache zu einem guten Ende geführt hat. So hat unser Herr es sich vorgenommen, die Seinen zur vollen Ruhe mit sich zu bringen. Er bemüht sich, uns dahin zu führen, dass Er uns völlig genügt und wir bei Ihm alles finden, was wir nötig haben.
Der Blutsverwandte
In aller Öffentlichkeit und vor zehn Zeugen wird nun die Angelegenheit mit dem näheren Blutsverwandten geregelt. Am Schluss bezeugt dieser gegenüber Boas: «Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann nicht lösen.» Damit ist der Weg frei, so dass Boas nicht nur das Feldstück Elimelechs, sondern auch Ruth lösen und sie heiraten kann.
Der andere Blutsverwandte wird nicht mit Namen genannt. Das bedeutet, dass es sich in der Anwendung auf uns nicht um eine Person, sondern um ein Prinzip handelt. Es geht um das Gesetz oder um die Seite der Verantwortung des Menschen. Gott gab dem Volk Israel seine Gebote mit den Worten: Wer dies tut, wird leben. Aber kein Mensch ist von Natur aus in der Lage, seiner Verantwortung vor Gott nachzukommen. Das gilt auch für einen Gläubigen, der versucht, aus eigener Willensanstrengung ein Leben für Gott zu führen. Er wird die Erfahrungen machen, die in Römer 7 beschrieben wird: Ich will das Gute tun, aber ich kann es nicht. Ich versage immer wieder! Jeder, der die Verantwortung für sein gottesfürchtiges Leben selbst übernehmen will, wird zum Schluss kommen: Es ist mir nicht möglich (Römer 7,24).
Um zur wahren Ruhe mit dem Herrn zu gelangen, müssen wir mit uns zu Ende kommen. Wir haben in uns selbst keine Kraft zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Es führt zu keinem Ziel, wenn wir uns Forderungen auferlegen. Wir müssen einsehen, dass in uns nichts Gutes wohnt. Die Hilfe muss von aussen kommen. Sie kommt vom Herrn, der uns helfen will, sobald wir mit uns selbst zu Ende sind.
Boas wird der Löser
Der Entscheid des näheren Blutsverwandten wurde nun in aller Öffentlichkeit amtlich bestätigt. Dieser Mann zog seinen Schuh aus und gab ihn Boas mit den Worten: «Kaufe für dich!» Damit war die Angelegenheit offiziell geregelt.
In der Anwendung auf uns zeigt uns diese Szene, dass das Gesetz oder irgendwelche gesetzlichen Vorschriften uns nicht helfen können. Das Gesetz kann niemals die Lebensregel des Christen sein. Alles, was er zur Errettung und zu einem Gott wohlgefälligen Leben nötig hat, findet sich in seinem Erlöser und Herrn Jesus Christus.
Es fällt auf, dass in den ersten zwölf Versen des vierten Kapitels weder Noomi noch Ruth gesehen werden. Nachdem Ruth alles vertrauensvoll in die Hand von Boas gelegt hat, verschwindet sie von der Bildfläche. Damit zeigen diese Verse besonders klar, dass Jesus Christus alles für uns vollbracht und uns um den hohen Preis seines Lebens erlöst hat. Alles kommt von Ihm: die Vergebung der Sünden, das ewige Leben, aber auch die Kraft und Hilfe, um täglich im Glauben zu leben.
Die anwesenden Zeugen bestätigen nun die eheliche Verbindung von Boas mit Ruth, der Frau des verstorbenen Machlon. Sie wünschen dem Ehepaar den reichen Segen des Herrn. Welch ein Höhepunkt der Gnade Gottes mit Ruth, der Moabiterin! Sie wird die Frau des reichen Boas und die Urgrossmutter von König David!
Boas und Ruth bekommen einen Sohn
Vers 13 illustriert den Höhepunkt der Wege Gottes mit den Gläubigen: Er möchte jeden Erlösten in eine innige, ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, seinem Erlöser, führen. Aus einem solchen Leben mit Ihm entsteht Frucht – Frucht für Gott und Frucht zur Freude anderer Gläubigen.
Die Frauen aus Bethlehem freuen sich vor allem für Noomi, die so verbittert aus Moab zurückgekehrt war, nun aber völlig wiederhergestellt ist. Dafür soll zuerst der Herr gepriesen werden, denn Er hat alles gut gemacht. Eine echte Wiederherstellung eines abgeirrten Gläubigen führt auch zu neuer Freude und neuen Aufgaben. So nimmt Noomi das Kind von Ruth auf ihren Schoss. Sie wird seine Wärterin. Von diesem Sohn sagen die Frauen: «Er wird dir ein Erquicker der Seele und ein Versorger deines Alters sein!» Sie bezeichnen ihn sogar als Sohn Noomis. Auch in ihrem Leben erreichte die Gnade Gottes einen herrlichen Höhepunkt.
Im Geschlechtsregister am Ende des Buches finden wir den ersten Hinweis auf David, den Mann nach dem Herzen Gottes, der König in Israel werden sollte. Bedenken wir, dass dies zur Zeit der Richter war, als kein König in Israel regierte und jeder tat, was recht war in seinen Augen (Ruth 1,1; Richter 21,25). Auch wir haben in den schweren Tagen am Ende der Gnadenzeit einen hoffnungsvollen Ausblick: Wir warten auf den Herrn Jesus, der bald wiederkommen und uns zu sich holen wird.
Das Matthäus-Evangelium im Überblick
Das Matthäus-Evangelium ist das erste Buch des Neuen Testaments und stellt inhaltlich die Verbindung zum Alten Testament her. Matthäus beschreibt uns Jesus Christus als Messias. Mit zahlreichen Zitaten aus dem Alten Testament beweist er auf eindrückliche Weise, wie viele Verheissungen durch das Kommen des Herrn als König Israels in Erfüllung gegangen sind.
Nachdem Jesus sich in den Kapiteln 5 bis 9 durch seine Worte und Werke dem Volk Israel als Messias vorgestellt hat, wird Er in Kapitel 12 abgelehnt. Darum tritt ab Kapitel 13 eine Wende ein. Weil der König verworfen ist, kann Er das Königreich in seiner angekündigten Form nicht aufrichten. Durch die Gleichnisse über das Reich der Himmel macht der Herr Jesus aber klar, dass Er trotzdem ein Reich auf der Erde hat: Obwohl Er persönlich nicht mehr anwesend ist, steht jeder, der sich zu Ihm bekennt und Ihm nachfolgt, als sein Jünger unter seiner Autorität und teilt mit Ihm die Verwerfung von der Welt. In seiner prophetischen Rede in Kapitel 24 erklärt der Herr dann, dass Er in der Zukunft ein zweites Mal als König erscheinen wird. Dann wird Er sein Reich öffentlich aufrichten und von allen anerkannt werden.
Das Evangelium kann in fünf Teile gegliedert werden:
Matthäus 1,1 – 4,11: Der König kommt
Matthäus 4,12 – 12,50: Der König dient in Galiläa
Matthäus 13 – 20: Der verworfene König dient weiter
Matthäus 21 – 25: Der König dient in Jerusalem
Matthäus 26 – 28: Der König vollendet seinen Dienst
Das Geschlechtsverzeichnis
Matthäus beginnt mit dem Abstammungsnachweis des Herrn Jesus, weil er uns aufzeigen will, dass Dieser sowohl ein Nachkomme Abrahams als auch ein Nachkomme Davids ist (Vers 1).
Seine Abstammung von Abraham gibt Jesus Christus den Anspruch auf das Land Israel, das Gott dem Patriarchen verheissen hat. Als Nachfahre Davids hat Er Anrecht auf die königliche Krone.
Das Geschlechtsregister beginnt bei Abraham und führt zu Joseph, der als Ehemann von Maria vor dem Gesetz als offizieller Vater des Herrn Jesus angesehen wurde. Damit zeigt es uns seine rechtliche Abstammung. Er war wirklich der rechtmässige Erbe der göttlichen Verheissungen an Abraham und David.
In diesem Abstammungsnachweis werden schlimme Vergehen erwähnt, um in der Geschichte Israels den Triumph der Gnade Gottes über die Sünde des Menschen hervorzuheben. Der Höhepunkt der Gnade ist das Kommen des Heilands, der sein Volk von ihren Sünden erretten wird (Vers 21).
In Vers 17 wird das Geschlechtsregister in drei Abschnitte aufgegliedert, die den drei grossen Teilen der Geschichte Israels entsprechen:
- Von Abraham bis auf David entwickelte sich Israel äusserlich zu einem bedeutenden Volk.
- In der Zeit von David bis zur Wegführung nach Babylon degenerierte dieses Königreich wegen seiner Untreue gegenüber Gott.
- Von der Wegführung bis auf den Christus litt Israel unter den Folgen seines Versagens.
Der König wird geboren
Nachdem im ersten Abschnitt des Kapitels durch den Abstammungsnachweis die menschliche Herkunft des Herrn Jesus vorgestellt wird, beschreibt Vers 18 seine göttliche Herkunft. Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt, darum ist Er der Sohn Gottes.
Als die Jungfrau Maria schwanger wurde, kam Joseph, der mit ihr verlobt war, in innere Not. Weil er ein zartes Gewissen hatte und gottesfürchtig lebte, wollte er die Verlobung heimlich auflösen. Da kam ihm ein Engel des Herrn in einem Traum zu Hilfe und erklärte ihm die Situation: Gott hatte ein Wunder gewirkt und in Maria durch den Heiligen Geist ein Kind gezeugt. Darum brauchte sich Joseph nicht zu fürchten und durfte seine Verlobte zu sich nehmen.
In Vers 21 gibt ihm der Engel den Auftrag, dem Sohn von Maria den Namen «Jesus» zu geben. «Jesus» ist das griechische Wort für «Josua» und bedeutet: Der Herr ist Rettung.
Mit dem Zitat in Vers 23, das das Wunder der Geburt Jesu unterstreicht, erwähnt der Engel einen weiteren Namen des Herrn. «Emmanuel» bedeutet: Gott mit uns.
Beide Namen weisen darauf hin, dass Gott mit der Geburt des Messias wieder beim Volk Israel anknüpfte und eine Lösung für das Problem seiner Sünden schaffen würde. Obwohl Matthäus sich in seinem Evangelium meistens auf Israel bezieht, dürfen wir hier auch an alle Menschen denken: Die Geburt des Herrn Jesus beweist, dass Gott für uns ist und uns von unserer Sündenlast befreien möchte.
Der König wird geehrt
Das Kind wurde in Bethlehem geboren und Joseph gab Ihm den Namen Jesus. Als verheissener König wurde Er sofort mit drei Reaktionen konfrontiert:
- Eine positive: Aus dem Osten kamen Sternkundige, die seinen Stern im Morgenland gesehen hatten, um Ihn als König zu verehren.
- Eine negative: Herodes, der unrechtmässige König, und die jüdische Führungsschicht in Jerusalem wurden bestürzt, als sie von seiner Geburt hörten, und stellten sich gegen Ihn.
- Eine gleichgültige: Die Schriftgelehrten wussten zwar sofort, wo der König geboren werden sollte: in Bethlehem! Aber in ihrem Herzen löste diese Nachricht keine Freude aus. Obwohl sie eine gute Kenntnis des Alten Testaments hatten, schlug ihr Herz nicht für den Erlöser. Sie wollten Ihn nicht sehen.
Die Weisen hingegen zogen vom Stern geführt nach Bethlehem und freuten sich, als er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Im Haus fielen sie vor dem Kind Jesus nieder und beteten es an. Sie brachten drei Geschenke mit, die bildlich von den Vorzügen dieses neugeborenen Kindes reden:
- Gold spricht von seiner persönlichen Herrlichkeit: Dieses Baby war niemand anders als der Sohn Gottes.
- Weihrauch zeigt uns, dass Jesus gekommen war, um den Willen Gottes zu tun. Sein ganzes Leben widmete Er Gott.
- Myrrhe deutet auf die Leiden hin, die Er auf seinem Lebensweg bis zum Tod am Kreuz geduldig ertrug.
Flucht nach Ägypten
Herodes sah in Jesus seinen Rivalen, denn er wusste, dass er selbst nicht der rechtmässige König über Israel war. Darum suchte er Christus zu töten. Gleichzeitig war Herodes ein Werkzeug Satans, der den Messias beseitigen wollte, damit die göttlichen Pläne mit Israel durchkreuzt würden (Offenbarung 12,4.5).
Doch hinter allem stand Gott, dem nichts aus dem Ruder läuft. Durch einen Engel gab Er Joseph im Traum den Auftrag, mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten zu fliehen. Sofort gehorchte er und reiste dorthin. Auf diese Weise erfüllte sich eine weitere Prophezeiung des Alten Testaments: «Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.» So wie einst Israel, so sollte auch der Messias aus Ägypten nach Kanaan ziehen und damit einen Neuanfang in der Geschichte Israels schreiben. Nach der jahrhundertelangen Untreue dieses Volkes kam nun Christus und brachte in seinem Leben Frucht zur Freude Gottes. In seinem Tod legte Er zudem die Grundlage, dass Israel in der Zukunft trotz seines Versagens gesegnet wird.
Nach dem Tod von Herodes zog Joseph im Auftrag Gottes nach Israel zurück und wohnte in Nazareth. So wuchs Jesus in einer verachteten Stadt unter den Ärmsten des Volkes auf (Johannes 1,46).
Es beeindruckt uns, wie Joseph in den verschiedenen Situationen, die nicht immer einfach waren, auf dem Weg vorwärtsging, den Gott ihn wies (Matthäus 1,24; Matthäus 2,14.21.22). Sein konsequenter Gehorsam spornt uns an, unserem Gott genauso treu zu folgen.
Johannes als Vorläufer
Die Verse 1-12 beschreiben den Dienst von Johannes dem Täufer, der auch im Alten Testament vorausgesagt wird (Maleachi 3,1; Jesaja 40,3-5). Als Wegbereiter des Messias kündigte er das Reich der Himmel an und forderte die Menschen in Israel auf, Buße zu tun. Sie sollten in ihren Herzen zu Gott umkehren, damit sie bereit seien, den von Ihm gesandten König anzunehmen.
Weil das Volk in einem schlechten inneren Zustand war, übte Johannes seinen Dienst in der Wüste von Judäa aus. Völlig getrennt vom Bösen nahm er dort seinen Standpunkt als Vorläufer des Herrn ein. So war er in der Lage, die Menschen von ihren Sünden zu überführen und sie auf Gottes Ansprüche an ihr Leben hinzuweisen.
Sein Gewand aus Kamelhaar und der lederne Gürtel machen deutlich, dass er wie einst Elia ein Prophet war (2. Könige 1,8). Er lebte von dem, was die Wüste ihm an Nahrung bot: Heuschrecken und wilden Honig. Damit begnügte er sich.
Viele gingen zu ihm in die Wüste hinaus und glaubten seiner Botschaft. Durch das Bekenntnis der Sünden und die Taufe stellten sich diese bußbereiten Juden auf die Seite Gottes und erwarteten den Messias. Dadurch sonderten sie sich vom bösen Zustand des Volkes ab und bildeten so einen Überrest für Christus.
Wer heute sein Verhältnis mit Gott ordnen will, muss ebenfalls Buße tun und seine Sünden bekennen. Durch den Glauben an den Opfertod von Jesus Christus empfängt er Vergebung. Durch die Taufe stellt er sich auf die Seite des Herrn und ist bereit, Ihm nachzufolgen.
Jesus wird getauft
An die selbstgerechten Pharisäer richtete Johannes der Täufer ein ernstes Wort: Das Gericht stand vor der Tür, denn die Axt war schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Weil Israel im Lauf seiner Geschichte versagt hatte, brachte die Abstammung von Abraham keine Rettung vor der Strafe. Nur durch echte Buße, die durch eine veränderte Lebensführung sichtbar würde, konnte man dem kommenden Zorn entfliehen.
Ab Vers 11 weist Johannes auf Jesus Christus hin, der viel grösser und würdiger als er selbst ist. Die Taufe mit Heiligem Geist fand ihre Erfüllung, als der Geist Gottes an Pfingsten auf die Erde kam, um in den Glaubenden zu wohnen. Die Taufe mit Feuer weist auf die zukünftigen Gerichte hin, die im Volk Israel eine Unterscheidung zwischen den Glaubenden (= Weizen) und den Gottlosen (= Spreu) bewirken wird. Die Ersten werden ins Tausendjährige Reich eingehen, die Zweiten eine ewige Strafe erleiden.
Durch die Taufe stellte sich Jesus in Gnade zu den bußbereiten Menschen in Israel. Demütig nahm Er den gleichen Platz wie sie ein, obwohl Er ohne Sünde ist und nicht nötig hatte, Buße zu tun. Als Antwort darauf anerkannte der Himmel seine Vollkommenheit:
- Weil Jesus rein und heilig war und ist, konnte der Geist Gottes wie eine Taube auf Ihn kommen, um Ihn mit Kraft für seinen Dienst als Messias zu salben.
- Gott, der Vater, erklärte den Anwesenden, dass dieser sündlose und demütige Mensch sein geliebter Sohn war, an dem Er in seinem Leben auf der Erde seine uneingeschränkte Freude gefunden hatte.
Die Versuchung in der Wüste
Jesus wurde durch den Geist in die Wüste geführt. Er sollte am gleichen Ort geprüft werden, wo einst das Volk Israel erprobt worden war – und versagt hatte.
Als Er nach einer 40-tägigen Fastenzeit Hunger hatte, forderte Satan Ihn zu einer eigenmächtigen Handlung heraus: «Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Broten werden.» Doch Jesus Christus wollte lieber leiden, als eigenwillig und ungehorsam zu sein. Darum erklärte Er: Der von Gott abhängige Mensch lebt und handelt nur nach dem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht.
Die zweite Versuchung des Teufels betraf eine Verheissung an den Messias aus Psalm 91: Jesus sollte testen, ob Gott bei Ihm dieses Versprechen erfüllen würde. Mit einem Zitat aus 5. Mose 6 machte der Herr klar, dass man Gott nicht durch Misstrauen auf seine Treue herausfordern soll. Wer Ihm glaubt, traut Ihm jederzeit die Erfüllung aller Verheissungen zu.
In der dritten Versuchung offenbarte Satan seinen wahren Charakter: Als Fürst der Welt bot er Jesus Christus die Herrschaft über alle Reiche der Welt an. Doch der Herr ging nicht darauf ein, denn Er hatte ständig Gott vor Augen. Nur Ihn wollte Er ehren und anbeten.
Durch seine Verführungen verfolgte der Teufel eine Absicht: Er wollte, dass der Herr Jesus unabhängig von Gott handelte. Doch es gelang ihm nicht. Im Gegenteil! Diese Versuchungen bewiesen, wie sich unser Heiland in jeder Situation vollkommen dem Willen Gottes unterstellte. Darin ist Er ein Beispiel für uns.
Der Herr beginnt seinen Dienst
Der Messias begann seinen öffentlichen Dienst an den Menschen aus dem Volk Israel nicht in Jerusalem, wo die Vornehmen, Reichen und Gebildeten lebten. Nein, Er zog sich nach der Verwerfung seines Vorläufers nach Galiläa zurück, um dort den einfachen und armen Leuten das Evangelium des Reiches zu predigen. So erfüllte sich eine weitere prophetische Aussage des Alten Testaments: Das Volk, das in Finsternis sass, wurde durch sein Wirken in das grosse Licht der göttlichen Gnade gestellt.
In den Versen 18-22 rief der Herr verschiedene Menschen in seine Nachfolge. Bei einer früheren Begegnung hatten sie vertrauensvoll ihr Herz Jesus Christus geöffnet (Johannes 1,35-42). Nun sollten sie seine Jünger werden. Später würde Er sie als seine Apostel zu den Menschen in Israel senden, damit sie ihnen das Reich der Himmel verkündeten (Matthäus 10). Doch jetzt durften sie bei Ihm sein, um von Ihm zu lernen. Der Herr rief Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes aus der beruflichen Aktivität und aus den familiären Beziehungen heraus. Sofort verliessen sie alles und folgten Ihm nach. – Auch heute möchte der Herr Jesus, dass jeder, der an Ihn glaubt, sein Jünger wird. Sind wir seinem Ruf schon gefolgt?
Die Verse 23-25 geben einen Kurzbericht über das Wirken des Herrn in Galiläa. Bald redete man davon im ganzen Land. Viele Menschen hörten seine Botschaft und wurden von den Folgen der Sünde (= Krankheit) und der Bindung Satans (= Besessenheit) befreit.
Die Bergpredigt
In den Schlussversen von Kapitel 4 offenbarte der Herr Jesus in seinem Dienst die königliche Macht, die Er als Messias besass. Beeindruckt von dieser Machtentfaltung folgten Ihm viele Menschen. Der Herr Jesus benutzte diese Gelegenheit, um den Jüngern in Anwesenheit der Volksmenge die Grundsätze seines Königreichs mitzuteilen (Matthäus 5 – 7).
Damit wir aus dieser sogenannten Bergpredigt den richtigen Nutzen für uns ziehen, gilt es Folgendes zu beachten:
- Diese Rede enthält nicht das Evangelium für verlorene Sünder, sondern richtet sich an Menschen, die den Herrn Jesus bereits im Glauben angenommen haben. Denn die Belehrungen in diesen Kapiteln können nur solche verwirklichen, die neues Leben besitzen.
- Der Herr spricht hier nicht von den speziellen christlichen Vorrechten und Beziehungen, die die Glaubenden der Gnadenzeit kennen und geniessen. Er behandelt das Verhalten der Jünger in seinem Reich und zeigt die Richtlinien, die dort gelten.
- Darum richten sich seine Worte in der Bergpredigt an alle, die sich im Reich Gottes befinden: sowohl an die damaligen Jünger als auch an uns Christen, als auch an den glaubenden Überrest in der Zukunft.
- Wenn wir diese Anweisungen des Herrn, die unsere Jüngerschaft auf der Erde betreffen, für uns persönlich nehmen, wollen wir nie vergessen, dass wir als Kinder Gottes auch eine himmlische Berufung besitzen.
Merkmale der Jünger im Reich
In diesem Abschnitt erklärt der Herr Jesus durch die ersten sieben Seligpreisungen die inneren und äusseren Eigenschaften der Jünger in seinem Reich:
- «Arm im Geist» ist nicht eine geistige Beschränkung, sondern eine demütige Einstellung, die nichts von sich selbst hält und alles von Gott erwartet.
- Die «Trauernden» sind Menschen, die über das Böse im Volk Gottes traurig sind und sich schämen, dass Gott dadurch verunehrt wird.
- «Sanftmut» ist nicht Charakterschwäche. Im Gegenteil! Wer sanftmütig ist, kann persönliche Angriffe ohne Rachegedanken ertragen.
- Wer «nach Gerechtigkeit hungert und dürstet», der sehnt sich in einer ungerechten Welt auf den Moment, an dem Christus seine Gerechtigkeit auf der Erde einführen wird.
- Die «Barmherzigen» besitzen ein mitfühlendes Herz und eine helfende Hand für Menschen, die vielleicht durch eigene Schuld ins Elend geraten sind.
- Ein «reines Herz» beschreibt hier den praktischen Zustand eines Glaubenden, der alles im Licht Gottes verurteilt, was seinem Wort widerspricht.
- Die «Friedensstifter» bemühen sich, mit allen Menschen in Frieden zu leben und in ihrem Umgang mit den Menschen schlichtend zu wirken.
Die letzten beiden Seligpreisungen zeigen die Folgen echter Jüngerschaft: In einer ungerechten Welt, die den Herrn Jesus verwirft, bringen ein Verhalten in Übereinstimmung mit Gott und ein klares Bekenntnis für Christus Leiden und Verfolgungen mit sich.
Nicht auflösen, sondern erfüllen
Wie können wir das Salz der Erde sein (Vers 13)? Salz hat eine unscheinbare, aber kräftige Wirkung gegen Fäulnis. So wird es auch heute noch als «Pökelsalz» zur Konservierung von Fleisch benutzt. Diese Wirkung zeigt sich in unserem Leben, wenn wir das Böse verurteilen, die schlechten Einflüsse stoppen und mit Gottes Gnade ein gerechtes Leben führen.
Als das Licht der Welt (Vers 14) ist es unsere Aufgabe, etwas von Gott darzustellen. Durch unser Verhalten dürfen wir unseren Mitmenschen zeigen, dass Er heilig und gerecht, aber auch gütig und gnädig ist. Wir sind dann wie eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt und von allen gesehen wird.
Da wir aber in Gefahr stehen, unser Licht zu verbergen, vergleicht Jesus Christus uns mit einer Öllampe, die man auf den Lampenständer stellen muss, damit sie allen leuchtet, die im Haus sind.
Ab Vers 17 bis zum Ende des Kapitels stellt der Herr die Grundsätze seines Reiches dem Gesetz gegenüber. Zuerst macht Er klar, dass Er das Gesetz und die Propheten nicht für ungültig erklärt. Er ist vielmehr gekommen, um die Aussagen des Alten Testaments zu erfüllen. Die sittlichen Prinzipien des Gesetzes werden im Reich Gottes auf einer neuen Grundlage verwirklicht.
In den Versen 19 und 20 warnt Jesus Christus alle Menschen, die ihre eigenen Ansichten über das Wort Gottes stellen, bzw. nur der Form nach religiös leben. Weil sie damit die göttliche Wahrheit aufheben, bleibt ihnen der Zugang zum Reich Gottes versperrt.
Nicht töten
In den Versen 21-32 werden die beiden Elemente des Bösen behandelt: Gewalttat und Unmoral. Das Gesetz verbot gewalttätige und unsittliche Handlungen, indem es sagte: Du sollst nicht töten (Vers 21), du sollst nicht ehebrechen (Vers 27). Die Grundsätze des Reiches Gottes zeigen nun, dass diese sündigen Taten einem verdorbenen Herzen entspringen. Darum verurteilt der Herr bereits die bösen Ansätze in unseren Gedanken.
Das wird in Vers 22 deutlich, wenn Er erklärt: «Jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein.» Dieser Zorn ist vielleicht im Herzen verborgen und deshalb für keinen Menschen sichtbar. Aber der Herr sieht und verurteilt ihn. Auch zornige Worte und Beleidigungen wiegen bei Gott schwer.
Der Herr Jesus erweitert seine Belehrungen zu diesem Thema, indem Er zwei Beispiele anfügt:
- Gott möchte, dass wir mit einem guten Gewissen vor Ihn treten, um Ihn anzubeten. Wird mir jedoch bewusst, dass ich jemand Unrecht getan habe, so werde ich aufgefordert, das zu ordnen, was zwischen mir und ihm liegt. Nur so kann Gott sich über mein Lob freuen. Diese persönliche Überprüfung unserer Lebenspraxis wird auch in 1. Korinther 11,28 angesprochen.
- Die Zeit, um Sünden zu ordnen, ist begrenzt. Das traf damals auf das Volk Israel als Ganzes zu. Es war nicht bereit, sein Missverhältnis zu Gott in Ordnung zu bringen. Darum wurde es «dem Richter überliefert». Es kam unter die Züchtigung Gottes. Das wird so lange dauern, bis die Schuld abgetragen ist (Jesaja 40,1.2).
Nicht ehebrechen
Der Schöpfer hat die Ehe für das Zusammenleben von Mann und Frau gegeben. Deshalb verbietet Er jeden Geschlechtsverkehr ausserhalb der Ehe. Das macht sowohl das Alte als auch das Neue Testament klar (2. Mose 20,14; Hebräer 13,4).
Der Herr Jesus erklärt nun in Vers 28, dass nicht erst die vollendete Tat, sondern schon der mit Begierde erfüllte Blick auf eine Frau für Gott Ehebruch im Herzen und damit Sünde ist. Dabei geht es nicht um unwillkürliche Gedanken oder ungewollte Blicke, die wir nicht vermeiden können. Lassen wir uns trotzdem durch diese Worte warnen und verurteilen wir jede sündige Regung in unserem Herzen, die zu Hurerei oder Ehebruch führen kann!
Die Verse 29 und 30 sind nicht buchstäblich zu verstehen, sondern ein Bild des schonungslosen Selbstgerichts. Alles, was uns zur Sünde verleitet, müssen wir kompromisslos verurteilen und konsequent meiden. Der Herr begründet es mit deutlichen Worten: Wer ohne Selbstgericht ein sündiges Leben führt, befindet sich auf dem Weg zur Hölle! Dass der Glaubende doch noch gerettet wird, bleibt natürlich wahr, sollte uns aber nie zur Leichtfertigkeit verleiten.
Aus Matthäus 19,8 wissen wir, dass Mose den Israeliten wegen ihrer Herzenshärte gestattet hat, eine Frau zu entlassen. Das entsprach aber nicht dem Willen des Schöpfers, der die Ehe für das ganze Leben auf der Erde gegeben hat. Der Herr wirft nun göttliches Licht auf diese Frage und macht klar, dass Ehescheidung im Widerspruch zu Gottes Gedanken steht.
Nicht falsch schwören
Die Verse 33-37 behandeln das Schwören, wodurch die Juden ihre Aussagen häufig bekräftigten. Sie schwuren beim Himmel oder bei der Erde oder bei Jerusalem, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. Dabei war ihnen vor allem wichtig, nicht falsch zu schwören, d.h. nicht etwas zu beteuern, das unwahr war. Ihr häufiges und leichtfertiges Schwören führte aber dazu, mit ihren übrigen Worten, die nicht von einem Schwur begleitet waren, leichtfertig umzugehen.
In diesem Zusammenhang verstehen wir die Worte des Herrn gut, wenn Er sagt: «Schwört überhaupt nicht … Eure Rede sei aber: Ja – ja; nein – nein.» Sind unsere Worte immer wahr und aufrichtig? Wenn wir «Ja» sagen, sollen wir auch «Ja» meinen. Nur einer, der es nicht so genau mit der Wahrheit nimmt, muss seine Aussagen mit einem Ehrenwort beteuern.
In den Versen 38-42 spricht der Herr den Grundsatz der gerechten Vergeltung an, der im israelitischen Strafrecht seine Anwendung fand. Im Gegensatz dazu führt Er den Grundsatz der Gnade ein. Damit hebt Er eine gerechte Rechtssprechung der Regierung keineswegs auf, sondern stellt eine Richtlinie für das Zusammenleben der Menschen im Reich Gottes auf.
- Die Gnade erträgt geduldig eine Beleidigung oder einen Angriff, anstatt Böses mit Bösem zu vergelten (Vers 39).
- Die Gnade ist bereit, mehr zu geben und zu tun, als von ihr verlangt wird (Matthäus 5,40.41).
- Die Gnade fordert nicht, sondern gibt aus freien Stücken, ohne etwas zurückzuerwarten (Vers 42).
Die Feinde lieben
Aus dem göttlichen Gebot: «Du sollst deinen Nächsten lieben» (3. Mose 19,18), zogen die Schriftgelehrten den verkehrten Umkehrschluss: «Du sollst deinen Feind hassen.»
Dem widerspricht der Herr, indem Er erklärt: «Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.» Wenn wir dieser Aufforderung nachkommen, werden wir praktisch Söhne unseres Vaters im Himmel. Wir stimmen dann in unserem Verhalten mit Ihm überein, denn Er erweist seine Güte als Schöpfer allen Menschen – sowohl den Gerechten als auch den Ungerechten. In Römer 5,8.10 lesen wir zudem von seiner Liebe, die Er seinen Feinden entgegengebracht hat, als Christus für Sünder gestorben ist.
Die Verse 46 und 47 beschreiben, wie sich Nächstenliebe in der Welt zeigt. Man liebt die, von denen man selbst Liebe erfährt. Dazu braucht es weder innere Überwindung noch sittliche Kraft. Darum können das auch Menschen ohne lebendige Beziehung zu Gott verwirklichen. Aber die Feinde können wir nur lieben, wenn wir neues Leben besitzen.
Die Vollkommenheit, die in Vers 48 angeführt wird, betrifft nicht unsere christliche Stellung. Diese ist natürlich perfekt, weil Gott uns in Jesus Christus sieht (Hebräer 10,14; Römer 8,1). Sie beschreibt vielmehr eine praktische Übereinstimmung mit Gott, wenn wir in unserem Verhalten seine Charakterzüge offenbaren: seine Feindesliebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Heiligkeit (Lukas 6,36; 1. Petrus 1,16).
Im Verborgenen (1)
Die ersten 18 Verse behandeln drei Themen: die Wohltätigkeit gegenüber den Mitmenschen (Matthäus 6,2-4), das Gebet zu Gott (Matthäus 6,5-15) und das Fasten (Matthäus 6,16-18). In Vers 1 zeigt der Herr, mit welcher Einstellung wir diese drei Aktivitäten ausüben sollen: Wir tun sie im Verborgenen vor dem himmlischen Vater und nicht vor den Menschen, d.h. wir suchen die göttliche Anerkennung und nicht die Bewunderung unserer Mitmenschen.
Wenn wir jemand finanziell oder praktisch unterstützen, soll es wenn immer möglich niemand wissen. Nicht einmal unsere Linke soll wissen, was unsere Rechte tut. Wer seine guten Werke vor sich herposaunt, um geehrt zu werden, bekommt als Lohn den Beifall der Menschen. Aber die himmlische Belohnung verliert er, weil ihn bei der Wohltätigkeit egoistische Beweggründe leiten.
Auch in unserer Gebetsgemeinschaft mit Gott sollen wir nicht den religiösen Heuchlern gleichen, die gern und lang in der Öffentlichkeit beten, um ihre Frömmigkeit zur Schau zu stellen.
Vers 6 zeigt uns, wo wir beten sollen. Suchen wir ein ruhiges Zimmer oder sonst einen Rückzugsort auf, um im Gebet mit Gott allein zu sein! Unser himmlischer Vater sieht unsere verborgene Fürbitte für andere und wird uns dafür reich belohnen.
Vers 7 erklärt uns, wie wir beten sollen. Beten ist nicht ein unkonzentriertes Wiederholen von langfädigen Redewendungen oder auswendig gelernten Formulierungen, sondern ein konkretes, aufmerksames Reden mit Gott.
Im Verborgenen (2)
Das Gebet, das der Herr Jesus seinen Jüngern in den Versen 9-13 vorstellt, entsprach der Beziehung, in der die Glaubenden damals zu Gott standen. Der Messias war da und ein Überrest wartete auf das Reich Gottes.
Als Christen stehen wir in einem anderen Verhältnis zu Gott. Wir blicken auf ein vollbrachtes Erlösungswerk zurück und haben Frieden mit Gott. Der Heilige Geist wohnt in uns und wir dürfen uns der uneingeschränkten Liebe unseres himmlischen Vaters bewusst sein. Deshalb beten wir heute anders.
Dennoch können wir aus diesem Gebet Nutzen für unser Gebetsleben ziehen. Es enthält sieben Bitten, wobei die ersten drei die Interessen Gottes und die letzten vier die Bedürfnisse des Beters betreffen. Hat das, was dem Herrn wichtig ist, in unseren Gebeten auch erste Priorität?
Die Verse 14 und 15 fordern uns auf, jederzeit zur Vergebung bereit zu sein. Wenn uns bewusst wird, wie viel Gott uns in Jesus Christus vergeben hat, fällt es uns leichter, uns so zu verhalten (Epheser 4,32).
Die Menschen, die in der Bibel fasteten, verzichteten für eine bestimmte Dauer auf etwas Irdisches (z.B. die Nahrung), das ihnen von Gott zustand, um gezielt Gemeinschaft mit Gott zu haben. Leider gab es dabei auch Heuchler, die mit dem Fasten ihre Frömmigkeit herausstellen wollten. Wir werden in der Bibel nicht zum Fasten aufgefordert. Aber wir fragen uns: Hat das Irdische in unserem Leben den richtigen Stellenwert oder behindert es unsere geistlichen Aktivitäten?
Schätze sammeln
Die Verse 19-34 beschreiben die Geisteshaltung, die in der Welt vorherrscht: einerseits das Verlangen nach Reichtum (Matthäus 6,19-21) und anderseits die Sorge um das Lebensnotwendige (Matthäus 6,24-34). Beides soll das Herz des Glaubenden nicht in Beschlag nehmen.
Die Schätze auf der Erde sind vergänglich und verlierbar. Wirtschaftskrisen zeigen, wie schnell ein grosses Vermögen zwischen den Fingern zerrinnt. Wir sollen daher nicht irdischen Reichtum ansammeln, sondern unsere Lebenskraft für himmlische Schätze einsetzen. Was heisst das konkret? Wir engagieren uns hier für Jesus Christus, der im Himmel hoch geehrt wird. Wenn seine Person und das, was Ihn betrifft, das Ziel unserer Aktivität und Anstrengung ist, setzen wir uns für etwas ein, das seinen Wert nie verliert.
Schätze haben offenbar eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf das menschliche Herz. Darum wird das Streben nach einem himmlischen Schatz unsere Herzen mit dem Himmel verbinden.
Die Verse 22 und 23 zeigen uns nun, wie unser Leben die richtige Grundausrichtung bekommt: Unser Auge muss einfältig sein. Wie ist das möglich? Indem wir im Glauben unsere Herzen nur auf Jesus Christus ausrichten. Dann wird es in unserem Leben hell und wir sehen deutlich, auf welchem Weg wir Ihm nachfolgen sollen. Ist unser Auge aber böse, so blicken wir auf die Welt und das, was sie bietet. Dann wird unser Herz von Christus abgezogen und unser Leben nicht mehr von seinem Licht erhellt.
Nicht sorgen
Vers 24 bezieht sich sowohl auf das Anhäufen von Reichtum (Vers 19) als auch auf die Sorgen um das Lebensnotwendige (Vers 25). Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder leben wir für Gott oder wir lassen uns von der Habsucht und den Existenzsorgen versklaven. Die Ausdrücke «lieben» und «hassen» weisen zudem darauf hin, dass es um eine Herzenseinstellung geht. Wenn wir unser Leben als Knechte Gottes führen möchten, wird Er die Sorge für unsere Nahrung und Bekleidung übernehmen.
Wir fragen uns vielleicht nicht, was wir essen oder anziehen sollen, weil wir bei diesen elementaren Bedürfnissen kaum Mangel haben. Aber andere Lebenskosten wie die Wohnungsmiete, Krankenkasse usw. können uns zu schaffen machen. Diesen Sorgen begegnet der Herr mit zwei Beispielen aus der Natur:
- Die Vögel treffen für ihre Nahrung keine Vorsorge. Trotzdem verhungern sie nicht, weil der himmlische Vater sie ernährt.
- Die Lilien sind vom Schöpfer mit einer wunderschönen Blüte ausgestattet, obwohl sie nur für eine kurze Zeit blühen.
Die Jünger des Herrn sind dem himmlischen Vater viel wichtiger als die Vögel und die Blumen. Darum wird Er sie bestimmt nicht vergessen und ihnen geben, was sie fürs Leben brauchen. – Dieser Abschnitt endet mit zwei wichtigen Aufforderungen, die wir bei aller Arbeit im Alltag beherzigen wollen:
- Denkt zuerst an das Reich Gottes!
- Macht euch keine Sorgen im Voraus!
Nicht richten
In den Versen 1-6 belehrt der Herr uns über die Beziehung eines Jüngers zu seinen Mitmenschen. Zum einen verurteilt Er einen falschen Richtgeist (Matthäus 7,1-5) und zum anderen fordert Er zu einem richtigen Unterscheidungsvermögen auf (Vers 6).
Es geht also nicht darum, dass wir überhaupt nichts beurteilen sollen. Es stellt sich vielmehr die Frage, in welcher Geisteshaltung wir unseren Glaubensgeschwistern begegnen. Wer immer sofort zur Stelle ist, um andere scharf zu kritisieren, wird von Gott und Menschen genauso streng beurteilt.
Vers 3 weist uns auf eine latente Gefahr hin: Mit anderen verfahren wir streng und mit uns sind wir milde! Das ist unaufrichtig und ungerecht. Aus Vers 4 lernen wir, dass ungerichtete Sünden unser Urteilsvermögen schwächen. Nur ein ständiges Selbstgericht gibt uns eine klare Sicht und macht uns fähig, anderen zu helfen, die von einem Fehltritt übereilt worden sind (Galater 6,1).
In Vers 6 fordert uns Jesus Christus auf, die biblische Botschaft im richtigen Moment und am richtigen Ort weiterzusagen. Denn wir sollen die Menschen nicht unnötig provozieren, so dass sie das Wort Gottes in den Dreck ziehen. Der Herr wird uns das nötige Empfinden dafür geben.
Die Verse 7-12 behandeln nochmals das Gebet. Die Ausdrücke «bitten», «suchen» und «anklopfen» spornen uns zu einem ausdauernden und vertrauensvollen Beten an. Zudem wissen wir: Unser Vater im Himmel weiss am besten, was für uns recht ist, und gibt uns nur Gutes!
Falsche Propheten
Echte Jüngerschaft beginnt mit einer engen Pforte und führt auf einem schmalen Weg zum Leben. Nur wer Buße über seine Sünden tut, geht durch diese enge Tür. Dann folgt er auf dem schmalen Weg dem Herrn Jesus nach. Das erfordert täglich Selbstverleugnung und Gehorsam.
Leider sind nur wenige dazu bereit. Viele möchten lieber ihr eigenes Leben führen und selbst bestimmen. Sie befinden sich auf dem breiten Weg. Wenn sie nicht Buße tun, gehen sie ewig verloren.
In den Versen 15-20 warnt der Herr vor falschen Propheten. Aus 2. Petrus 2,1 wissen wir, dass es auch in der Christenheit viele Verführer gibt. Äusserlich geben sie sich fromm, aber in ihrem Innern hegen sie zerstörerische Absichten. Da wir nicht in ihre Herzen sehen können, fordert der Herr uns auf, sie an ihren Früchten zu beurteilen. Wenn die Früchte ihres Wirkens schlecht sind, müssen wir uns von ihnen abwenden.
Wir brauchen nicht alles Falsche zu prüfen, sondern können anhand des Guten erkennen, was schlecht ist. Was sind nun die Merkmale eines treuen Arbeiters?
- Er verbreitet das unverfälschte Wort Gottes.
- Er möchte durch seinen Dienst die Menschen zu Jesus Christus führen.
- Er hat bei aller Tätigkeit das Wohl der Herde Gottes im Auge.
Wenn diese guten Früchte an einem Baum fehlen, so ist er faul. Es handelt sich dann um einen bösen Arbeiter, den wir meiden sollen. Wenn er kein Leben aus Gott besitzt, erwartet ihn das Gericht.
Hören und tun
Leider gibt es nicht nur falsche Propheten, sondern auch falsche Jünger. Sie reden Christus mit «Herr, Herr!» an, nehmen Ihn aber nicht in ihr Herz auf. Sie bekennen sich äusserlich zu Ihm und sind auch für Ihn aktiv. Aber sie tun den Willen Gottes nicht. Sie sind nicht bereit, sich von Herzen unter die göttliche Autorität zu stellen. Ihr unechtes Bekenntnis wird am Tag des Gerichts ans Licht kommen. Weil sie keine Glaubensbeziehung zum Herrn Jesus haben, werden sie an der zukünftigen Herrlichkeit des Reiches nicht teilnehmen, sondern ewig verloren gehen.
Der Herr Jesus schliesst seine Rede auf dem Berg mit einem zweifachen Vergleich ab:
- Wer sein Wort hört und tut, ist ein kluger Mensch. Er baut sein Lebenshaus auf den Felsen. Darum wird er durch die Stürme im Leben nicht erschüttert und besitzt durch den Glauben an Jesus Christus Sicherheit für die Ewigkeit.
- Wer seine Worte hört und nicht tut, ist dumm. Er besitzt in seinem Leben kein sicheres Fundament und ohne den rettenden Glauben keine Perspektive für die Ewigkeit.
Wir lernen daraus: Das Wort Gottes hören ist wichtig. Aber erst die Verwirklichung der biblischen Wahrheit gibt uns echte Stabilität im Glauben.
Die vielen Leute, die dem Herrn Jesus zugehört hatten, waren über seine Lehre erstaunt. Sie merkten etwas von der göttlichen Autorität, die in seinen Worten lag. Würden sie dem klugen oder dem törichten Menschen gleichen?
Der Herr heilt
Nach den Worten des Königs in den Kapiteln 5 bis 7 folgen in den Kapiteln 8 und 9 die Werke des Königs. Sie offenbarten Gottes Macht, wie sie sich in Güte an den Menschen erwies. Sie bestätigten, dass Er der von Gott gekommene Messias war.
Zuerst kam ein Aussätziger zu Jesus mit dem Wunsch, von Ihm geheilt zu werden. Seine Worte zeigen, dass er an seine göttliche Macht glaubte, aber an der Gnade des Heilands zweifelte. Wollte Christus wirklich einen Aussätzigen heilen? Ja, Er wollte es!
Dieses Wunder offenbart drei Eigenschaften des Herrn Jesus:
- Er ist gnädig, denn Er heilte diesen kranken Mann, obwohl dieser es nicht verdient hatte.
- Er ist heilig. Darum konnte Er den Aussätzigen berühren, ohne angesteckt zu werden.
- Er ist mächtig und vollbrachte ein Wunder, das nur Gott zu tun vermag.
Der römische Hauptmann hatte kein Anrecht auf die Vorrechte Israels. Aber sein Glaube erkannte in Jesus Christus die göttliche Allmacht und Gnade, die sich nicht auf ein Volk begrenzen konnte. Darum bat Er den Herrn, seinen gelähmten Knecht zu heilen. Der Heiland kam dieser Bitte nach. Er heilte den Knecht aus Distanz, weil sein Platz als Messias noch in Israel war. Trotzdem öffnete Er damit die Tür für Menschen aus anderen Völkern. – Durch dieses Beispiel macht der Herr Jesus ab Vers 10 klar, dass reine Volkszugehörigkeit nicht genügt, um ins Reich einzugehen. Der Glaube an seine Person ist ausschlaggebend.
Dem Herrn nachfolgen
Die Schwiegermutter von Petrus lag mit Fieber im Bett. Als Jesus das Haus seines Jüngers betrat, sah Er sofort, wie es um sie stand. Voll Mitleid rührte Er ihre Hand an und heilte sie. Sogleich stand sie auf und beantwortete die Liebe des Heilands, indem sie Ihm diente. Bei unserer Bekehrung sind wir von einer viel schlimmeren «Krankheit» geheilt worden. Da stellt sich die Frage: Stellen wir aus Dankbarkeit für die Befreiung von unserer Sündenlast unser Leben dem Herrn zur Verfügung?
Die Verse 16 und 17 beschreiben, wie Jesus dem Elend und Leid im Volk Israel heilend begegnete. Damit erfüllte sich einerseits eine Prophezeiung Jesajas über den Messias. Anderseits wurde dadurch klar, dass Emmanuel (= Gott mit uns) sein Volk besuchte (Matthäus 1,23). Trotz ihres Versagens konnten die Israeliten erkennen: Gott ist in seiner Gnade mit uns!
Bevor der Herr Jesus mit einem Schiff den See überquerte, sprach Er über Jüngerschaft. Zwei grosse Grundsätze werden dabei deutlich:
- Die Nachfolge bringt Verzicht mit sich. Ein Jünger des Herrn kommt auf der Erde nicht zu Ehren. Im Gegenteil! Er teilt den Platz der Verwerfung mit dem Sohn des Menschen, der hier keine Bleibe hatte.
- Dem Herrn steht immer der erste Platz zu. Wenn wir seinem Ruf zur Jüngerschaft kompromisslos folgen, bekommt alles andere den richtigen Stellenwert – auch unsere Pflichten gegenüber den Eltern.
Die Überfahrt illustriert dann, welche Erfahrungen ein Jünger in der Nachfolge des Herrn macht.
Die Überfahrt nach Gadara
Durch die Schifffahrt erteilte der Herr seinen Jüngern verschiedene Lektionen:
- Er stieg zuerst ins Schiff, denn Er geht als unser Meister voran und wir folgen Ihm.
- Es erhob sich ein grosses Unwetter. Auf dem Weg der Jüngerschaft begegnen wir Problemen und Hindernissen.
- Jesus schlief trotz des Sturms im Schiff. So scheint es manchmal, als interessiere Er sich nicht für unsere Schwierigkeiten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Er greift nicht ein, weil Er unseren Glauben prüfen will.
- «Herr, rette uns, wir kommen um!» Ist das zuweilen nicht auch unser Hilferuf, wenn wir mit den Problemen nicht fertig werden und es uns am ruhigen Gottvertrauen fehlt?
- So wie Jesus Christus den Sturm zum Schweigen brachte, so kann Er den Schwierigkeiten und Widerständen, denen wir begegnen, ein Ende machen. Er wird es spätestens am Ende unserer Reise tun, wenn wir aus den Problemen herausgenommen und in seine Herrlichkeit eingehen werden.
Auf der anderen Seite des Sees begegnete der Sohn Gottes zwei Menschen, die von Dämonen besessen waren. Weil Er in der Wüste den Starken gebunden hatte, raubte Er ihm nun seinen Hausrat, indem Er die beiden befreite (Matthäus 12,29). Durch seine Machtentfaltung stellte Er die Bewohner der Stadt ins Licht Gottes. Ihre Herzen wurden offenbar: Sie wollten lieber ihr sündiges Leben unter der Macht Satans weiterführen, als den Messias bei sich haben. Wie schade!
Ein Gelähmter wird geheilt
Die Heilung des Gelähmten illustriert, wozu der Messias gekommen war. Dieser kranke Mann ist ein Bild vom Volk Israel, das wegen seiner Untreue unter der Züchtigung Gottes stand. Weil es versagt hatte, musste es sich unter die Herrschaft der Nationen beugen. Christus war nun gekommen, um diese Züchtigung wegzunehmen, indem Er dieses Volk heilen und ihm seine Sünden vergeben wollte. Doch alles hing vom Glauben an den Messias ab (Vers 2). Wenn das Volk Ihn annahm, dann wollte Gott es wiederherstellen und segnen, wie Er es in Psalm 103,3 vorausgesagt hatte: «Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten.»
Das war die Botschaft, die Jesus den Führern des Volkes durch die Heilung des Gelähmten mitteilte. Leider lehnten sie Ihn als Messias ab. Deshalb blieb eine nationale Wiederherstellung aus. Nur einzelne, die sich im Glauben an den Heiland wandten, empfingen Vergebung ihrer Sünden.
Zweimal heisst es in diesem Abschnitt, dass der Herr etwas sah, das nur Gott wahrnehmen kann:
- In Vers 2 sah Jesus den Glauben in den Herzen dieser Männer, die den Gelähmten zu Ihm brachten, und beantwortete ihn auf herrliche Weise.
- In Vers 4 sah Er die bösen Gedanken der Schriftgelehrten, die Ihn der Gotteslästerung beschuldigten, und verurteilte sie.
Der Herr Jesus blickt auch in unsere Herzen hinein. Wie freut Er sich, wenn Er einen Glauben wahrnimmt, der Ihm alles zutraut!
Gnade und Gesetz
Die Berufung von Matthäus macht klar, dass Jesus Christus für Sünder gekommen war. Er knüpfte nicht bei den selbstgerechten Pharisäern an, sondern bei solchen, die ihren sündigen Zustand einsahen.
Jesus rief Matthäus in seine Nachfolge, als dieser mitten in seiner Arbeit steckte. Er sass am Zollhaus und nahm für die Römer Zoll und Steuern ein. Doch das hinderte ihn nicht, sofort eine ganze Entscheidung zu fällen. Er stand auf und folgte Jesus nach.
Kurz darauf lud er den Herrn zum Essen ein, damit andere Zöllner und Sünder mit Ihm in Kontakt kämen. Er wollte, dass auch sie den Heiland in ihr Herz aufnahmen. Seine Einstellung ist ein Ansporn für uns! Suchen wir auch nach Möglichkeiten, andere Menschen mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen?
Ab Vers 14 geht der Herr auf die Frage des Fastens ein. Während des Dienstes von Johannes dem Täufer war Fasten, Trauer und Demütigung durchaus angemessen gewesen. Aber das Kommen des Messias sollte für die Treuen in Israel ein Grund zur Freude sein, wie Johannes es selbst ausdrückte (Johannes 3,29). Die Zeit des Fastens käme später wieder, wenn Christus verworfen und weggetan sein würde.
In den Versen 16 und 17 erklärte der Sohn Gottes, dass mit seinem Kommen eine neue Zeitperiode angebrochen war, die mit der alten Zeit des Gesetzes nicht vereinbar war. Diese neue Zeit der Gnade kann nicht in die Formen des Gesetzes gepresst werden, denn die Kraft und Freude der Gnade sprengen die Schranken des Gesetzes.
Herr über Leben und Tod
Wir können die Auferweckung der Tochter von Jairus und die Heilung der blutflüssigen Frau einerseits als ein Bild des Wirkens Gottes im Volk Israel betrachten und anderseits auf unsere Errettung übertragen.
Das gestorbene Mädchen illustriert Israel, wie es wegen seiner Untreue als Volk für Gott gestorben war. Doch nun war der Messias gekommen, um eine nationale Wiederbelebung herbeizuführen. Hätten die Juden Ihn angenommen, so wäre Israel als Volk auferstanden, wie die Propheten es vorausgesagt hatten (Hesekiel 37). Durch die Verwerfung von Christus wurde diese nationale Wiederherstellung aber zeitlich hinausgeschoben.
In der Zwischenzeit steht jedem Menschen die Möglichkeit offen, wie die blutflüssige Frau persönlich im Glauben zum Heiland zu kommen und gerettet zu werden. Die Tatsache, dass Jesus die lärmende Menge vor der Auferweckung des Mädchens hinausschickte, weist darauf hin, dass die ungläubigen Juden an der öffentlichen Wiedereinsetzung des Volkes Israel in der Zukunft nicht teilhaben werden. Nur der treue Überrest wird ins Tausendjährige Reich eingehen.
In der Auferweckung der Tochter von Jairus erkennen wir das Werk, das Gott in uns getan hat. Wir wissen, dass wir vor unserer Bekehrung geistlich tot waren. Doch Gott hat uns mit dem Christus lebendig gemacht (Epheser 2,1-5). Der Blutfluss ist ein Bild von den schlimmen Auswirkungen der Sünde im Menschen. Auch davon wurden wir geheilt, als wir im Glauben zu Jesus Christus, unserem Erretter, Zuflucht nahmen.
Ein grosses Arbeitsfeld
Die beiden Blinden offenbarten einen bemerkenswerten Glauben:
- Sie sprachen Jesus als Sohn Davids an und anerkannten damit – im Gegensatz zu vielen anderen – seine königlichen Rechte.
- Sie glaubten an seine göttliche Macht, indem sie Ihm zutrauten, dass Er sie gesund machen könne.
Jesus Christus beantwortete ihren Glauben und öffnete ihnen die Augen, so dass sie wieder sahen. Diese Heilung illustriert einen Grundsatz, der bis heute gültig ist: Der Glaube führt zum Sehen und Verstehen (Hebräer 11,1).
Der Stumme ist ein Bild unseres Zustands vor der Bekehrung: Wir waren unfähig, Gott zu loben und für Ihn zu zeugen. Doch der Herr Jesus hat uns aus der Sklaverei Satans befreit und unsere Zunge für das Lob und das Zeugnis Gottes gelöst.
Die Lästerung der Pharisäer in Vers 34 macht klar, dass sie trotz der deutlichen Offenbarung der Macht Gottes bewusst im Unglauben verharrten.
Doch Jesus liess sich von diesem Widerstand nicht abhalten, seinen Dienst der Liebe in Israel weiterzuführen. Er predigte das Wort Gottes und heilte jede Krankheit. Mit einem Herzen voller Liebe und Einsatz sah Er die grossen Bedürfnisse der Menschen in Israel. Trotz der breiten Ablehnung war die Ernte gross, denn der Herr blickte mehr auf die Möglichkeiten der göttlichen Gnade als auf die Bosheit des Menschen. – Ist das auch unsere Sichtweise, wenn wir an unsere Mitmenschen denken?
Berufung und Aussendung der Apostel
In den Versen 1-4 rief der Herr zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Machtbefugnis, unreine Geister auszutreiben und Kranke zu heilen. Obwohl Er in Israel bereits verworfen war, wollte Er seine Apostel noch mit einer Botschaft zu diesem Volk senden.
Die Verse 5-15 beschreiben ihren Auftrag, den sie während seiner Anwesenheit auszuüben hatten:
- Ihre Zielgruppe beschränkte sich auf die Israeliten, denn Er war als König zu ihnen gekommen (Matthäus 10,5.6).
- Ihre Botschaft lautete: «Das Reich der Himmel ist nahe gekommen» (Vers 7). Damit führten sie die Verkündigung weiter, die Jesus Christus in Matthäus 4,17 angefangen hatte. Der Messias war da und bereit, das Reich aufzurichten, wenn das Volk Ihn aufnehmen würde.
- Die Wunder verliehen ihren Worten göttliche Autorität (Vers 8). Auch darin führten sie das Werk fort, das der Herr begonnen hatte (Matthäus 8 und 9).
- Für ihre persönlichen Bedürfnisse sollten sie sich nicht selbst bemühen, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert (Matthäus 10,9.10). Ihr Meister war noch anwesend und würde für sie sorgen.
- In den Versen 11-14 beschreibt der Herr, wie sie in ihrem Dienst vorzugehen hatten. Sie sollten nach Israeliten ausschauen, die für das Reich würdig waren, weil sie Jesus als Messias anerkannten.
- In Vers 15 zeigt Er ihnen die Konsequenzen derer, die ihre Botschaft ablehnten. Weil sie damit den Messias selbst verwarfen, würde sie eine grössere Strafe treffen als die Bewohner von Sodom und Gomorra.
Widerstand im Dienst
Die Verse 5-15 betreffen nur den damaligen Auftrag der Jünger während der Anwesenheit ihres Königs. Die Belehrungen ab Vers 16 sind allgemeiner und beziehen sich auf das Zeugnis der Apostel, das sie nach der Himmelfahrt des Herrn in Jerusalem und Umgebung abgelegt haben. Dieser Dienst am Volk Israel wurde durch die Zerstörung Jerusalems unterbrochen und wird erst während der Drangsalszeit durch den zukünftigen Überrest fortgesetzt werden.
Der Herr vergleicht seine Jünger mit drei Tieren. Weil sie wehrlos wie Schafe waren, sollten sie klug wie Schlangen handeln, dabei aber wie Tauben keine hinterlistigen Absichten verfolgen.
Was Jesus Christus hier ankündigte, erlebten die Apostel tatsächlich: Für ihr treues Zeugnis wurden sie von der jüdischen Justiz unter Druck gesetzt. Dabei erfuhren sie aber, wie der Geist Gottes ihnen die richtigen Worte zu ihrer Verantwortung eingab (Apostelgeschichte 5,27-32).
In den Versen 21-23 spricht der Herr vor allem von der noch zukünftigen Drangsalszeit: Dann werden seine Zeugen sogar innerhalb der eigenen Familie mit Hass und aktivem Widerstand rechnen müssen. Durch Verfolgung werden sie von einer Stadt zur anderen getrieben werden, bis der Sohn des Menschen in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird.
Ein Jünger nimmt auf der Erde die gleiche Stellung wie sein Herr ein. Weil er seinen Meister vertritt und für Ihn zeugt, teilt er mit Ihm auch die Verwerfung von der Welt. Dieser Grundsatz gilt auch für uns.
Fürchtet euch nicht!
In diesem Abschnitt macht der Herr seinen Jüngern für ihren nicht einfachen Dienst Mut, indem Er ihnen dreimal sagt: «Fürchtet euch nicht!» (Matthäus 10,26.28.31).
Die falschen Beschuldigungen ihrer Feinde würden einmal ans Licht kommen und verurteilt werden, denn nichts ist verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird. Das Bewusstsein, dass einmal alles offenbar werden wird, sollte die Jünger anspornen, ihre Botschaft öffentlich zu verkünden. Sie hatten ja nichts zu verstecken! Vielmehr wurde dadurch ihre Treue zu Christus offenbar.
In Vers 28 fordert der Herr sie auf, in ihrem Zeugnis nicht die Widersacher, sondern Gott vor Augen zu haben. Warum?
- Weil der Gedanke an die Verfolgung durch ihre Feinde oder den Märtyrertod sie zum Schweigen verleiten könnte.
- Weil der Gedanke an die ewige Strafe Gottes, die alle Ungläubigen einmal trifft, sie zum Reden anspornen würde (2. Korinther 5,11).
Die Verse 29-31 erinnern die Jünger an die Fürsorge des himmlischen Vaters. Er, der sogar den Tod eines Sperlings beachtet, würde sie nicht ohne Absicht dem Märtyrertod preisgeben.
Schliesslich motiviert der Herr seine Jünger mit der zukünftigen Belohnung (Vers 32). Wer sich vor den Menschen zu Ihm bekennt, wird einen Lohn im Himmel haben. Wer den Herrn aber vor den Menschen verleugnet, wird die himmlische Anerkennung verlieren.
Sein Leben verlieren, um es zu finden
Weil das Volk Israel seinen Messias nicht angenommen hatte, wurde Er zum Prüfstein für den Einzelnen. Jeder musste sich für oder gegen Ihn entscheiden. Darum brachte Er nicht Frieden auf die Erde. Im Gegenteil, diese Entscheidung, die jeder persönlich zu treffen hat, kann sogar innerhalb der Familie zu einem Zwiespalt führen. Es ist durchaus möglich, dass Jünger des Herrn Jesus für ihr Bekenntnis zu Ihm von ihren Familienangehörigen gehasst und geplagt werden.
Jüngerschaft bringt tiefgreifende Folgen mit sich. Prüfen wir uns selbst, ob wir im Alltag immer dazu bereit sind:
- Ist Jesus Christus mir mehr wert als meine Familie (Vers 37)?
- Ist Jesus Christus mir so viel wert, dass ich die Verwerfung mit Ihm teile und Ihm kompromisslos nachfolge (Vers 38)?
Diese ernsten Fragen werden in Vers 39 mit einem doppelten Grundsatz unterstrichen: Wer sich in seinem Leben selbst verwirklicht, wird es verlieren, weil es für Gott und die Ewigkeit keinen Wert aufweist. Wer aber sein Leben für Christus aufgibt, wird echte Erfüllung und eine herrliche Zukunft finden.
Die Verse 40-42 sprechen von den Menschen, die das Zeugnis der Apostel hörten. Wenn sie diese Boten aufnahmen, stellten sie sich auf die Seite von Christus und akzeptierten die Anrechte Gottes über ihr Leben. Dafür bekamen sie Lohn. Daraus nehmen wir für uns: Der kleinste Dienst, den wir für solche tun, die dem Herrn Jesus angehören, wird belohnt werden.
Zweifel an Christus
Johannes der Täufer, der wegen seines treuen Dienstes im Gefängnis sass, hörte vom Wirken Jesu (Matthäus 14,3.4). Er verstand nicht, warum Christus seine Macht nicht zu seiner Befreiung einsetzte (Jesaja 61,1b).
Der Herr Jesus nahm die Frage von Johannes zum Anlass, um seinen eigenen Auftrag zu beschreiben. Er war gekommen, um den leidenden Menschen in Israel zu helfen und durch die gute Botschaft ihre Herzen zu erreichen. Weil ihre Beziehung zu Gott nicht in Ordnung war, war dieser Dienst viel notwendiger als die Befreiung vom römischen Joch. Der Glaube konnte in den Werken und Worten des demütigen Jesus den von Gott gekommenen Messias anerkennen.
Ab Vers 7 spricht der Herr über Johannes den Täufer und ehrt ihn vor der Volksmenge:
- Er war nicht wankelmütig wie ein Schilfrohr, sondern verkündete unbeeinflusst die göttliche Botschaft.
- Er war kein angesehener Mann, der den Menschen zu Ehren verhalf. Im Gegenteil, er rief sie zur Buße auf.
- Er war mehr als ein Prophet, denn er war der direkte Wegbereiter von Christus und erlebte selbst, wie Dieser zu seinem Volk kam.
- Aber er gehörte noch zur alten Ordnung. Die Erlösten der Gnadenzeit besitzen eine höhere Stellung vor Gott als Johannes, der noch in der Zeit des Gesetzes lebte.
Vers 12 macht klar, dass in der neuen Zeitperiode Glaubensenergie nötig ist, um ins Reich der Himmel einzugehen. Denn man muss sich für den verworfenen Jesus von Nazareth entscheiden.
Widerstand gegen Christus
In den Versen 16-19 erklärt der Herr Jesus, dass die Menschen in Israel sich wie launische, eigenwillige Kinder benahmen:
- Als Johannes ihnen die Buße predigte, wollten sie nicht trauern, sondern unbekümmert weiter fröhlich sein. Weil er sich von ihrer Bosheit distanzierte und sie ernst zurechtwies, behaupteten sie einfach, er habe einen Dämon.
- Als Jesus Christus ihnen die Gnade brachte, wollten sie sich nicht daran freuen, sondern fasten und mit allen Mitteln am Gesetz festhalten. Weil Er ein offenes Herz für die Sünder hatte, bezeichneten sie Ihn frech als einen Fresser und Weinsäufer.
Aber die wenigen, die Buße taten und die Gnade in Christus annahmen, wurden Kinder der göttlichen Weisheit. Durch ihren Glauben rechtfertigten sie Gott. Mit ihrer Bekehrung sagten sie Ja zum Weg, den Er in seiner Weisheit zur Rettung von Sündern gegeben hat.
Gerade da, wo sein Zeugnis durch viele Wunderwerke am klarsten wahrgenommen werden konnte, wurde Jesus am deutlichsten abgelehnt. Wie gross war die Verantwortung für die Städte Chorazin, Bethsaida und Kapernaum, die trotz der Offenbarung göttlicher Gnade nicht Buße taten. Sie würden ein schwereres Gericht erfahren als Tyrus, Sidon und Sodom.
Daraus lernen wir, wie gross die Verantwortung der Menschen wiegt, die das Evangelium genau kennen, aber Jesus Christus als persönlichen Heiland ablehnen. Wenn sie unversöhnt mit Gott sterben, erwartet sie eine schreckliche Strafe (Lukas 12,47).
Ja, Vater, so war es wohlgefällig
Der Herr Jesus empfand den Unglauben in Israel, der in seiner Verwerfung klar zu Tage trat, zutiefst. Trotzdem konnte Er den Vater preisen, weil Er wusste, dass sich darin die vollkommenen Wege Gottes offenbarten. Denn Gott nahm die Ablehnung des Messias zum Anlass, um seinen ewigen Vorsatz zu erfüllen.
Den Weisen und Verständigen, die sich etwas auf ihre Gelehrsamkeit und Gesetzeskenntnis einbildeten, blieb das Neue verborgen. Gott offenbarte es nur denen, die Jesus Christus im kindlichen Glauben annahmen.
Es war der Vorsatz Gottes, die Ausführung seiner ewigen Pläne dem Sohn zu übergeben, der Mensch geworden war und Gott geblieben ist. Dieses Geheimnis seiner Person kann niemand verstehen und ergründen. Nur der Vater erkennt Ihn. Aber den Vater können wir erkennen, weil der Sohn Ihn offenbart hat (Johannes 1,18).
Die Offenbarung des Vaters entspringt völlig der göttlichen Gnade. Darum lädt der Heiland alle Mühseligen und Beladenen ein, zu Ihm zu kommen und ihre Sündenlast bei Ihm abzuladen. Dann übernimmt Er ihre Sache vor Gott und gibt ihnen Ruhe für das Gewissen.
Allen, die so zu Ihm gekommen sind, ruft der Herr nun zu: «Nehmt auf euch mein Joch.» Es ist das Joch der vollständigen Unterordnung unter den Willen des Vaters. Er selbst hat es auf sich genommen und ist so mit einem tiefen Frieden im Herzen seinen Weg gegangen. Nun möchte Er, dass die Glaubenden diese Ruhe auch geniessen, indem sie sich in ihrem Leben ganz Gott unterordnen.
Die Sabbatfrage
In den Versen 1-14 zeigt der Herr anhand von zwei Begebenheiten, dass mit seiner Verwerfung das jüdische System, das besonders durch den Sabbat gekennzeichnet war, durch etwas Neues abgelöst wurde.
Weil seine Jünger Hunger hatten, pflückten sie am Sabbat beim Vorbeigehen einige Ähren ab und assen die Körner. Sofort machten die Pharisäer dem Herrn deswegen einen Vorwurf. Anhand einiger Gründe erklärte Er ihnen, wieso der Sabbat seine Bedeutung verloren hatte:
- Als David, der gesalbte König, verworfen und verfolgt wurde, war er schuldlos, als er die Schaubrote ass, die nur die Priester essen durften. Wie sollte jetzt das Sabbatgebot noch gelten, wenn Christus, der von Gott gesandte König, abgelehnt wurde?
- Die Priester durften am Sabbat im Tempel ihren Dienst verrichten, weil der Tempel höher als der Sabbat war. Der Herr Jesus war noch grösser als der Tempel, denn in Ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig (Kolosser 1,19; 2,9). Darum hatte Er das Recht, am Sabbat zu wirken.
- Gott hatte seinem Volk den Sabbat gegeben, weil Er barmherzig ist und ihnen einen Tag der Ruhe gewähren wollte. Die Pharisäer benutzten aber das Sabbatgebot, um andere zu verurteilen. Damit verfehlte der Sabbat bei ihnen die göttliche Absicht.
- Sohn des Menschen ist ein Titel, den Jesus Christus auf Grund seiner Menschwerdung trägt. Gleichzeitig blieb Er stets Gott. – Deswegen ist Er Herr des Sabbats, der das Sabbatgebot abschaffen konnte.
Der Mensch mit der verdorrten Hand
Mit der Heilung des Menschen, der eine verdorrte Hand hatte, unterstrich der Herr Jesus seine Aussagen über den Sabbat in den Versen 3-8. Zudem wurde durch diese Begebenheit klar, dass es den Pharisäern nicht um das Halten des Sabbats ging. Sie suchten vielmehr einen Grund, um den Heiland anklagen zu können.
Mit einem Vergleich aus dem Alltag offenbarte Jesus die böse Gesinnung der Pharisäer. Sie selbst hätten jederzeit am Sabbat ein Schaf aus der Grube geholt, aber der Kranke sollte nicht geheilt werden. Welche Heuchelei! In seinem Erbarmen machte der Herr diesen Mann gesund, denn die göttliche Gnade lässt sich von religiösen Formen weder einschränken noch aufhalten. Die Pharisäer verhärteten jedoch ihr Herz und überlegten, wie sie Ihn umbringen könnten. Aus diesem Grund zog sich der Herr zurück, denn sein Dienst in Israel war noch nicht abgeschlossen. Ohne Einschränkungen heilte Er alle, die mit Krankheiten und Gebrechen zu Ihm kamen. Doch Er wollte durch seine Wunderwerke nicht öffentlich bekannt werden, denn Er suchte nicht seine Ehre.
Wie treffend erfüllte sich das Wort aus Jesaja 42! Jesus Christus war der Knecht, der in seinem ganzen Leben das Wohlgefallen Gottes fand. Demütig und sanftmütig ging Er seinen Weg: Nie liess Er seine Stimme auf der Strasse hören, um bewundert zu werden. Nie zerstörte Er den schwachen Glauben eines Menschen, der mit einem Bedürfnis zu Ihm kam. Dieses Zitat macht zudem klar: Wenn die führenden Juden Ihn ablehnten, würde Er sich anderen Völkern zuwenden.
Die Lästerung des Geistes
Durch die Heilung des Besessenen entfaltete der Herr nochmals seine göttliche Macht. Dieses Wunder rief zwei Reaktionen hervor:
- Das allgemeine Volk fragte sich: Ist dieser vielleicht der Sohn Davids? Ihre Gedanken gingen in die richtige Richtung. Doch der springende Punkt war, ob sie Jesus Christus wirklich als Messias annehmen würden.
- Die Pharisäer schrieben diese Machtentfaltung, die sie nicht leugnen konnten, dem Teufel zu. Wie schlimm sah es in ihren ungläubigen und verstockten Herzen aus!
Geduldig ging der Herr auf diese böse Behauptung ein. Zuerst machte Er klar, wie absurd ihre Aussage war: Ein Reich kann nicht bestehen, wenn es sich selbst zugrunde richtet! Dann stellte Er die Sache richtig: Er trieb die Dämonen in der Kraft des Heiligen Geistes aus und bewies damit, dass das Reich Gottes in seiner Person zum Volk Israel gekommen war.
Ab Vers 31 weist Jesus Christus auf die Folgen dieses bösen Unglaubens der Pharisäer hin. Mit ihrer Behauptung lästerten sie den Heiligen Geist, weil sie sein Wirken in den vollkommenen Taten des Herrn Jesus bewusst ablehnten. Dafür gab es keine Vergebung.
Mit dem Beispiel eines Baums, der an seinen guten oder faulen Früchten identifiziert wird, offenbarte der Herr den Zustand der Pharisäer: Ihre frechen und angriffigen Aussagen kamen aus einem bösen Herzen. Zum Schluss warnt Er uns alle vor unnützen Worten. Wie schnell haben wir doch leichtfertig etwas dahingeredet, das wir besser nicht gesagt hätten!
Die Verwandten des Herrn Jesus
In ihrem Unglauben forderten die religiösen Leute von Jesus Christus ein Zeichen, nachdem Er bereits durch viele Wunder seine göttliche Allmacht bewiesen hatte. Da gab der Herr ihnen nur das Zeichen Jonas, das von seinem Tod und seiner Auferstehung spricht. Mit der Erfüllung dieser beiden Tatsachen würde dieses ungläubige Volk ihren Messias endgültig verlieren und das göttliche Gericht auf sich ziehen.
Um ihre Verantwortung hervorzuheben, verglich Jesus seine Zuhörer zuerst mit den Menschen von Ninive, die auf die Predigt Jonas Buße taten. Jetzt predigte ein grösserer Prophet als Jona in Israel. Trotzdem hörten sie nicht auf Ihn. Dann stellte Er die Juden der Königin von Scheba gegenüber. Diese unternahm eine weite Reise, um die Weisheit Salomos kennen zu lernen. Doch nun war ein grösserer König als Salomo in Israel. Dennoch wurde Er von seinem Volk nicht angenommen.
Die Verse 43-45 beschreiben das zukünftige Gericht des Volkes Israel. Der unreine Geist spricht vom Götzendienst. Im babylonischen Exil war das Haus Israel davon gereinigt worden. Aber es blieb leer, weil sie den Messias nicht aufnahmen. Darum wird in der Zukunft der Geist des Götzendienstes dieses Volk wieder erfüllen. Sie werden dem Antichristen nachfolgen und den römischen Herrscher anbeten (Offenbarung 13,12).
In den Versen 46-50 erklärt Jesus Christus, dass Er wegen seiner Verwerfung die natürliche Beziehung zum Volk Israel nicht mehr anerkannte, aber mit allen, die an Ihn glaubten, eine geistliche Beziehung einging.
Buchtipp: Bibel-Auslegung zum Matthäus-Evangelium
Einteilung
Der Römer-Brief belehrt uns über die grundlegenden Elemente unserer Errettung. Wir lernen hier vor allem, was Gott getan hat, als wir uns zu Ihm bekehrten. Dieser Brief hat eine klare Struktur, die uns hilft, die einzelnen Aussagen besser zu verstehen. Darum geben wir hier eine kurze Übersicht:
Römer 1,1-17: Einleitung
Diese einführenden Verse machen uns mit dem Thema dieses Briefs bekannt: Es ist das Evangelium Gottes.
Römer 1,18 – 5,11: Das Problem der Sünden
Wir haben alle gesündigt und sind darum schuldig vor Gott. Doch wir müssen nicht verzweifeln. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz gestorben. Wer an Ihn und sein Erlösungswerk glaubt, wird von Gott von jeder Schuld freigesprochen und als gerecht erklärt.
Römer 5,12 – 8,39: Das Problem der Erbsünde
Als Nachkommen Adams besitzen wir alle in uns die Sünde, dieses böse Prinzip, das uns zum Sündigen zwingt. Um von dieser Macht befreit zu werden, sind wir mit Christus der Sünde gestorben. Gott rechnet uns bei der Bekehrung den Tod des Herrn Jesus an. Darum müssen wir nicht mehr sündigen.
Römer 9 – 11: Der Weg Gottes mit Israel
Gottes Heilsangebot richtet sich ohne Unterschied an alle Menschen. Doch auch die speziellen Verheissungen für das Volk Israel werden sich alle erfüllen.
Römer 12 – 16: Die Antwort des Glaubenden
Der Erlöste darf in seinem Leben Gott durch Hingabe und Gehorsam eine Antwort auf seine wunderbare Errettung geben.
Einleitung
Der Brief an die Römer behandelt die Frage, wie ein sündiger Mensch mit dem heiligen Gott versöhnt werden kann. Er zeigt, dass dies nur auf der Grundlage des Opfers von Jesus Christus möglich ist.
Nach dem belehrenden Teil (Römer 1 – 11) folgen praktische Ermahnungen und Hinweise für alle, die durch den Glauben an Jesus Christus und sein am Kreuz vollbrachtes Erlösungswerk Frieden mit Gott haben.
Der inspirierte Schreiber dieses Briefs ist Paulus, der seine Botschaft mit der Autorität eines berufenen Apostels weitergibt. Bereits in den ersten Versen kommt er auf den Inhalt seiner Mitteilung zu sprechen. Es ist das Evangelium: eine gute Botschaft, die aus dem Herzen Gottes kommt. Das Hauptthema des Evangeliums Gottes ist sein Sohn, der als Mensch Jesus Christus hier gelebt und den Tod am Kreuz erlitten hat, aber aus den Toten auferstanden ist. Wir glauben an einen lebenden Herrn.
Wenn der Apostel Paulus von seinem Dienst spricht, sagt er, er habe sein Apostelamt empfangen, um die Menschen zum Glaubensgehorsam zu führen. Es braucht Glauben, um das zu erfassen, was Gott in der Bibel sagt. Aber ebenso wichtig ist, dass man diese göttlichen Anweisungen auch befolgt. Dazu ist Gehorsam nötig.
Die Empfänger dieses Briefes waren zunächst die gläubigen Christen in Rom. Aber das Evangelium richtet sich an alle Menschen. Darum gilt die Botschaft dieses Briefes auch uns.
Paulus und die Gläubigen in Rom
Wenn der Apostel Paulus an die Gläubigen in Rom dachte, konnte er Gott danken, denn sie lebten ihren Glauben Tag für Tag aus. Ein solches Leben hinterliess in der ganzen Welt ein Zeugnis für Gott. Doch wenn er für diese Glaubenden betete, brachte er auch einen Wunsch seines Herzens vor Gott: Er wäre gern einmal zu ihnen nach Rom gekommen, um jenen Christen «etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen». Das bedeutet, dass er ihnen gern das Wort Gottes verkündigt hätte, entsprechend dem Auftrag, den er vom Herrn empfangen hatte. Zudem hoffte er, dass dieser Besuch zur gegenseitigen Ermunterung sein würde.
Schliesslich wünschte Paulus, dass durch seinen Dienst bei den Glaubenden in Rom etwas Frucht für Gott entstehen möchte. Die Briefempfänger waren schon bekehrt. Sie kannten aber noch nicht alles, was Gott am Tag ihrer Bekehrung gewirkt hatte. Darum wollte er ihnen das Evangelium verkündigen, indem er ihnen die grossen Heilstatsachen erklärte (Vers 15).
Das Evangelium ist Gottes Kraft. Es ist nicht nur eine Lehre, sondern das Wort Gottes, das Menschen, die es im Glauben annehmen, verändert. Es rettet die Glaubenden für Zeit und Ewigkeit. Es zeigt uns aber auch Christus, der am Kreuz die Strafe Gottes für unsere Sünden und das Gericht Gottes für die Sünde und ertrug. Auf der Grundlage dieses Werkes kann sich Gottes Gerechtigkeit im Evangelium offenbaren: Der Glaubende wird gerecht gesprochen.
Die gottlosen Heiden
Von Römer 1,18 – 5,11 wird nun das Problem der Sünden der Menschen behandelt.
Jeder Mensch hat die Rechtfertigung aus Glauben nötig, denn jeder hat gesündigt und somit den Zorn Gottes auf sich gezogen. Jeder ist vor Gott verantwortlich, auch der, der die Bibel nicht kennt. Gott hat in der Schöpfung sowohl seine Kraft als auch seine Göttlichkeit offenbart, «damit sie ohne Entschuldigung seien».
Aber anstatt sich vor Gott, dem Schöpfer, zu beugen und Ihn zu verehren, hat der Mensch sich seit den Tagen Noahs von Gott weg dem Götzendienst zugewandt. Davon reden die Verse 21-23.
Und was ist die Folge, wenn der Mensch Gott den Rücken kehrt und nur nach seinen Begierden lebt? Bis heute geht Götzendienst mit sittlichem Verfall einher. Das finden wir in den Versen 24 und 25.
Doch es führt noch weiter. In den Versen 26 und 27 haben wir die Unmoral, in die Gott die Menschen laufen lässt, die nichts von Ihm wissen wollen. Sowohl lesbische Praxis als auch Homosexualität ist Sünde in Gottes Augen.
In Vers 28 steht zum dritten Mal in diesen Versen, dass Gott sie hingegeben hat. Dann folgt eine lange Liste von Ausdrücken, wovon einige mit Gewalttätigkeit zu tun haben. Es ist eine schreckliche Tatsache im Leben und in der Geschichte der Menschen, dass sie voll Gewalttat und Blutvergiessen sind.
Die selbstgerechten Menschen
In den ersten fünf Versen werden jetzt Menschen beschrieben, die anständig leben wollen. Sie kommen ihren Pflichten nach und verwerfen grobe Sünden. Aber sie richten die, die nicht so leben wie sie. Und diesen Richtgeist, der oft milde mit sich selbst und streng mit den anderen ist, verurteilt Gott. Doch Er muss den Anständigen noch etwas Zweites vorhalten: Sie lassen sich nicht durch die Güte Gottes zur Buße leiten. Er greift in ihr Leben ein, aber anstatt Buße zu tun, sind sie störrisch und kehren nicht um. Auch sie werden Gottes gerechtes Gericht empfangen.
Die Erwähnung des Gerichts Gottes führt in den Versen 6-16 zu einigen grundsätzlichen Tatsachen über sein Handeln im Gericht. Gott richtet jeden nach dem, wie er wirklich gelebt hat (nach seinen Werken).
In Vers 7 haben wir das, was Gott anerkennt; aber nur ein bekehrter Mensch kann so leben, wie es hier steht.
In den Versen 8 und 9 haben wir, was Gott verurteilt. Dies betrifft den unbekehrten Menschen. Wenn Gott richtet, berücksichtigt Er das Mass der Kenntnis von Ihm und seinem Willen (Römer 2,9.10).
Die ernste Schlussfolgerung in den Versen 12 und 16 ist, dass alle Menschen unter das Gericht Gottes fallen, weil sie getan haben, was Ihm missfällt. Wie kann man diesem Tag des Gerichts entfliehen? Nur durch den Glauben an den Herrn Jesus, der gesagt hat: «Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet.»
Die religiösen Juden
Bis jetzt haben wir zwei Gruppen von Menschen gesehen: die Unmoralischen und die Anständigen. Jetzt kommt noch eine dritte Kategorie vor uns: die Religiösen. Sie werden uns anhand der Juden geschildert. Der religiöse Mensch kennt, liest und hört Gottes Wort, tut es aber nicht. Gott verurteilt drei Verhaltensweisen solcher Leute.
Die Verse 17-20 schildern den Hochmut religiöser Menschen. Sie sind stolz darauf, die Bibel zu besitzen und eine äusserliche Beziehung zu Gott zu haben. Sie meinen, alles richtig beurteilen und andere führen zu können. Welch eine Anmassung! Als Glaubende wollen wir daraus lernen, bescheiden zu sein, nicht hoch von uns zu denken und in echter Demut zu leben.
Zu den Versen 21-24 könnte man sagen: Der religiöse Mensch äussert sich als Moralapostel. Er predigt Wasser und trinkt Wein, wie man so sagt. Wer das Wort Gottes nur predigt, aber nicht danach lebt, schadet dem Namen Gottes. Er bringt Gott in Verruf, der die Anordnungen in der Bibel gegeben hat.
Die Beschneidung ist das äussere Zeichen der Zugehörigkeit zur jüdischen Religion. Wenn ein Jude aber trotz seiner Beschneidung ungerecht und ungehorsam lebt, ist er ein Gesetzes-Übertreter. Er steht auf der gleichen Stufe wie ein Nicht-Jude. Er bildet sich auf die Zugehörigkeit zur richtigen Religion etwas ein, ist aber innerlich weit von Gott entfernt. Darum spricht Paulus in Vers 29 von der Beschneidung des Herzens. Damit meint er den Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Das ist entscheidend.
Kritische Fragen
Dieser Abschnitt ist nicht so leicht zu verstehen. Doch der Apostel möchte in diesen Versen drei falschen menschlichen Schlussfolgerungen entgegentreten.
Die Juden besassen das Wort Gottes (das Alte Testament). Bewies nun der Unglaube von einigen dieser religiösen Menschen, dass Gottes Wort mangelhaft ist? Nein, das kann nicht sein. Gott ist treu, sein Wort ist vollkommen und Er steht zu seinen Aussagen (Römer 3,1-4).
In den Versen 5-7 wird das Gericht Gottes in Frage gestellt. Wenn das ungerechte Verhalten des Menschen die Herrlichkeit Gottes erst recht hervorhebt, ist Er dann nicht ungerecht, wenn Er das Böse richtet? Auch dieser verkehrten Schlussfolgerung widersteht der Apostel, indem er sagt: «Das sei ferne!»
Die dritte falsche Schlussfolgerung ist noch schlimmer. Man sagt: Böses fördert das Gute. Das wird im Ausspruch: «Lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme!», behauptet. Eine solche Aussage ist nicht nur verkehrt, sie offenbart auch eine böse innere Einstellung. Darauf antwortet der Apostel: Wer so spricht, den wird das gerechte Gericht Gottes treffen.
Aus diesen Versen lernen wir drei Tatsachen:
- Der Mensch kann das Gute von Gott nur verderben.
- Alles Böse wird von Gott gerichtet und bestraft.
- Doch Gott kann aus dem Bösen Gutes hervorbringen. Denken wir nur an Golgatha! Der Hass der Menschen hat Jesus Christus ans Kreuz gebracht. Aber sein Opfertod wurde zur Grundlage der Errettung für jeden, der Buße tut und an Ihn glaubt.
Alle Menschen sind schuldig
In diesem Abschnitt finden wir das abschliessende Urteil Gottes über alle Menschen, egal zu welcher der drei vorgestellten Gruppen jemand gehört.
Alle Menschen sind schuldig, denn alle haben gesündigt. Sieben Bibelstellen aus dem Alten Testament belegen dies. Der Mensch ist im Kern verdorben. Kein Gerechter, keiner in Übereinstimmung mit Gott, alle unbrauchbar für Ihn! Aber der Mensch sündigt auch mit seinen Worten (Römer 3,13.14). Und sein Tun ist sündig (Römer 3,15-17). Das letzte Zitat: «Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen», zeigt, dass auch das Innere des Menschen und seine Beweggründe sündig sind.
Wie niederschmetternd lautet das Urteil Gottes in Vers 19! Es betrifft alle Menschen, sowohl die Religiösen, denen der Mund verstopft wird, als auch die Unmoralischen und die Anständigen, die ohne Gott leben. «Die ganze Welt ist dem Gericht Gottes verfallen.»
Im letzten Vers dieses Abschnitts erwähnt Paulus das Gesetz. Er meint damit die zehn Gebote. Sie sind Gottes Minimalanforderungen an den Menschen. Weil er aber ein Sünder ist, kann er Gottes Gebote nicht halten. Wer versucht, sie zu halten, um dadurch vor Gott gerecht zu werden, wird scheitern. Das Gesetz kann den Menschen nicht retten. Es zeigt ihm nur, wie sündig er ist. Das Gesetz gleicht einem Spiegel, der aufdeckt, wie schmutzig ich bin. Doch er kann mich nicht sauber machen.
Gottes Gerechtigkeit im Evangelium
Der neue Abschnitt beginnt mit den Worten: «Jetzt aber.» Es ist die Zeit der Gnade, in der wir leben. Wir haben gesehen, dass das Gesetz (die zehn Gebote) die Sünde des Menschen nur aufzeigt, ihm aber nicht helfen kann. Gottes Lösung für das Problem unserer Sünden wird jetzt vorgestellt. Es geht um seine Gerechtigkeit, die durch das Erlösungswerk Christi am Kreuz erwirkt wurde. Der Heiland, der absolut gerecht gelebt hat, ging freiwillig für unsere Sünden ins Gericht Gottes. In den drei Stunden der Finsternis am Kreuz hat Ihn die gerechte Strafe über unsere Sünden getroffen. Er hat in diesem Gericht ausgeharrt, bis Er rufen konnte: «Es ist vollbracht!» Dadurch hat Er diese göttliche Gerechtigkeit erworben, die nun allen Menschen angeboten wird. Doch sie kommt nur denen zugut, die sie im Glauben ergreifen.
Vers 24 macht klar, dass Menschen, die gesündigt und Schuld auf sich geladen haben und dem Gericht Gottes entgegengehen, umsonst gerechtfertigt werden können. Der Mensch kann für das Heil nichts bezahlen. Ein anderer hat bezahlt: Jesus Christus. Er hat das Sühnmittel gegeben: sein Blut. Wer sich im Glauben auf Jesus Christus und sein Erlösungswerk stützt, wird vor Gott gerechtfertigt. Unendliche Gnade!
Gott hat auch den alttestamentlichen Gläubigen vergeben. Aber Er hat jene Sünden hingehen lassen, denn Er sah das Werk seines Sohnes voraus. Die Sühnung jener Sünden geschah erst in den drei Stunden der Finsternis am Kreuz. Wie umfassend ist doch das Erlösungswerk unseres Heilands!
Aus Glauben gerechtfertigt
«Wo ist nun der Ruhm?» Der Apostel stellt diese Frage, weil es ein tief verwurzeltes Problem des Menschen ist, dass er geehrt werden will. Darum meint er auch, durch seine guten Taten Anerkennung bei Gott zu finden. Wie viele Menschen denken, Gott würde ihr Leben anhand einer Waage beurteilen. Auf die eine Schale lege Er die Sünden, auf die andere ihre vermeintlich guten Werke. Sie hoffen, die guten Werke würden die Sünden aufwiegen. Aber Gott benutzt in dieser Hinsicht keine Waage, denn 10 000 gute Werke eines Menschen nehmen nicht eine einzige Sünde weg. Der sündige Mensch kann nur durch das «Gesetz des Glaubens» vor Gott gerechtfertigt werden, d.h. indem er sich im Glauben auf das Erlösungswerk und den Erlöser stützt. Dabei fällt alle Ehre Gott zu. Da bleibt nicht der geringste Ruhm für den Menschen.
Wie herrlich ist die Botschaft der Verse 29 und 30! Gott ist der Gott aller Menschen. Das Angebot der Rechtfertigung gilt für religiöse und gottlose Menschen. Man kann sie aber nur durch den Glauben erlangen. Beim religiösen Menschen heisst es: «gerechtfertigt aus Glauben», im Gegensatz zu den menschlichen Anstrengungen. Beim gottlosen Menschen wird der Ausdruck «gerechtfertigt durch Glauben» benutzt, im Gegensatz zu einem anständigen Leben ohne Gott.
Durch den Glauben wird das Gesetz in keiner Weise aufgehoben. Es bleibt als Anzeiger für das, was Sünde in Gottes Augen ist, bestehen. Das ist der Nutzen des Gesetzes (Römer 7,7).
Keine Rechtfertigung aus Werken
In diesem Kapitel wird von Abraham und David gesprochen, die bereits zur Zeit des Alten Testaments Rechtfertigung und Vergebung durch den Glauben an die Gnade und Allmacht Gottes erlangten. Paulus spricht von Abraham als «unserem Vater». Dieser Patriarch ist eine wichtige Person für die Menschen aus dem Volk Israel, aber auch für uns, die Glaubenden der Zeit der Gnade.
Abraham ist nicht aufgrund seiner Taten gerechtfertigt worden. Nein, er glaubte Gott aufs Wort und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wer sein Heil selbst erwirken will, dem sagt Gott, was er schuldig ist. Doch keiner kann es bezahlen. Wer aber nicht wirkt, sondern sich im Glauben auf das vollbrachte Erlösungswerk stützt, bekommt die Rechtfertigung geschenkt. Wie wunderbar! Auch David hat ohne Werke Vergebung empfangen und ist glücklich geworden.
Keine Rechtfertigung durch das Gesetz
Die Juden sind stolz auf ihre Abstammung von Abraham. Er ist tatsächlich ihr Stammvater. Aber er glaubte, bevor er beschnitten wurde. Darum ist er der Vater aller Glaubenden, die abstammungsmässig nicht zum Volk Israel gehören. Das Glück der Rechtfertigung empfängt auch der Glaubende mit nichtjüdischer Herkunft.
Abraham bekam nachher das Siegel der Beschneidung als Bestätigung seines Glaubens. Darum ist er auch der Vater der Glaubenden mit jüdischem, religiösem Hintergrund. Das Glück der Rechtfertigung gilt auch den Glaubenden, die äusserlich zum Volk Israel gehören.
Die Verheissung im Blick auf das Erbe bedeutet Gottes Versprechen für die Zukunft der Glaubenden. Er hat uns tatsächlich Herrliches versprochen. Aber dieses zukünftige Teil bekommen wir nicht durch das Gesetz. Weil niemand das Gesetz halten kann, bewirkt es Zorn, d.h. göttliche Verurteilung am grossen weissen Thron und eine Zukunft im Feuersee. Nein, unser Erbe ist aus Glauben und nach Gnade. Wir glauben das, was Gott uns verheissen hat, und Er schenkt uns das Erbe aus Gnade.
Die Auferstehungsmacht Gottes
Gott bringt Leben aus dem Tod hervor. Abraham hatte die Verheissung Gottes, dass er und Sara einen Sohn bekommen würden. Aber beide waren biologisch gesehen zu alt, um Kinder zu bekommen. Doch der Glaube Abrahams war so stark, dass er Gott und seinem Wort vertraute, obwohl es keine Hoffnung mehr gab. Er wusste, dass Gott nicht nur mächtig, sondern allmächtig ist. Er vertraute dem Allmächtigen und kam dadurch im Blick auf die Verheissung zu einer «vollen Gewissheit». Diesen Glauben hat Gott bestätigt und es ihm als Gerechtigkeit angerechnet.
Dies alles aber steht nicht nur wegen Abraham in der Bibel. Es ist auch für uns geschrieben. Wir glauben wie Abraham, dass Gott aus dem Tod Leben hervorbringen kann. Er bewies es in der Auferweckung des Herrn Jesus. Christus ist aus den Toten auferstanden. Am Kreuz hat Er die Strafe für unsere Sünden erduldet und ist gestorben. Das ist die Grundlage unserer Rechtfertigung. Aber der Segen der Rechtfertigung fliesst uns durch den Auferstandenen zu.
Frieden mit Gott
Nachdem die Rechtfertigung aus Glauben als Antwort auf das Problem unserer Sünden vorgestellt wurde, folgt ein Lobpreis. In diesen Versen heisst es dreimal, dass wir uns rühmen. Wir rühmen uns in der Hoffnung (Römer 5,1.2), in der Trübsal (Römer 5,3-10) und wir rühmen uns Gottes (Vers 11).
In den Versen 1 und 2 geht es um unsere Vergangenheit, um die Gegenwart und um unsere Zukunft. Unsere Vergangenheit als Glaubende ist mit Gott geordnet. Wir sind gerechtfertigt und haben Frieden mit Ihm. Jetzt in der Gegenwart haben wir freien Zugang zu Gott. Wir stehen in seiner Gunst. So dürfen wir in jeder Lage zu Ihm kommen – auch dann, wenn wir in Sünde gefallen sind. Unsere Zukunft ist völlig gesichert. Wir werden in seine Herrlichkeit eingehen.
Die Trübsale umfassen alle Prüfungen, die Gott auf unseren Lebensweg legt. Dadurch möchte Er etwas in unserem Leben erreichen. Wir sollen in der Not bei Gott ausharren, in den Übungen Erfahrungen mit Ihm machen und unser ganzes Vertrauen auf Ihn setzen. Es ist gut, wenn wir in schweren Tagen an die Liebe Gottes und an unseren Erlöser denken, wie Er am Kreuz für uns gestorben ist, als wir noch ohne Gott in der Sünde lebten. Die Beschäftigung mit der Liebe Gottes wird unsere Herzen auch in der Trübsal froh machen.
In Vers 11 rühmen wir Gott, den Geber von allem, was uns Gläubigen geschenkt ist. Der Geber ist grösser als die Gabe. Wir sind nicht nur glücklich bei Gott, weil Er uns so viel gibt, sondern weil Er ein so wunderbarer, gnädiger und liebender Gott ist.
Die Stellung von Gerechten
Jetzt behandelt der Apostel das Problem der Erbsünde. Und die Lösung? Es ist der Tod des Herrn Jesus. Beim Problem der Sünden stand sein Blut als Lösung vor uns (Römer 3,25; Hebräer 9,22).
Fast in jedem Vers dieses Abschnitts gibt es eine Gegenüberstellung. Es geht um zwei Gruppen oder Familien von Menschen. Beide haben ein Oberhaupt und beide Anführer haben eine Tat vollbracht, die für ihre Familie ein weitreichendes Ergebnis zur Folge hat.
Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und damit der Tod. Jedes Baby, das geboren wird, gehört zur Familie von Adam und trägt bereits den Keim des Todes in sich. Es hat die Erbsünde in sich.
Im Kontrast zu Adam wird in diesen Versen Jesus Christus vorgestellt als das Haupt einer anderen Gruppe oder Familie. Es sind alle Glaubenden. Sie kommen in den Genuss von dem, was Christus am Kreuz vollbracht hat. Ihnen ist die Gnade zuteil geworden.
In Vers 18 wird sowohl im Blick auf Adam als auch auf Christus von allen Menschen gesprochen. Es geht um die Zielrichtung. Aufgrund des Todes von Jesus Christus können alle die Rechtfertigung des Lebens bekommen. Aber nur die, die an Ihn und seinen Opfertod glauben, empfangen dieses Geschenk wirklich.
In Vers 19 ist von unserer Stellung als Gläubige die Rede. Wir haben sie bekommen, weil der Herr Jesus bis in den Tod am Kreuz gehorsam war. Möchten wir mehr die wunderbare Gnade rühmen, die uns zum ewigen Leben geführt hat!
Frei von der Sünde
In diesem Kapitel werden wir belehrt, dass wir als Gläubige nicht mehr sündigen müssen, obwohl wir die Erbsünde, dieses böse Prinzip, noch in uns haben. Wie geht das? Wir sind mit Jesus Christus der Sünde gestorben, d.h. Gott rechnet uns den Tod unseres Erlösers an, durch den wir von der Macht der Sünde befreit worden sind. Da wir aber noch sündigen können, helfen uns diese Verse, täglich frei von der Sünde zu leben.
Das Kapitel beginnt mit der rhetorischen Frage: Sollen wir weiter den Begierden der in uns wohnenden Sünde nachgeben und sündigen? Nein, niemals. Wir sind doch der Sünde gestorben. In der Taufe haben wir bezeugt, dass wir gestorbene Leute sind, die auf die Sünde nicht mehr reagieren wollen. Vielmehr möchten wir mit dem Herrn Jesus ein neues Leben führen.
Vor unserer Bekehrung wurden wir von der Sünde beherrscht. Das war «unser alter Mensch». Seitdem wir geglaubt haben, betrachtet Gott diesen alten Menschen als mit Christus gekreuzigt. Am Kreuz hat Er mit ihm abgerechnet, und zwar in der Person unseres Stellvertreters. Nun dürfen wir als solche leben, die der Sünde gegenüber tot sind. Wir reagieren nicht mehr auf ihre Begierden. Wir müssen nicht mehr sündigen. Möchten wir dies Tag für Tag verwirklichen!
Gott zur Verfügung stehen
Vers 8 schaut in die Zukunft. Einst werden wir das Auferstehungsleben fern von Sünde und Tod mit dem Herrn Jesus teilen. Darum sollten wir bestrebt sein, jetzt schon durch Gottes Gnade ein reines, sündloses Leben zu führen (Vers 11).
Vers 12 schliesst direkt an die Ausführungen in den Versen 5-11 an. Gott fordert uns mit Bestimmtheit auf, der Sünde nicht nachzugeben. Wir sollen auch unsere Glieder – Mund, Hände, Füsse – nicht in den Dienst der in uns wohnenden Sünde stellen, sondern uns mit allem, was wir sind, Gott zur Verfügung stellen. Das wird zu einem glücklichen Leben der Freiheit, aber auch der Dankbarkeit für die erfahrene Gnade führen.
Gehorsam, Gerechtigkeit, Heiligkeit
In Vers 15 folgt die zweite rhetorische Frage. Das Gesetz sagt klar, was Sünde ist. Und die Gnade? Ist das Sündigen unter der Gnade weniger schlimm? Niemals! Das Bewusstsein der Gnade führt uns dahin, es mit der Sünde noch ernster zu nehmen.
Zum besseren Verständnis gebraucht der Apostel zweimal das Beispiel der Sklaverei:
- Vor unserer Bekehrung waren wir Sklaven der Sünde, der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit. Wir mussten sündigen, wir wurden von unreinen Begierden getrieben und sündigten, wir handelten eigenwillig.
- Jetzt hat sich das geändert. Wir wünschen nun aus Liebe zum Herrn, Gott in allem zu gehorchen. Wir sind Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Als solche sind wir fähig, ein Leben zu führen, das in Übereinstimmung mit Gott ist. Ja, wir sind Gott zu Sklaven geworden. Das bedeutet: Als Erlöste sind wir Ihm von Herzen gehorsam. Die Frucht eines solchen Lebens ist praktische Heiligung (konsequente Trennung von allem Bösen und Hingabe an Gott) und das Ende davon ewiges Leben.
Frei vom Gesetz
Nun zeigt der Apostel, wie der Gläubige vom Gesetz (vor allem den zehn Geboten) befreit ist. Er muss es nicht erfüllen, um zu Gott zu kommen. Er hat ja durch den Glauben an den Erlöser bereits Frieden mit Gott und steht in seiner Gunst. Das Gesetz ist auch nicht seine Lebensregel. Jesus Christus ist der Massstab für sein Verhalten.
Anhand des Ehegesetzes erklärt Paulus, wie der Gläubige vom Gesetz befreit ist. Wenn der Ehemann einer Frau gestorben ist, ist sie frei, sich mit einem anderen Mann zu verheiraten. In der Anwendung auf die Gläubigen dreht Paulus die Sache um. Nicht das Gesetz ist gestorben, sondern wir, die wir uns bekehrt haben. Dies geschah durch den Leib des Christus, denn Gott sieht uns im Tod von Christus ebenfalls als gestorben an. Dadurch sind wir frei vom Gesetz. Ein Toter steht nicht mehr unter den Forderungen des Gesetzes.
Als Gläubige sind wir mit dem auferstandenen Herrn verbunden. In dieser neuen Beziehung können wir Gott Frucht bringen, d.h. für Ihn leben (Vers 4).
Dass wir vom Gesetz losgemacht sind, ist auch für unser tägliches Glaubensleben wichtig. Wir möchten gern Gottes Willen tun, Ihm dienen. Aber wir tun dies nicht, indem wir das Gesetz zu unserer Lebensregel machen (das Alte des Buchstabens). Nein, wir dienen im «Neuen des Geistes», d.h. in der Verbindung, die wir jetzt zu Christus haben. Unser Leben richtet sich nach Ihm aus. Ihm möchten wir so viel wie möglich gefallen.
Das Gesetz ist gut, die Sünde ist böse
In diesen Versen wird der Nutzen des Gesetzes (der Gebote) aufgezeigt: Durch das Gesetz erkennt der Mensch, was Sünde in den Augen Gottes ist. Wenn wir an die zehn Gebote denken, müssen wir sagen: Sie sind gut, denn sie kommen von Gott. Das Problem liegt bei uns Menschen, und zwar in verschiedener Hinsicht:
Anhand des Gesetzes erkennen wir, was Sünde ist. Darum hat das Gesetz auch in unserer Zeit seine Bedeutung. Das ist das Erste.
Sobald jedoch ein Verbot vorliegt, regt sich in uns die Begierde, das Unerlaubte erst recht zu tun (Vers 8). Diese Erfahrung macht jeder, der Kinder hat und sie erzieht: Verbote reizen zum Ungehorsam.
Und wenn jemand sich aufrichtig Mühe gibt, die Gebote zu halten? Aus eigener Anstrengung wird er es nicht schaffen, immer alle Gebote zu erfüllen. Darum erweist sich das Gebot, das zum Leben gegeben war, zum Tod (Vers 10).
Aber worin besteht der in Vers 11 erwähnte Betrug? Die in uns wohnende Sünde sagt: Du kannst das Gesetz erfüllen, du musst dich nur anstrengen und an dir arbeiten. Aber das ist ein Betrug. Wir erfahren bald, dass wir es nicht schaffen. Da nützen auch alle guten Vorsätze nichts.
Die Verse 12 und 13 fassen die Resultate zusammen: Durch das Gesetz kommt die Sünde in ihrer ganzen Verdorbenheit ans Licht. Und diese im Menschen wohnende Sünde führt zu dem hoffnungslos toten Zustand, in dem sich jeder Ungläubige befindet – ob er es wahr haben will oder nicht.
Befreiung durch Jesus Christus
Ab Vers 14 spricht nun ein bekehrter Mensch. Weil es eine Kehrtwendung in seinem Leben gab, möchte er nun ein Leben führen, das Gott gefällt. Doch er versucht es aus eigener Kraft und kommt zur Einsicht: Das schaffe ich nicht. Er stellt dabei Folgendes fest:
- Das Gesetz ist gut, der Mensch aber schlecht (Vers 14).
- Der Mensch ist ein Sklave der Sünde. Er will das Gute tun, aber er hat keine Kraft dazu. Die in ihm wohnende Sünde führt ihn dahin, das Böse zu tun, obwohl er das Gute zu tun wünscht.
- Als bekehrter Mensch lernt er zwischen seiner Persönlichkeit und der in ihm wohnenden Sünde zu unterscheiden (Vers 17).
- Durch die Erbsünde, die stärker als sein Wille ist, wird ihm klar, dass nichts Gutes in ihm wohnt.
Die Verse 19-21 zeigen, dass es sich um einen bekehrten Menschen handelt. Denn nur jemand, der neues Leben hat, will Gott gefallen und das tun, was vor Gott recht ist. Aber die Kraft der Sünde in ihm ist stärker als der Wunsch, zur Freude Gottes zu leben. Wie kommt man aus einem solchen Elend heraus? Die Hilfe muss von aussen kommen.
Zu diesem Ergebnis gelangt dieser Mensch in Römer 7. Nun hört er auf, sich selbst helfen zu wollen und sucht die Hilfe bei Gott. Er dankt Ihm dafür, dass der Herr Jesus auch für dieses Problem die Lösung ist (siehe Römer 8). Doch er weiss jetzt auch, dass er zwei Naturen hat: die alte, unverbesserliche, und die neue, von Gott geschenkte.
Eckpunkte der Befreiung
Am Ende von Kapitel 7 hat der bekehrte Mensch von sich weg auf den Herrn Jesus geblickt. Jetzt wird gesagt, dass es für den Glaubenden keine Verdammnis mehr gibt, obwohl die Sünde noch in ihm ist. Wie kommt es zu einer Befreiung von der Gesetzmässigkeit der Sünde und des Todes, die wir in Römer 7 sahen? Durch den Herrn Jesus, der das Urteil über die Sünde damals am Kreuz auf sich genommen hat und gestorben ist. Er starb für das, was wir von Natur sind. Uns Glaubenden hat Gott ein neues Leben geschenkt. Zudem haben wir den Heiligen Geist empfangen, der die Kraft für dieses Leben ist.
Nun liegt es an uns, die wir an den Herrn Jesus glauben, in der Kraft des Heiligen Geistes ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Das ist ein Wandel nach dem Geist (Vers 4).
Buchtipp: Leben in Freiheit
In der Freiheit leben
Da wir neben dem neuen Leben noch die alte Natur haben, besteht die Gefahr, dass wir der Sünde in uns nachgeben. Dann leben wir nach dem Fleisch (Vers 5) und das ist zur Unehre des Herrn.
In Vers 9 spricht der Apostel die Glaubenden an. Weil der Geist Gottes in jedem Gläubigen wohnt, sollte dies auch im praktischen Leben sichtbar werden. Wie? Indem durch das Wirken des in uns wohnenden Heiligen Geistes die Wesenszüge des Herrn Jesus an uns gesehen werden. Dann ist Christus in uns, wie Vers 10 es sagt. Und einmal wird auch unser sterblicher Körper, in dem jetzt noch die Sünde ist, lebendig gemacht, d.h. erlöst. Garantie dafür ist der Heilige Geist in uns.
Schuldner, Söhne, Kinder, Erben
Gott möchte nicht, dass die Gläubigen wieder der Sünde, die in ihnen wohnt, nachgeben. Wir sollen nicht nach dem Fleisch leben, denn dadurch kommen wir auf einen Weg des Todes, obwohl wir wissen, dass kein Gläubiger sein Heil wieder verlieren kann. Aber Gott redet ernst, wenn es um die Sünde im Leben seiner Kinder geht.
Gott wünscht von all den Seinen, dass sie im Geist leben, dass sie sich mit Christus beschäftigen, damit Er ihr Herz und Leben praktisch erfüllen kann. Dadurch, dass der Geist Gottes in uns wohnt und dieser uns leitet, sind wir Söhne Gottes geworden. Wir sind von Ihm als Söhne angenommen. Welch eine grossartige Tatsache! Wir dürfen freimütig und mit frohem Zutrauen «Abba, Vater» zu Gott sagen. Was sind wir doch für bevorrechtete Menschen!
In Vers 16 werden wir als Kinder bezeichnet. Kinder Gottes sind wir durch die Neugeburt geworden. Wir sind in die Familie Gottes hineingeboren worden. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, lässt uns dies auch empfinden. Er gibt uns durch die Aussagen der Bibel die Gewissheit, dass wir jetzt schon Kinder des himmlischen Vaters sind. Wir dürfen seine Liebe erfahren und geniessen.
Als Kinder sind wir auch Erben. Der Augenblick wird kommen, da der Herr Jesus, der Erstgeborene vieler Brüder, der Haupterbe, seine Herrschaft über das Universum antreten wird. Dann werden wir mit Ihm erben.
Die Erlösung des Körpers
Im Anschluss an Vers 17 kommt der Apostel nun auf die Leiden zu sprechen, die jetzt das Teil der Glaubenden sind, denn unser Körper ist noch nicht erlöst. Er gehört zur ersten Schöpfung, die durch den Sündenfall Adams unter den Fluch gekommen ist und immer noch seufzt. Aber wir haben eine Hoffnung. Darum harren wir in den Leiden aus.
In dieser Zeit des Wartens freuen wir uns auf die Erlösung unseres Körpers. Sie ist eine sichere Sache, obwohl bei unserer Bekehrung erst die Seele errettet wurde. Seither sind wir unterwegs zum himmlischen Ziel, das wir noch nicht erreicht haben. Daher der Ausdruck «in Hoffnung errettet».
Nach Vorsatz berufen
Bis sich die Hoffnung der Erlösung unseres Körpers erfüllt, seufzen wir nicht nur, wir haben auch das Vorrecht und die Möglichkeit des Gebets. Aber oft wissen wir nicht, wie wir beten sollen, was vor Gott recht ist. Da kommt uns der Heilige Geist zu Hilfe (Vers 26). Doch eins dürfen wir wissen: Alles, was uns begegnet, wirkt zum Guten mit. Dafür ist Gott besorgt.
In den Versen 29 und 30 stellt der Apostel den Vorsatz Gottes mit uns Glaubenden vor. Diesen zu kennen, bedeutet eine grosse Ermunterung auf dem Glaubensweg. In der Ewigkeit hat Gott an jeden Einzelnen gedacht, der in der Zeit der Gnade an den Herrn Jesus glauben würde. Dabei hat Er ein Ziel mit uns (Vers 29). In der Zeit hat Er dafür gesorgt, dass wir das Evangelium hörten und uns bekehrten. Jetzt steht noch das Letzte aus: Wir sollen verherrlicht werden, d.h. ans Ziel kommen. Gott selbst garantiert, dass jeder Glaubende den Himmel erreicht.
Gott ist für uns
Nachdem der Apostel in den zurückliegenden Kapiteln das grosse Heil Gottes für die Menschen in seinem ganzen Ausmass vorgestellt hat, ist er selbst überwältigt. Das zeigen uns die Fragen, die aus dem dankbaren Herzen des Apostels kommen.
Wenn Gott, der Höchste, für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Niemand! Der beste Beweis, dass Gott für uns ist, ist die Gabe seines Sohnes. Ihn hat Er als Mensch auf die Erde, ans Kreuz, in die drei Stunden der Finsternis und in den Tod gegeben! Mit Ihm schenkt Er uns alles.
Der Feind versucht immer wieder, glaubende Menschen zu verunsichern und ihre Heilsgewissheit zu erschüttern. Aber niemand – auch Satan nicht – kann uns vor Gott anklagen oder sogar mit der Verdammnis drohen. Gott selbst verteidigt die Seinen.
Und wie ist es mit den Lebensproblemen, die uns oft grosse Mühe bereiten? Müssen wir in den Schwierigkeiten des Lebens verzweifeln? Nein! Der Herr Jesus verwendet sich für uns. Er bemüht sich um uns, dass wir nicht untergehen. In allen Lebenslagen dürfen wir wissen: Jesus Christus im Himmel liebt uns und will uns vom Himmel her helfen.
Wie können wir mehr als Überwinder sein? Indem wir zurück nach Golgatha ans Kreuz blicken. Dort wurde die Liebe Gottes zu uns völlig offenbart. Dort hat der Herr Jesus ein vollgültiges Erlösungswerk vollbracht. Darauf dürfen wir uns in jeder Lebenslage stützen und in der Liebe Gottes ruhen.
Israel hat grosse Vorrechte
Die Kapitel 9 – 11 bilden einen besonderen Abschnitt im Römer-Brief. Darin wird die Frage behandelt, was mit den speziellen Verheissungen Gottes an das Volk Israel geschieht. Welchen Platz nehmen sie neben den göttlichen Heilsplänen mit allen Menschen, inklusive die Juden, ein?
Der Apostel Paulus beginnt seine Ausführungen zu diesem Thema, indem er seine Liebe zu seinen Landsleuten hervorhebt. In seinen Zuneigungen zu ihnen war er aber doch sehr traurig, denn er dachte an das, was die Führer der Juden getan hatten. Sie haben ihren Messias abgelehnt und gekreuzigt. Sie haben nach der Auferstehung und Himmelfahrt von Christus auch das Zeugnis des Heiligen Geistes abgelehnt. Am liebsten hätte der Apostel auf sein Heil in Christus verzichtet, wenn er den Israeliten damit hätte helfen können. Aber kein Mensch kann für einen anderen die Schuld auf sich nehmen.
In den Versen 4 und 5 zählt der Apostel einige der Vorrechte auf, die dieses Volk von Gott empfangen hatte. Gott bezeichnet Israel als seinen Sohn (2. Mose 4,22.23). In der Wolke der Herrlichkeit machte Gott seine Gegenwart bei diesem Volk sichtbar. Er schloss Bündnisse mit ihnen, gab ihnen sein Gesetz und verordnete in der Stiftshütte den Gottesdienst nach seinen Gedanken. In Abraham, ihrem Stammvater, besassen sie bedingungslose Verheissungen. Aber das grösste Vorrecht war, dass Christus als Mensch von diesem Volk abstammte. Gleichzeitig war Er aber ewiger Gott. Er ist beides: wahrer Mensch und ewiger Gott.
Gott handelt souverän
Nun kommt der Apostel auf die Souveränität Gottes zu sprechen. Wenn Er etwas tut, ist Er niemand dafür verantwortlich. Er handelt nach seinem Willen und entsprechend seinem Wesen. Das musste das Volk Israel, das so stolz auf seine Vorrechte ist, verstehen lernen.
Zuerst wird anhand der zwei Söhne Abrahams und der Zwillingssöhne Isaaks und Rebekkas gezeigt, dass der Segen Gottes nur den Nachkommen zukam, die Gott in seiner souveränen Gnade ausgewählt hatte: Isaak und Jakob.
Bei Jakob und Esau kommt nicht nur die Souveränität Gottes zum Ausdruck, da wird auch klar, dass der Mensch für sein Tun verantwortlich ist. Bevor die Zwillinge geboren waren, traf Gott eine freie Wahl: «Der Grössere wird dem Kleineren dienen.» Der souveräne Gott legte die Rangordnung fest. Viele Jahre nachdem die beiden gelebt hatten und gestorben waren, sagte Gott: «Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst» (Maleachi 1,2.3). Gott hat Jakob aus Gnade geliebt, aber Er hat Esau auf Grund seines Verhaltens gehasst. Er war ein Ungöttlicher und hat das Erstgeburtsrecht verachtet (Hebräer 12,16).
Es stellt sich nun die Frage, ob Gott in seinem souveränen Handeln ungerecht ist. Er ist es nicht. Im Blick auf Israel handelte Er in Gnade, obwohl das Volk das Gericht verdient hatte (Römer 9,15.16). Im Blick auf den Pharao handelte Er gerecht. Erst nachdem dieser Herrscher mehrmals sein Herz gegenüber Gott verhärtet hatte, folgte das göttliche Gericht der Verhärtung.
Gott wartet lange, bis Er richtet
Immer wieder getraut sich der Mensch, Gott zu kritisieren oder gegen Ihn zu reden. Da muss der Apostel klarstellen, wie klein wir Menschen und wie erhaben Gott ist. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Der Töpfer kann ein Gefäss nach seinem Gutdünken machen, er muss nicht zuerst den Ton fragen.
Wenn der inspirierte Schreiber auf die Gefässe des Zorns und die Gefässe der Begnadigung zu sprechen kommt, werden zwei Punkte klar: Die Gefässe des Zorns (die gottlosen Menschen) sind nicht von vornherein zum Verderben bestimmt. Sie ziehen sich durch ihren Ungehorsam und ihre Auflehnung gegen Gott selbst das Gericht zu. Die Gefässe der Begnadigung sind alles Erlöste. Gott hat sie begnadigt, obwohl sie das Gericht verdient hatten. Alles ist geschenkt.
Die Verse 24-26 beschreiben die Zeit, in der wir leben. Da gibt es Menschen aus den Juden und aus den Nationen, die die Gnade Gottes erfahren. Beide werden auf den Boden des christlichen Glaubens gestellt.
Die Verse 27-29 beschreiben die zukünftige Drangsalszeit, in der ein Überrest aus Israel gerettet und von Gott wieder als sein irdisches Volk anerkannt wird. Er wird diese schlimme Zeit abkürzen, weil sonst kein Einziger überleben und in das Tausendjährige Reich eingehen würde. – In den Schlussversen wird deutlich, dass Gott das Volk Israel als Nation verworfen hat. Sie haben das Gesetz nicht gehalten, obwohl sie meinten, auf diesem Weg Gott zu gefallen, und sie haben Christus, den Stein in Zion, gekreuzigt. Nur der Einzelne, der an Christus glaubt, wird gerettet.
Rettung nur durch Glauben
Welch eine Liebe des Apostels zu den Israeliten! (Vers 1). Es ist der Wunsch seines Herzens, dass sie errettet werden. Warum? Weil sie verloren sind. Nur Abgeirrte und Verlorene haben Errettung nötig.
Leider versuchen sie – und dies mit grossem Eifer – auf einem falschen Weg, vor Gott gerecht zu werden: durch die Erfüllung des Gesetzes. Aber wegen der im Menschen wohnenden Sünde gelingt es niemand – auch den Juden nicht –, das Gesetz immer und in allem zu halten. Sie hätten erkennen sollen, dass Christus das Ende des Gesetzes ist, d.h. dass die Epoche zu Ende ist, in der das Gesetz das Mittel war, um vor Gott gerecht zu werden. Und sie hätten an den Herrn Jesus glauben sollen. Doch das wollten sie nicht (Vers 3).
Jetzt ist Jesus Christus und der Glaube an Ihn der Weg zu Gott. Um diese Rettung zu erlangen, sind keine Anstrengungen des Menschen nötig (Römer 10,6.7). Der Retter ist zu uns gekommen und am Kreuz für uns gestorben. Seine Auferstehung ist der Beweis für die Vollgültigkeit seines Erlösungswerks. Der Mensch, der gerettet werden will, muss nur eines tun: mit dem Mund Jesus als Herrn bekennen (sich Ihm und seinem Urteil unterordnen) und im Herzen an Ihn und sein vollbrachtes Erlösungswerk glauben.
Die Verse 11-13 enthalten eine wunderbare Botschaft. Jeder ist angesprochen. Jeder hat die gleiche Möglichkeit. Jeder kann errettet werden. Der Heiland ist reich für alle, die Ihn anrufen. Aber diesen Schritt – zu Ihm kommen – muss der Mensch tun.
Verkündigung und Unglaube
Ab Vers 14 geht es um die Verkündigung der herrlichen Botschaft des Evangeliums (Römer 10,11-13). Der Weg zur Errettung ist wirklich einfach. Doch wie sollen Menschen davon wissen, wenn es ihnen nicht erzählt wird? Sie können doch erst glauben, wenn sie die Botschaft gehört haben.
Damit ein Verkündiger des Evangeliums seine Aufgabe wirklich erfüllen kann, muss er vom Herrn gesandt sein (Vers 15). Dabei wird er die traurige Erfahrung machen, dass nicht alle das Evangelium annehmen. Manche lehnen Gottes Botschaft ab (Vers 16).
Vers 17 stellt einen allgemeinen Grundsatz vor: Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aber diese muss das Wort Gottes zur Grundlage haben.
Gott spricht die Menschen nicht nur durch das verkündete Evangelium an. Er benutzt dazu auch die Schöpfung. Er hat verschiedene Mittel, um die Menschen aufzurütteln. Keiner kann sich entschuldigen, alle können gerettet werden, wenn sie nur wollen (Vers 18).
Die Verse 19-21 beziehen sich auf die Zeit, in der wir leben. Weil das Volk Israel auf die Geduld Gottes mit Ungehorsam und Widerspruch geantwortet hat, hat Er sich von ihm als Nation abgewendet. Israel ist zur Zeit nicht ein Volk mit besonderen Vorrechten. Stattdessen richtet Gott sein Evangelium an alle Menschen. Das gilt sogar für die Einzelnen aus Israel, die sich von Gottes Liebe zum Heiland ziehen lassen.
Nicht für immer verworfen
Der inspirierte Schreiber belegt seine Ausführungen über das Volk Israel in den Kapiteln 9 – 11 mit sehr vielen Bibelstellen aus dem Alten Testament. Das fällt auch in den vorliegenden Versen auf.
Gott hat sein irdisches Volk nicht völlig verstossen. Auch in der Zeit der Gnade rettet Er Einzelne aus diesem Volk. Paulus selbst ist dafür der schlagendste Beweis. So wie es zur Zeit des Propheten Elia einen Überrest nach Auswahl der Gnade gab, so gibt es ihn auch heute (Vers 5). Aber jeder Erlöste aus Israel kann nur aus Gnade, ohne irgendetwas selbst tun zu können, errettet werden (Vers 6).
In Vers 7 haben wir drei Unterscheidungen in Israel:
- Israel als Volk erlangte Gottes Gunst nicht, weil es den Messias verwarf.
- Die Auserwählten sind von Gott angenommen, denn sie haben sich vor Ihm gebeugt und an Jesus Christus geglaubt.
- Die Übrigen sind bis heute verstockt, denn sie lehnen Jesus Christus als ihren Messias ab. Sie verharren im Unglauben.
Als Folge ihres Unglaubens sind die Übrigen «verhärtet worden», d.h. das göttliche Gericht der Verhärtung kam über sie. Das wird durch drei Zitate aus dem Alten Testament belegt, und zwar je eine Stelle aus den Büchern Mose (5. Mose 29,3), den Psalmen (Psalm 69,23.24) und den Propheten (Jesaja 29,10). Alle drei grossen Teile des Alten Testaments dokumentieren dieses ernste göttliche Gericht.
Der Ölbaum
In Vers 11 geht es um die Frage, ob das Volk Israel für immer zu Fall gekommen ist. Nein, nur für eine bestimmte Zeit. Weil die Menschen aus Israel Jesus Christus verworfen haben, haben sie ihre besondere Stellung als Volk Gottes verloren. Ihr Fall bringt den anderen Nationen einen grossen Reichtum. Ihnen wird jetzt durch das Evangelium uneingeschränkt und direkt die Gnade Gottes zur Errettung angeboten. Doch die Zeit wird kommen, da Gott den gläubigen Überrest des Volkes Israel in den Segen des Tausendjährigen Reiches einführt. Dann werden die Nationen wieder von Israel profitieren. Davon reden die Verse 12 und 15.
Das Bild vom Ölbaum (ab Vers 16) weist auf das Zeugnis Gottes auf der Erde und den damit verbundenen Segen hin. Abraham, dem Gott Verheissungen gab und den Er aus der Welt für sich heiligte, ist der Erstling, die Wurzel dieses Baums. Nach der Verwerfung von Jesus Christus wurde Israel als Gottes Zeuge auf der Erde beiseite gesetzt: Einige Zweige sind ausgebrochen worden. Ein wilder Ölbaum wurde eingepfropft. Das Christentum, vorwiegend aus Menschen aus den Nationen, wurde zum Zeugnis Gottes auf der Erde.
Doch das Christentum hat versagt. Darum werden die Warnungen in den Versen 21 und 22 wahr werden. Die eingepfropften Zweige werden wieder ausgebrochen werden. Das Christentum als Zeugnis Gottes wird weggetan werden. In der Zukunft ist es der treue Überrest aus Israel, der erneut das Zeugnis Gottes auf der Erde bilden wird (Israel im Tausendjährigen Reich).
Der Erretter kommt aus Zion
Die «Vollzahl der Nationen» bedeutet die Gesamtheit derer, die in der gegenwärtigen Zeit an den Herrn Jesus glauben. Gott kennt die Gesamtzahl aller Erlösten der Gnadenzeit. Wenn der letzte von ihnen zum Glauben kommt, ist die christliche Zeit abgeschlossen. Dann wendet sich Gott erneut dem Volk Israel zu.
Ganz Israel – repräsentiert durch den zukünftigen Überrest – wird gerettet werden. Dies geschieht durch den Erretter, der aus Zion kommen wird: Jesus Christus. Er wird die Gottlosigkeit Jakobs abwenden und diesen Abfall von Gott heilen.
Auch wenn die Juden gegenüber dem Evangelium der Gnade Gottes heute noch Feinde sind, so wird Gott doch mit ihnen zum Ziel kommen. Er wird seine Verheissungen einlösen. Wie schön ist der Ausdruck: «Sie sind Geliebte, um der Väter willen!» Gott liebt sie, weil Er den Patriarchen Verheissungen gegeben hat. Die Wiederherstellung Israels wird auf der gleichen Grundlage erfolgen, wie wir zum Frieden mit Gott gekommen sind: aus reiner Gnade.
Wenn Paulus das Handeln Gottes mit den Menschen überdenkt – Er bietet das Evangelium der Gnade allen Menschen an und erfüllt alle Verheissungen an Israel –, dann kann er Ihn nur loben und preisen. Voll Bewunderung betrachtet er die Grösse und Erhabenheit Gottes und staunt über seine Wege mit den Menschen. Was Er tut und wie Er handelt, übersteigt unseren Verstand. Ihm gebührt jedes Lob und jede Anbetung, jetzt und ewig.
Für Gott leben und dem Herrn dienen
In diesem und den weiteren Kapiteln des Römer-Briefs finden wir Hinweise für unser tägliches Leben als glaubende Christen. Wie soll unser Dienst für Gott aussehen? Wie sollen wir uns in Ehe und Familie, im Beruf, im Zusammenleben mit anderen Gläubigen und gegenüber Ungläubigen verhalten? Das wird nun gezeigt.
In Vers 1 werden wir zu einem Leben der Hingabe an den Herrn Jesus und der Selbstverleugnung aufgerufen. Wir sollen uns weder äusserlich der Welt anpassen, noch uns innerlich von ihren Ideen beeinflussen lassen. In unserem täglichen Leben sollte nicht die Meinung der Menschen massgebend sein, sondern der Wille Gottes. Er möchte, dass wir die Anweisungen der Bibel befolgen, das tun, was Ihm Freude bereitet, und im rechten Moment das Richtige auf die richtige Weise ausführen.
Nach den Ermahnungen, die für alle gelten, geht es in den Versen 3-8 um den persönlichen Dienst. Der Herr schenkt jedem andere Fähigkeiten und gibt nicht jedem die gleiche Aufgabe. Die Gefahr besteht, dass wir uns überschätzen. Daher die Ermahnung in Vers 3.
Die Gläubigen bilden zusammen eine Einheit: den Leib des Christus. Einzeln sind sie Glieder an diesem Leib und haben unterschiedliche Aufgaben und Funktionen. Eine ganze Reihe von Diensten wird erwähnt. Wenn jeder von uns seine Gabe und damit seinen Auftrag in Weisheit, Rücksicht und Demut ausübt, harmoniert das Ganze. Dann kommen wir einander nicht in die Quere, sondern ergänzen uns. Dazu ist es nötig, dass jeder die entsprechende Ermahnung beherzigt.
Anweisungen für das Glaubensleben
Die Verse 9-11 beschreiben das Verhalten des Gläubigen im Allgemeinen. Als Erstes wird die Liebe erwähnt. Sie soll echt sein. Doch genauso wichtig ist, das Böse im Leben zu verabscheuen und das Gute zu tun. Und bei allem, was wir tun, wollen wir auf den Herrn schauen. Ihm dienen wir! Möge es mit Fleiss und innerer Hingabe (inbrünstig im Geist) geschehen!
Als gläubige Christen kommen wir in ganz unterschiedliche Umstände. Wie wir uns darin verhalten sollen, zeigen die Verse 12-16. In guten Tagen dürfen wir uns freuen, und wenn schwere Tage kommen, wollen wir ausharren und uns nicht gegen Gott auflehnen. Um allem nachzukommen, was in diesen Versen vorgestellt wird, brauchen wir täglich die Hilfe und die Gnade des Herrn. Aus uns selbst schaffen wir es nicht. Denken wir nur an das Mitfreuen, wenn es den anderen gut, uns aber schlecht geht! Auch echtes Mitgefühl mit den Trauernden kann uns nur der Herr schenken.
Die Ermahnungen ab Vers 17 zeigen, dass wir als Gläubige auch Widerstand und Feindschaft erfahren. Wie verhalten wir uns dann? Möchten wir unserem Herrn nachfolgen, der nie Böses mit Bösem vergalt. Ein Christ sollte seinen Mitmenschen jederzeit anständig begegnen und versuchen, mit allen in Frieden zu leben. Und wenn uns jemand anfeindet und uns Böses tut? Dann sollen wir die Sache Gott überlassen und das erlittene Unrecht mit Gutem vergelten. Doch dazu brauchen wir die besondere Hilfe und Gnade des Herrn. Das gilt auch für die Verwirklichung von Vers 21.
Der Christ und die Regierung
In diesen Versen werden wir Christen über unser Verhalten gegenüber der Obrigkeit unterwiesen. Als Christen akzeptieren wir die Regierung auf allen Stufen und unterstellen uns ihrer Ordnung. Denn diese Regierungen sind von Gott verordnet. Widerstand gegen sie und ihre Anordnungen wäre Sünde gegen Gott.
Die Verse 3 und 4 beschreiben die Aufgabe der Regierung. Gott hat sie eingesetzt, um das Böse zu verbieten und zu bestrafen. Wir wollen Gott für die Regierung danken. Gäbe es sie nicht, würde das Faustrecht gelten, der Stärkere würde unbarmherzig über den Schwächeren herrschen. Das Schwert, das die Regierung nicht umsonst trägt, spricht von ihrer Macht, das Recht durchzusetzen und zu kontrollieren.
Weil Gott die Regierung gegeben und mit Vollmacht versehen hat, sollen wir uns ihr unterordnen. Nur wenn sie etwas von uns fordert, das direkt gegen Gottes Willen verstösst, dann gilt Apostelgeschichte 5,29: «Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen.» Das findet aber nur Anwendung, wenn etwas direkt in krassem Widerspruch zum Wort Gottes steht.
Wir gehorchen der Regierung auch wegen unserem Gewissen, denn Ungehorsam gegen die Regierung ist Sünde gegen Gott! Vers 6 macht klar, dass es vor Gott recht ist, wenn wir die Steuern korrekt bezahlen. Ja, Er möchte, dass wir allen Verpflichtungen nachkommen (Vers 7). Und wenn uns von der Regierung Unrecht geschieht? Dann dürfen wir sie darauf aufmerksam machen (vergleiche 1. Mose 21,25; Johannes 18,23).
Einander lieben und anständig leben
«Seid niemand irgendetwas schuldig.» Wir sollen also keine Schulden machen, sondern unsere Rechnungen bezahlen und unseren Schuldigkeiten nachkommen. Aber wir sind schuldig, einander zu lieben: die anderen Gläubigen, die unbekehrten Menschen, den Nächsten. Obwohl wir Christen nicht mehr unter Gesetz stehen, erfüllen wir es, wenn wir anderen Liebe erweisen. Werden wir nicht selbst mit unendlicher Liebe von Gott geliebt? Lasst uns davon reichlich weitergeben!
Seit dem Kreuz und seit der Rückkehr des Herrn in den Himmel ist es in dieser Welt geistlicherweise Nacht. Aber nicht mehr lange. Wir stehen kurz vor dem Tagesanbruch. Wach zu sein, ist die Lebenshaltung des Erlösten, denn er wartet auf den Tag. Die Errettung hier meint, das Kommen des Herrn zur Entrückung. Anschliessend werden wir mit Ihm in Herrlichkeit erscheinen.
Mit jedem Tag kommen wir dieser Errettung näher. Darum wollen wir in der Zeit, in der wir noch hier leben, alles Böse meiden und uns dafür als Kinder des Lichts verhalten. Im Licht des Herrn erkennen wir das Böse und verurteilen es. So ist sein Licht eine Waffe gegen die Werke der Finsternis.
Wir leben noch in der Nacht, gehören aber zum Tag. Das soll sich in unserem Leben zeigen, indem wir mit allem Lichtscheuen nichts zu tun haben. Vielmehr soll an uns das Verhalten des Herrn gesehen werden. Möchten wir sein Reden und Handeln, wie es uns die Evangelien zeigen, nachahmen. Und lasst uns alles meiden, was unsere alte Natur anstachelt (Römer 13,13.14).
Die Schwachen und die Starken
Wenn jetzt bis Römer 15,7 von «Schwachen im Glauben» die Rede ist, dann geht es um Gläubige, die die christliche Freiheit nicht verstanden haben. Das Gegenstück sind die Starken (Römer 15,1). Die Schwachen sind nicht oberflächliche, fleischliche oder weltliche Christen. Es sind Glaubende, die durch Erziehung, Tradition oder Mentalität belastet sind. Ihr Problem ist nicht die Sünde oder die Welt, sondern Essensvorschriften und das Halten von speziellen Tagen. Die Schwachen gilt es zu tragen. Sie sollen wohl in die christliche Gemeinschaft aufgenommen werden. Doch für die Behandlung schwieriger Fragen des Versammlungslebens sollen sie nicht beigezogen werden.
Wo liegen nun die Gefahren für den Schwachen und den Starken? Als Starke sind wir in Gefahr, solche zu verachten, die etwas anders machen als wir. Als Schwache sind wir schnell bereit, in einem Richtgeist den anderen zu verurteilen
In jedem Fall sollten wir bedenken, dass wir alle – ob schwach oder stark – Kinder Gottes sind. Auf christlichem Boden steht keiner über dem anderen. Und jeder von uns ist für sein Tun dem Herrn persönlich verantwortlich. Die Beurteilung können wir getrost dem Herrn überlassen. Sein Entscheid ist massgebend.
Die Verse 9-12 machen klar, dass Gott alles in letzter Instanz beurteilt. Wenn der Herr wirklich die Herrschaft über alle Menschen hat, warum richten oder verachten wir dann andere? Wir sind doch nicht der Herr! Vergessen wir nicht, dass wir einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen!
Die christliche Freiheit richtig gebrauchen
Diese Verse belehren uns – die Schwachen und die Starken –, wie wir im praktischen Leben in Frieden und zum Segen miteinander umgehen können. Einander richten – das ist der Richtgeist der Schwachen. Einander ein Ärgernis geben – das ist die Rücksichtslosigkeit der Starken. Beides sollen wir vermeiden (Vers 13).
In Vers 14 sehen wir, wie der Apostel an der christlichen Freiheit festhält. Die Schwachen dürfen ihre Haltung nicht als einen allgemein gültigen Grundsatz aufstellen. Aber es wird doch vor allem der Starke angesprochen. Es scheint, dass er am meisten zu einem friedlichen Miteinander beitragen kann. Wenn er aber keine Rücksicht nimmt, handelt er nicht nach der Liebe. Doch sie ist das bestimmende Element für das Miteinander der Gläubigen. Und denken wir daran: Auch für den schwachen Bruder ist Christus gestorben. Wie wertvoll ist er Ihm!
In Vers 19 erwähnt der Apostel neben dem Frieden untereinander auch die gegenseitige Erbauung. Wir wollen dies bedenken und die christliche Freiheit nicht so ausleben, dass dabei im schwachen Bruder ein Werk Gottes zerstört wird, sondern Rücksicht nehmen.
Der letzte Vers spricht vom Schwachen. Er isst etwas, weil er gesehen hat, dass der Starke so handelt. Aber er zweifelt und ist unsicher. Er tut dies nicht aus Glauben. Er ist verurteilt, nicht weil er diese Speise isst, sondern weil er nicht aus Glauben handelt. Möge der Herr jeden dahin führen, alles im Leben nur aus Glauben zu tun. Dann sind unser Herz und Gewissen in Ruhe vor Gott.
Die Schönheit der christlichen Freiheit
Diese Verse gehören noch zum Thema von Römer 14. Sie zeigen uns das Verhalten und die Gesinnung des Herrn Jesus, die auch uns im Blick auf die christliche Freiheit prägen soll.
Zunächst werden wir aufgefordert, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Dazu ist Kraft und Geduld nötig. Wir bekommen sie vom Herrn, der diese Gesinnung vollkommen ausgelebt hat. Er dachte nur an die andern. Ihm wollen wir nacheifern und nicht an uns, sondern an den anderen denken und ihm zu helfen suchen. Darin zeigt sich die Schönheit der christlichen Freiheit, wenn wir sie in bestimmten Fällen aus Rücksicht zu Schwachen nicht gebrauchen.
Wie viel können wir von unserem Herrn lernen! Weil Er vollkommen Gott wohlgefällig gelebt hat, wurde Er verachtet und gehasst. Aber gerade die Hinweise im Alten Testament auf Ihn, unseren Herrn, machen uns Mut und helfen uns, auszuharren, wenn wir es in seiner Nachfolge schwer haben und nicht verstanden werden.
Wie schön sind die Titel, die Gott in Vers 5 gegeben werden! Er ist der «Gott des Ausharrens». Wie viel Geduld hat Er mit uns! Und Er ist der «Gott der Ermunterung». Er liebt es, die Glaubenden und besonders die Schwachen zu ermuntern.
Wenn wir «gleich gesinnt sind untereinander», d.h. wenn alle dieselbe Einstellung haben – und zwar die Gesinnung, die Christus entspricht –, dann dürfen wir trotz unserer Unterschiede (Starke, Schwache) gemeinsam und einmütig Gott loben.
Gottes Wirken an allen Menschen
Christus ist zunächst ein Diener der Beschneidung, d.h. die Botschaft des Evangeliums wird zuerst den Menschen aus dem Volk Israel verkündigt. Gott hatte ihren Vorfahren Verheissungen gegeben, und so hatten die Nachkommen der Patriarchen ein gewisses Anrecht auf diese Gnade.
Aber Gott bietet die Errettung, die Jesus Christus am Kreuz erwirkt hat, auch den Menschen anderer Nationalitäten an. Ihnen hatte Gott zwar keine Verheissungen gemacht, aber seine unendliche Gnade ist auch für sie da. Lasst uns Ihm immer wieder dafür danken, dass die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Heiland der Welt, auch uns erreicht hat und wir sie im Glauben annehmen durften!
Obwohl wir im Alten Testament keine Verheissungen für die Nationen finden, zeigen doch verschiedene Stellen, dass Gott die Absicht hatte, auch Menschen, die nicht aus Israel sind, die Errettung anzubieten. Drei solche Stellen werden in den Versen 10-12 zitiert. Wer dieses wunderbare Evangelium angenommen hat, darf fröhlich den Herrn loben und auf Ihn hoffen.
Der Ausdruck «Gott der Hoffnung» erinnert daran, dass wir in Hoffnung errettet sind (Römer 8,24). Die volle Errettung – wenn auch unser Körper inbegriffen ist – erfahren wir erst beim Kommen des Herrn. Im Wissen, was die Zukunft uns bringt, können wir uns freuen und mit innerem Frieden den Glaubensweg gehen.
Paulus und sein Dienst
In diesem Abschnitt erfahren wir einiges über den Dienst des Apostels Paulus. Er spricht in Vers 15 von der «Gnade, die mir von Gott gegeben ist». Damit meint er seine von Gott geschenkte Gabe und die Fähigkeit, seinen Dienst im Werk des Herrn zu tun.
Lasst uns nie vergessen, dass alles, was wir für den Herrn tun können, eine von Ihm geschenkte Gnade ist. Das wird uns helfen, demütig zu bleiben, damit wir uns niemals auf das, was wir tun konnten, etwas einbilden.
Der besondere Dienst des Apostels Paulus betraf die Nationen. Ihnen verkündigte er das Evangelium und unterrichtete sie in der christlichen Wahrheit. Er durfte Menschen aus der Welt heraus zu Gott führen. Sie bilden dieses Opfer, von dem er in Vers 16 schreibt.
Der Apostel hatte seinen ihm übertragenen Dienst treu ausgeführt. Aber er gibt alle Ehre dem Herrn, der durch ihn gewirkt hatte. Was war die Wirkung, die der Herr bei diesen Menschen, die zum Glauben kamen, hervorbrachte? Gehorsam. Sie gehorchten dem Wort Gottes aus Liebe zum Herrn.
Wie weit reichte das Arbeitsfeld des Apostels Paulus! Von Jerusalem bis nach Illyrien! Er hatte das Evangelium Gottes völlig verkündigt. Welch ein grosser Einsatz verbirgt sich hinter dieser Aussage!
Trotzdem blieb noch manches zu tun. Er dachte an Gegenden, wo Christus noch nicht verkündigt worden war, und plante, auch dorthin zu gehen.
Paulus und seine Pläne
Es war der grosse Wunsch des Apostels, die Gläubigen in Rom zu besuchen. Er hatte eine herzliche Liebe zu ihnen und hätte ihnen gern gedient. Wie wichtig ist es doch, dass man die liebt, denen man mit dem Wort dienen möchte!
Weiter teilt Paulus den Gläubigen in Rom seine Pläne mit. Er hatte die Absicht, nach Spanien zu reisen, aber noch keine klare Bestätigung von Gott. Doch er hoffte, wenn es soweit wäre, auf die Unterstützung der Brüder in Rom.
Ab Vers 25 spricht Paulus von seiner bevorstehenden Reise nach Jerusalem. Er wollte dabei eine finanzielle Gabe der Versammlungen in Mazedonien und Achaja den bedürftigen, vermutlich verarmten Gläubigen in Jerusalem überbringen. Aber war es wirklich die Aufgabe des Apostel Paulus materielle Gaben nach Jerusalem zu bringen? Er hatte doch einen speziellen Auftrag an den Menschen aus den Nationen, nicht an den Juden!
Die gläubig Gewordenen aus den Nationen hatten gegenüber den Menschen des Volkes Israel eine gewisse Schuld. Der Herr Jesus stammte aus den Juden. Die Nationen hatten das Evangelium von Jesus Christus als geistliches Gut vom Volk Israel empfangen.
Am Schluss des Kapitels bittet der Apostel um die Fürbitte der Römer. Wie nötig war sie, denn die Feindschaft gegen ihn und was er verkündigte, war gross. Nochmals drückt er seinen Wunsch aus, zu ihnen zu kommen, wenn dies der Wille Gottes sei.
Eine Reihe aufschlussreicher Grüsse
Wir haben in den ersten zwei Versen einen Empfehlungsbrief vor uns. Mit einem solchen Brief wird jemand, der in eine örtliche Versammlung kommt, in der er unbekannt ist, den dortigen Geschwistern als ein Gläubiger zur vollen christlichen Gemeinschaft empfohlen. In diesem Fall konnte der Apostel dieser Schwester ein besonderes Zeugnis ausstellen. Die Gläubigen in Rom sollten sie der Heiligen würdig aufnehmen und ihr uneingeschränkt helfen.
Ab Vers 3 folgt eine Reihe von Grüssen, die uns manches zu sagen haben. Wir können uns fragen: Was hätte der Apostel von uns schreiben können? Doch wir wollen uns auch ermuntern lassen, den hier erwähnten Brüdern und Schwestern nachzueifern.
Wie viel Einsatz und welchen Mut im Werk des Herrn sehen wir bei Priska und Aquila! Sowohl sie als auch andere ermuntern uns, im Werk des Herrn fleissig zu sein und uns zu bewähren. Von nichts kommt nichts.
Bei einigen wird das Haus, d.h. die Familie, erwähnt. Welch eine Gnade, wenn alle, die in einem Haus leben, gläubig sind!
Epänetus wird als der Erstling Asiens für Christus bezeichnet. Er war zeitlich der Erste, der in jener Gegend zum Glauben kam. Dann folgten andere nach. Es braucht Mut, sich als Erster zu bekehren.
Einige werden als Geliebte bezeichnet. Sie waren von Gott geliebt, denn Er liebt alle seine Kinder. Aber vielleicht wird dadurch auch ausgedrückt, dass sie von den anderen Gläubigen besonders geliebt wurden.
Der Feind und das Geheimnis des Christus
Der Apostel Paulus muss auch zur Wachsamkeit vor dem Feind ermahnen. Wenn solche auftreten, die Zwiespalt und Ärgernis unter den Gläubigen anrichten, müssen wir uns von ihnen abwenden. Wer ihnen trotzdem nachgeht und vielleicht meint, einen Hirtendienst an ihnen tun zu können, läuft Gefahr, selbst verführt zu werden.
Wie schön ist das Zeugnis, das Paulus den Gläubigen in Rom ausstellen konnte: Sie gehorchten Gott und standen fest. Er fordert sie auf, sich mit dem Guten, mit dem, was von Gott kommt, zu beschäftigen und sich wenn immer möglich nicht mit dem Bösen zu befassen.
Auch wenn Satan durch böse Arbeiter wirken kann, so ist es doch sicher, dass Gott ihn richten wird. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Gnade Gottes da, um uns vor dem Feind zu bewahren. Welch ein Trost!
Es folgen noch die Grüsse derer, die sich bei Paulus befanden, als dieser Brief geschrieben wurde. Tertius war der eigentliche Schreiber. Paulus hat ihm alles, was wir bis jetzt gelesen haben, diktiert.
Der Brief endet mit einem Lobpreis. Gott, der uns die Gedanken seines Herzens offenbart hat – sowohl das Evangelium als auch die Wahrheit über die Versammlung (die Einheit aller Erlösten) –, vermag uns auch zu bewahren und zu befestigen. Wenn wir versagen, sind wir immer selber schuld. Gott hat alles bereitgestellt, damit wir im Glauben befestigt werden. Ihm allein gebührt alle Ehre und Herrlichkeit.
Joseph beim Vater
Mit diesem Kapitel beginnt die Geschichte Josephs, des älteren Sohnes von Rahel. Warum heisst es jedoch in Vers 2: «Dies ist die Geschichte Jakobs: Joseph, 17 Jahre alt …»? Diese Aussage wird verständlich, wenn wir daran denken, dass Joseph eines der eindrücklichsten Vorausbilder auf den Herrn Jesus ist. Er ist der geliebte Sohn des Vaters, der Ihm alles bedeutet. Darum ist seine Geschichte auch die Geschichte des Vaters.
Joseph «weidete die Herde». Damit weist er auf den guten Hirten hin: Jesus Christus liess nicht nur sein Leben für die Schafe, Er sorgt auch unermüdlich für die Seinen (Johannes 10,11; 13,1).
«Joseph brachte ihre üble Nachrede vor ihren Vater.» Der Herr Jesus sah und erlebte in seinem Leben auf der Erde, wie die Juden Gott, seinen Vater, verunehrten. Daher sehen wir Ihn in den Evangelien oft im Gebet, um alles vor seinen Gott und Vater zu bringen.
Die besondere Liebe Jakobs zu Joseph wurde durch das Ärmelkleid öffentlich gesehen. Dass der Herr Jesus Gottes geliebter Sohn ist, bezeugte der Vater zweimal vom Himmel her (Matthäus 3,17; 17,5).
In den zwei Träumen Josephs offenbarte Gott etwas über die zukünftige Herrschaft dieses Sohnes Jakobs. Doch für die Brüder Josephs waren diese Mitteilungen ein zusätzlicher Grund, ihn zu hassen. Ganz ähnlich erging es unserem Herrn, als Er zu den Juden von seiner zukünftigen Macht und Herrschaft sprach. Sie legten es Ihm als Lästerung aus und forderten dafür seinen Tod (Matthäus 26,64-66).
Buchtipp: Durch Leiden zur Herrlichkeit.
Zu den Brüdern gesandt
Wie Joseph sich von Hebron aus zu seinen Brüdern senden liess, so war der Sohn Gottes bereit, sich von seinem Vater zu uns Menschen – vor allem zum Volk Israel – senden zu lassen. Als Er hier lebte, konnte Er sagen: «Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen» (Johannes 16,28).
Als Joseph endlich seine Brüder fand, sahen sie ihn von weitem kommen. «Da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten.» Was erlebte der Herr Jesus, als Er zu seinem irdischen Volk kam? Die jüdische Führungsschicht plante schon bald nach seinem öffentlichen Auftreten in Israel seinen Tod (Matthäus 12,14). Weshalb suchten sie Ihn umzubringen? Weil Jesus Christus Gott seinen eigenen Vater nannte (Johannes 5,18). Das war ein Grund für ihren tödlichen Hass, es gab aber auch noch andere Ursachen.
Ruben konnte verhindern, dass die anderen Brüder Joseph auf der Stelle totschlugen. Doch als Joseph zu ihnen kam, zogen sie ihm sein Ärmelkleid aus und warfen ihn in eine leere Zisterne. Das Ausziehen des Kleides redet davon, wie die Menschen das Vertrauen und die herzliche Beziehung, die der Herr Jesus zu seinem Gott hatte, verspotteten. Als Er am Kreuz hing, riefen sie: «Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt; denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn» (Matthäus 27,43). Die Grube spricht von den Leiden, die der Heiland vonseiten der Menschen während seines Lebens erdulden musste. Wenn wir an Klagelieder 3,53 denken, erkennen wir in der Grube auch die Leiden seines Todes.
Gehasst, abgelehnt, verkauft
Nachdem die Brüder fürs Erste ihren Hass an ihrem Bruder ausgelassen hatten, «setzten sie sich, um zu essen» (vergleiche Johannes 18,28). Als dann ein Zug Ismaeliter vorbeikam, verkauften sie Joseph für 20 Silberstücke in die Sklaverei. Damit hatten sie keinen Mord auf dem Gewissen und sich trotzdem ihres verhassten Bruders entledigt.
Der Herr Jesus wurde auch für Geld verkauft. 30 Silberstücke zahlten die Führer des Volkes dem Jünger Judas für den Verrat seines Meisters. Der Prophet Sacharja nennt diesen Geldbetrag einen «herrlichen» Preis (Sacharja 11,13). Darin widerspiegelt sich sowohl die Habsucht von Judas als auch die Geringschätzung der Hohenpriester gegenüber dem Herrn Jesus.
Die Söhne Jakobs täuschten ihren Vater mit dem Blut eines Ziegenbocks, in das sie das Ärmelkleid Josephs getaucht hatten. Jakob schloss daraus, dass Joseph von einem wilden Tier zerrissen worden sei. Gross war seine Trauer um den Sohn, den er besonders geliebt hatte. Ja, er weigerte sich, sich von seinen Söhnen trösten zu lassen. Hätten ihn diese harten Männer überhaupt trösten können?
Im Gegensatz zu Joseph musste unser Herr wirklich sterben. Mit seiner Kreuzigung verwarfen die Juden die wunderbare Gnade Gottes. Wie die Brüder Josephs das blutige Ärmelkleid ihrem Vater sandten, schickten die Juden mit der Steinigung von Stephanus eine Botschaft zum Himmel: Wir wollen nicht, dass Christus über uns herrsche! Damit lehnten sie die göttliche Gnade endgültig ab (Lukas 19,14; Apostelgeschichte 7,54-58).
Juda in Sünde und Schande
Der Geist Gottes fügt dieses Kapitel hier ein, um uns prophetisch zu zeigen, welchen Weg das Volk der Juden nach der Verwerfung des Herrn Jesus gegangen ist. Juda verband sich mit einem heidnischen Mann: Hira. Aus diesem Gang in die Welt gab es eine Verbindung zu ihr: Juda heiratete eine heidnische Frau, die ihm drei Söhne gebar. Das jüdische Volk wurde nach der Kreuzigung seines Messias in die ganze Welt zerstreut. Die Juden verbanden sich mit der Welt und wurden erfolgreiche Geschäftsleute. Und Gott? Auch wenn Er sein Volk bis heute auf die Seite stellen musste und es seine eigenen Wege gehen liess, hat Er es doch nicht aufgegeben. Die Zeit wird kommen, da Er einen Überrest seines irdischen Volkes begnadigen und segnen wird. Das sehen wir in Tamar, die trotz ihrer Sünde im Geschlechtsregister von Jesus Christus erwähnt wird (Matthäus 1,3). Nur auf der Grundlage des Sühnungstodes des Herrn Jesus wird es für sein irdisches Volk Gnade und Barmherzigkeit vonseiten Gottes geben.
Dieses Kapitel redet aber auch ganz praktisch zu unseren Herzen. Es zeigt uns, wozu wir fähig sind. Die Gottlosigkeit Judas, seine Unenthaltsamkeit, seine Sünde, aber auch seine Heuchelei und sein hartherziges Urteil sollen uns zur Warnung dienen. Und Tamar? Mit einer Sünde (Hurerei) versuchte sie zu ihrem Recht zu kommen, das ihr vorenthalten wurde (Vers 14). Dafür hätte sie sterben müssen (Vers 24). Aber Gott erwies ihr schliesslich seine unumschränkte Gnade. Ihr Sohn Perez wurde ein Vorfahre des Messias.
Joseph als Sklave bei Potiphar
Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die prophetische Bedeutung dieses Kapitels. Als Folge der Verwerfung des Herrn Jesus durch sein irdisches Volk ist das Heil und der Segen Gottes zu den Nationen gekommen (Römer 11,11). Bis heute wird auf der Welt das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Wer es im Glauben annimmt, wird errettet werden. Wo Menschen zum Herrn Jesus kommen, ändert sich vieles in ihrem Leben zum Guten. Das wird durch Vers 5 illustriert.
Wir können aus diesem Kapitel auch manches für unser Verhalten als Glaubende in schwierigen Lebenssituationen lernen. Joseph haderte nicht mit seinem Schicksal. Er blieb da, wohin er als Sklave gekommen war, seinem Gott treu und verrichtete seine Arbeit gewissenhaft. Wie schön ist die Antwort des Herrn! Er war mit Joseph und gab ihm Gelingen bei allem, was er tat.
Wenn wir da, wo der Herr uns hingestellt hat, unsere Arbeit fleissig und treu ausführen, wird dies auch von der Welt positiv wahrgenommen werden (Vers 3). Lasst uns auf diese Weise ein Zeugnis für unseren Herrn sein!
Doch Satan, der Feind der Seelen, war auch da und versuchte den gottesfürchtigen jungen Mann durch die Frau von Potiphar zu Fall zu bringen. Auf die erste Versuchung reagiert Joseph mit einem entschiedenen Nein: «Wie sollte ich diese grosse Bosheit tun und gegen Gott sündigen?» Er wollte seinem Gott treu bleiben.
Joseph sündigt nicht
In einer einmaligen Versuchung standhaft zu bleiben und nicht zu sündigen, ist eine Sache. Wenn aber die Verführung «Tag für Tag» an einen herantritt, was dann? Dann brauchen wir täglich die Bewahrung des Herrn und Kraft von Ihm, um uns der Sünde für tot zu halten. Joseph musste weiter seine Arbeit verrichten und seine Aufgaben erfüllen. Er konnte dieser verführerischen Frau nicht ausweichen. Als aber der Moment kam, an dem sie ihn zur Sünde zwingen wollte, floh er. Das war seine einzige Rettung (1. Korinther 6,18).
Nun zeigte die Frau von Potiphar ihr wahres Gesicht. Sie wollte nur ein kurzes sündiges Vergnügen mit ihrem Sklaven haben. Als dieser sich weigerte und floh, verdrehte sie die Wahrheit und sorgte dafür, dass Joseph ins Gefängnis kam. So handelt der Teufel bis heute. Zuerst versucht er uns zur Sünde zu verleiten, indem er sie verharmlost. Bleiben wir standhaft und weigern uns zu sündigen, tritt er als brüllender Löwe gegen uns auf. Doch er kann uns nicht verschlingen, weil er nicht weitergehen darf, als Gott es zulässt.
Joseph befand sich unschuldig im Gefängnis. Aber der Herr war genauso mit ihm wie vorher im Haus von Potiphar. So schwer die Prüfung für den unschuldigen Sklaven auch war, der Herr hatte ihn nicht verlassen. Er wandte ihm vielmehr Güte zu (Vers 21). Für Joseph war es eine Zeit der Glaubensprüfung und der Läuterung (Psalm 105,18.19). Was für Schlacken dabei entfernt wurden, sagt die Bibel nicht. Als unser Herr geläutert wurde, fand sich nichts Unreines (Psalm 17,3).
Joseph im Gefängnis
Während Joseph unschuldig in Haft war, wurden eines Tages zwei prominente Gefangene an den gleichen Ort gebracht: der Oberste der Mundschenken und der Oberste der Bäcker. Joseph durfte sie bedienen.
Nach einer Zeit hatten beide in der gleichen Nacht einen sonderbaren Traum. Weil sie ihre Träume nicht verstanden und auch keine Möglichkeit hatten, Traumdeuter beizuziehen, waren sie missmutig. Das entging dem aufmerksamen Joseph nicht, so dass er sie nach dem Grund ihrer Niedergeschlagenheit fragte. Als sie ihm von ihren Träumen berichteten, verwies er auf den allein wahren Gott, der die Deutungen kennt.
Nun erzählten sie ihm ihre Träume und Joseph konnte ihnen die Deutung mitteilen, die genau so eintraf: Der Oberste der Bäcker wurde nach drei Tagen gehängt, während der Oberste der Mundschenken wieder in sein Amt eingesetzt wurde. Obwohl Joseph diesem einflussreichen Mann seine Lage geschildert hatte, dachte dieser nach seiner Freilassung nicht mehr an ihn und vergass ihn. Wieder wurde Joseph von Menschen enttäuscht. Aber Gott blieb bei ihm und vergass ihn nicht.
Beim Lesen dieses Kapitels denken wir an Golgatha, wo der Herr Jesus zwischen zwei Verbrechern am Kreuz hing. Der eine sah ein, dass er das Todesurteil verdient hatte, und appellierte an die Gnade des Herrn. Ihm versicherte der gekreuzigte Heiland: «Heute wirst du mit mir im Paradies sein» (Lukas 23,43). Der andere tat nicht Buße und ging ewig verloren.
Zwei Träume
«Nach Verlauf von zwei vollen Jahren …» Für Joseph müssen es zwei Jahre sehnsüchtigen Wartens gewesen sein. Aber nun war Gottes Zeit gekommen, um die Leiden und die Erniedrigung dieses bescheidenen und gottesfürchtigen jungen Mannes zu beenden. Auslöser für die Befreiung Josephs aus dem Gefängnis waren zwei Träume, die Gott dem Pharao schickte und die seine Wahrsager nicht deuten konnten.
Im Alten Testament sehen wir, wie Gott den Menschen in gewissen Situationen durch Träume etwas Wichtiges mitteilte. In der heutigen Zeit besitzen wir die Bibel, das vollständige Wort Gottes. Darum spricht Gott nicht mehr in dieser Weise durch Träume zu uns.
Die Beschreibung der Träume in den Versen 2-7 zeigt, dass der Pharao beim Erwachen noch genau wusste, was er geträumt hatte. Am Morgen war sein Geist voll Unruhe, weil er merkte, dass diese Träume für ihn und sein Land bedeutungsvoll sein mussten. Aber niemand konnte ihm weiterhelfen.
Nun war der Moment da, an dem der Oberste der Mundschenken sich an Joseph im Gefängnis erinnerte. Er erzählte dem ägyptischen Herrscher von seinem früheren Vergehen und wie der Pharao ihn ins Gefängnis gebracht hatte. Er berichtete weiter von dem hebräischen Sklaven, der ihm und dem Obersten der Bäcker den Traum gedeutet hatte. «Wie er uns deutete, so ist es geschehen.» Das war die entscheidende Aussage, die den Pharao veranlasste, Joseph aus dem Gefängnis holen zu lassen (Vers 14).
Die Deutung der Träume
Damit der gefangene Sklave vor dem Pharao erscheinen konnte, musste er äusserlich entsprechend zurechtgemacht werden: «Er schor sich und wechselte seine Kleider.» Zudem ging jetzt alles sehr schnell. Der Pharao drängte auf eine Antwort. War Joseph der Mann, der diese schwierige Aufgabe lösen und seinen Traum deuten konnte? Wie schön und nachahmenswert ist die Reaktion Josephs! Demütig verwies er auf Gott: «Das steht nicht bei mir; Gott wird antworten.»
Wie bereits in 1. Mose 40,8 bildete sich Joseph gar nichts auf irgendwelche persönliche Fähigkeiten ein. Er wusste, dass nur Gott, der die Träume schickt, auch ihre Deutung anzeigen konnte. Aber dieser Mann, der in allen Umständen – auch in den schwierigsten und schwersten – mit seinem Gott lebte, hatte ein starkes Vertrauen in dessen Hilfe.
Nachdem der Pharao Joseph seine Träume erzählt hatte, konnte dieser auf der Stelle antworten: Nach sieben Jahren des Überflusses würden sieben notvolle Jahre der Hungersnot kommen. Obwohl die Sache bei Gott fest beschlossen war, warnte Er doch den ägyptischen Herrscher im Voraus. Durch Joseph, der diese Träume mit göttlicher Hilfe deuten konnte, gab Gott dem Pharao ausserdem weise Vorschläge, um für die mageren Jahre vorzusorgen. Wie klug waren diese Massnahmen, die Joseph zur Erhaltung des Lebens vorstellte!
In seiner Güte warnt Gott die Menschen zu allen Zeiten vor dem kommenden Gericht. Er gibt ihnen immer die Zeit und Möglichkeit, sich retten zu lassen. Nie kommt ein göttliches Gericht ohne Vorwarnung.
Joseph wird Herrscher
Der Vorschlag Josephs leuchtete dem Pharao und seinen Beamten ein. Beeindruckt von Joseph, der im Vertrauen zu seinem Gott die Träume deuten und weise Vorschläge machen konnte, fragte der Pharao: «Werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist?» Dann setzte er Joseph auf den höchsten Platz, der in Ägypten zu vergeben war. Er stattete ihn mit allen Vollmachten aus, um die nötigen Vorkehrungen zum Überleben zu treffen.
Bei dieser Erhöhung Josephs denken wir unwillkürlich an den Herrn Jesus, den Gott nach seiner tiefen Erniedrigung am Kreuz auf den höchsten Platz der Ehre gesetzt hat. Bald wird der Augenblick kommen, wo alle Welt sich vor Ihm beugen und Ihn als Herrn anerkennen muss (Philipper 2,9-11).
Asnat, die Joseph zur Ehefrau bekam, weist auf die Versammlung Gottes hin, die aus allen Erlösten der Gnadenzeit besteht. Sie entstand an Pfingsten, nachdem der Herr Jesus im Himmel verherrlicht war (Apostelgeschichte 2,1-4; Epheser 1,22.23), so wie Asnat erst die Frau Josephs wurde, als dieser bereits in seine hohe Position eingesetzt war.
Die beiden Söhne, die Asnat gebar, sprechen von dem, was auf die Verwerfung und Kreuzigung des Herrn Jesus folgte. Seine Freude über die Versammlung ist grösser als sein Schmerz über die Ablehnung durch Israel (Vers 51). Die Erlösten der Gnadenzeit sind die erste und kostbarste Frucht aus seinen Leiden und seinem Sterben (Vers 52).
Die Hungersnot beginnt
Josephs Deutung der Träume erfüllte sich. Nach den sieben Jahren des Überflusses begannen die sieben Jahre der Hungersnot. Als die hungernden Menschen zum Pharao um Brot schrien, antwortete er: «Geht zu Joseph; tut, was er euch sagt!»
Was haben diese Verse uns zu sagen? Wir leben am Ende der Gnadenzeit. Nach der Entrückung kommen die sieben mageren Jahre. Sie weisen auf die zukünftige Gerichtszeit hin, die in der Bibel angekündigt ist. Es ist «die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird» (Offenbarung 3,10).
Die Aufforderung «Geht zu Joseph!» lässt uns an die Tatsache denken, dass der Mensch nur durch den Glauben an den Herrn Jesus dem göttlichen Gericht entrinnen kann. Es gibt keinen anderen Retter (Apostelgeschichte 4,12).
Die Bibel belehrt uns, dass Gott sich nach Ablauf der Gnadenzeit wieder mit seinem irdischen Volk Israel beschäftigen wird. Das werden wir anhand der weiteren Geschichte der Brüder Josephs sehen. Die Juden müssen einsehen, dass sie mit der Kreuzigung von Jesus Christus ihren Messias umgebracht haben, und darüber Buße tun. Sie müssen auch erkennen, dass ihre Beziehung als Volk zu Gott nur aufgrund seiner Gnade und Barmherzigkeit wiederhergestellt werden kann.
Die Hungersnot, die auch die Familie Jakobs zu spüren bekam, spricht von der zukünftigen Drangsalszeit, die Israel besonders treffen wird (Jeremia 30,7). Der Hunger trieb die Söhne Jakobs nach Ägypten, wo sie Joseph begegnen mussten.
Die Brüder kommen zu Joseph
Als die Brüder Josephs nach Ägypten kamen, erkannte er sie. Sie aber wussten nicht, wer dieser Gebieter war, der sie mit äusserer Härte behandelte und sie als Spione bezeichnete.
Als die zehn Männer sich vor ihm mit dem Gesicht zur Erde niederbeugten, dachte Joseph an die Träume, die er als junger Mann zu Hause gehabt hatte (1. Mose 37,5-11). Nun erfüllte sich, was er damals geträumt hatte!
Warum behandelte Joseph seine Brüder derart hart und unfreundlich? Weil er ihre Gewissen erreichen wollte. Sie mussten zur Einsicht und zum Bekenntnis ihrer Schuld kommen, die sie ihm gegenüber hatten. Nur auf diese Weise konnte es eine völlige Wiederherstellung geben.
In Vers 11 bekennen sie: «Wir sind redlich.» Ja, vielleicht jetzt! Aber sie waren es nicht immer. Denken wir nur daran, wie sie ihren Vater mit dem blutgetränkten Kleid Josephs betrogen hatten. Von ihrem Bruder, den sie in die Sklaverei verkauft hatten, sagten sie nur: «Der eine ist nicht mehr.» Aber gerade diese Angelegenheit musste geklärt werden.
Anhand des jüngsten Bruders sollte die Wahrheit ihrer Worte geprüft werden. Doch bevor Joseph seinen Brüdern genaue Anweisungen gab, steckte er sie für drei Tage ins Gefängnis. Nun hatten sie Zeit, über alles Vorgefallene nachzudenken. Nachdem sie ihre Herzen über so lange Zeit verhärtet hatten, waren diese drei Tage nötig, um sie zum Bewusstsein ihrer Schuld an Joseph zu führen.
Das Gewissen erwacht
Nach drei Tagen wurden die Brüder Josephs aus dem Gefängnis entlassen. Der Gebieter über das Land Ägypten wollte ihre Aufrichtigkeit testen. Er sandte sie mit Getreide beladen nach Hause, behielt jedoch Simeon gefangen in Ägypten zurück. Er erwartete von ihnen, dass sie mit ihrem jüngsten Bruder zurückkämen. Das würde die Wahrheit ihrer Worte beweisen.
Aus den Aussagen der Brüder – die Joseph verstand, ohne dass sie es wussten – sieht man das wachsende Bewusstsein ihrer Schuld gegenüber Joseph. Sie merkten: «Wir sind schuldig wegen unseres Bruders.» Ruben versuchte sich im Moment noch zu rechtfertigen. Doch er musste ebenfalls zur Erkenntnis seiner Mitschuld kommen, obwohl er es nicht so böse gemeint hatte wie die anderen.
Und Joseph? Die ersten Anzeichen der Buße bei seinen Brüdern rührten ihn zu Tränen. Aber er konnte ihnen seine Empfindungen im Moment nicht zeigen. Es war noch zu früh. Das Werk in ihren Herzen und Gewissen musste sich noch vertiefen. Diese Tränen sprechen prophetisch von der Zuneigung des Herrn Jesus zu seinem irdischen Volk. Er liebt Israel, obwohl es Ihn verworfen und gekreuzigt hat.
Joseph veranlasste, dass seinen Brüdern das Geld zurückgegeben wurde. So muss Israel in der Zukunft erkennen, dass es den Segen Gottes nur durch Gnade empfangen kann. Die Wegzehrung zeigt, dass der Herr auch in der Drangsalszeit für die Treuen in Israel sorgen wird (Psalm 132,15).
Die Brüder kehren zum Vater zurück
Auf dem Heimweg entdeckt einer, dass sein Geld oben in seinem Sack liegt. Sie freuen sich nicht über diese Güte. Es ist für sie vielmehr ein neuer Schrecken, der sie aber zur Einsicht führt, dass Gott hinter all dem stehen muss, was sie in letzter Zeit erlebt haben. Doch Gott ist nicht gegen sie. Seine Güte durch Joseph will sie zur Buße leiten. Solange aber ein Mensch mit seinem Schöpfer nicht im Reinen ist, hat er immer den Eindruck, Gott sei gegen ihn, sobald er etwas Unerklärliches oder Schweres erlebt. Diese Ansicht ändert sich erst, wenn er Frieden mit Gott hat.
Dass Joseph ihnen das Geld zurückgab, weist auf die Zukunft hin. Israel wird den Segen Gottes «ohne Geld und ohne Kaufpreis» bekommen (Jesaja 55,1).
Der alte Vater Jakob ist über den Bericht seiner Söhne alles andere als erfreut. Traurig ruft er aus: «Ihr habt mich der Kinder beraubt … Dies alles kommt über mich!» Ja, Jakob hat in seinem Leben bitter erfahren müssen, wie wahr Galater 6,8 ist: «Wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten.» Hier steht er an einem gewissen Tiefpunkt in seinem Leben: «Joseph ist nicht mehr, und Simeon ist nicht mehr; und Benjamin wollt ihr nehmen!» Da helfen auch die gut gemeinten Worte Rubens nicht. Für Jakob sieht alles sehr schlimm aus. Er meint, er müsse vor Verzweiflung sterben, falls Benjamin nicht zurückkommt. Im Augenblick ist er absolut nicht bereit, seinen jüngsten Sohn nach Ägypten mitzugeben. Erst der bittere Hunger wird ihn zwingen, dem Befehl des ägyptischen Herrschers nachzukommen.
Die Hungersnot ist schwer
Obwohl sich Jakob zunächst gegen den Gedanken wehrte, seinen jüngsten Sohn Benjamin nach Ägypten zu senden, zwang ihn der Hunger, die Sache nochmals zu überdenken. Schliesslich willigte er ein, weil Juda als Bürge für Benjamin eintrat. Durch sein Einverständnis beugte sich Jakob unter die Autorität Josephs, so dass auch der zweite Traum, den der junge Joseph gehabt hatte, in Erfüllung ging: «Siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder» (1. Mose 37,9).
Was Jakob in Vers 11 versuchte, ist mit dem vergleichbar, was heute manche Menschen unternehmen. Um mit Gott ins Reine zu kommen, bieten sie Ihm das Beste an, das sie haben. Damit versuchen sie seine Gunst zu erlangen. Aber der Allmächtige «gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen» (Apostelgeschichte 17,30). Das ist der einzige Weg, auf dem ein Mensch mit Gott versöhnt werden kann. Gute Werke oder sonstige Anstrengungen bringen den sündigen Menschen keinen Schritt näher zu Gott.
Beim Lesen dieser Verse können wir auch an die prophetische Seite denken, bei der es um die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und seinem irdischen Volk Israel geht. Aus diesem Blickwinkel gesehen zeigt dieser Abschnitt, dass es nur einen Weg gibt, auf dem der glaubende Überrest der Juden aus der Drangsalszeit befreit wird: Erst wenn sie die Grösse ihrer Schuld, die ihr Volk an der Verwerfung und Tötung von Christus hat, einsehen und bekennen, wird Gott sie aus ihrer Bedrängnis erlösen.
Die Brüder im Haus Josephs
Wie muss es das Herz Josephs bewegt haben, als er sah, dass seine Brüder mit Benjamin gekommen waren! Aber er hatte das Ziel mit ihnen noch nicht erreicht. Deshalb konnte er sich noch nicht zu erkennen geben. Aber sie sollten mit dem Herrscher über Ägypten zu Mittag essen. Weil jedoch Angst und Sorgen ihre Herzen beschwerten, konnten sie sich über diese Ehre, die ihnen zuteilwurde, nicht freuen.
Strenge und Güte charakterisierten das Handeln Josephs mit seinen Brüdern. Im Augenblick erfuhren sie nur Güte. Der Chefbeamte von Joseph konnte ihre Furcht zerstreuen: Ihm war das Geld für das gekaufte Getreide zugekommen (Vers 23). Interessant ist seine Bemerkung über ihren Gott und den Gott ihres Vaters. Dieser hochgestellte Mann hatte beim Übersetzen der Konversation zwischen Joseph und seinen Brüdern wahrscheinlich einiges mitbekommen. Im Gespräch war sicher auch von ihrem Gott die Rede gewesen.
Dann wurde Simeon, der im Gefängnis gesessen hatte, zu ihnen geführt. Zusammen machten sie sich für das Bankett mit dem ägyptischen Herrscher bereit. Auch das Geschenk für ihren Gastgeber legten sie zurecht.
Sie hatten wohl nicht im Geringsten erwartet, dass sie in Ägypten auf eine solche Weise überrascht würden. Aber alles musste dazu beitragen, ihre Herzen zu erreichen und sie zu dem Punkt zu bringen, an dem Joseph sich ihnen zu erkennen geben konnte. Ganz ähnlich wird es in der Zukunft sein, bevor Christus sich dem treuen Überrest zeigen wird.
Wiedersehen mit Benjamin
In 1. Mose 42,24 haben wir bereits einmal davon gelesen, dass Joseph sich von seinen Brüdern abwenden musste, um im Verborgenen zu weinen. Jetzt sah er bei den anderen auch Benjamin, seinen jüngsten Bruder, den Sohn seiner eigenen Mutter Rahel. Da konnte er seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Doch seinen Brüdern gegenüber durfte er diese Empfindungen noch nicht zeigen. So weinte er im inneren Gemach. Nach aussen aber bezwang er sich. Die Tränen Josephs erinnern uns an die Tränen des Herrn Jesus über Jerusalem. Er weinte über diese Stadt, die Ihn verworfen hatte und deshalb noch viel Schweres erleben wird (Lukas 19,41-44). Wie liebte Er doch sein irdisches Volk!
Dämmerte vielleicht bei dem einen oder anderen der Brüder Josephs die Ahnung, dass dieser mächtige Mann ihr Bruder sein könnte? Doch Gewissheit darüber hatten sie noch nicht. Das Verhalten Josephs ihnen gegenüber liess sie jedoch Schritt für Schritt etwas von seiner Person erkennen:
- Er interessierte sich auffallend stark für ihren Vater.
- Er liess sie dem Alter nach Platz nehmen. «Die Männer sahen einander staunend an.» Wie konnte er dies über sie wissen?
- Benjamin hob er durch ein fünfmal grösseres Ehrengericht hervor.
Darin gibt uns Joseph wieder ein schönes Bild vom Herrn Jesus, wie Er in Liebe und Weisheit mit dem gläubigen Überrest seines irdischen Volkes umgehen wird, um eine völlige Wiederherstellung zu bewirken.
Der Becher im Sack Benjamins
Der Verwalter über das Haus Josephs wurde schon in Kapitel 43 mehrmals erwähnt. Hier war er es, der den silbernen Kelch Josephs in den Sack von Benjamin stecken und den abgereisten Brüdern nachjagen musste. Alles, was dieser Mann tat, weist auf die Tätigkeit des Heiligen Geistes hin. Er stellt den Sünder ins Licht Gottes. Er überführt ihn, er wendet das Wort Gottes auf ihn an, um ihm neues Leben zu schenken.
Warum machte Joseph Benjamin zum Schuldigen? Was bezweckte er damit? Er wollte einerseits die Brüder von ihrer Schuld an ihm selbst überführen. Als sie das erste Mal vor Joseph standen, erklärten sie: «Wir sind redlich» (1. Mose 42,11). Sogar jetzt, als der Verwalter Josephs sie eingeholt hatte, beteuerten sie: «Fern sei es von deinen Knechten, so etwas zu tun!» (Vers 7). Schliesslich aber kamen sie zum Bekenntnis: «Gott hat die Ungerechtigkeit deiner Knechte gefunden» (Vers 16). Vor Gott war das, was sie Joseph angetan hatten, nicht einfach in Vergessenheit geraten.
Anderseits machte Joseph seinen jüngeren Bruder zum Schuldigen, um zu sehen, wie die anderen jetzt reagieren würden. Würden sie Benjamin preisgeben und gleichgültig seinem Schicksal überlassen, wie sie damals Joseph gefühllos verkauft hatten?
Bis zu diesem Morgen, an dem sie entlassen worden waren, war alles über Erwarten gut gegangen. Und nun? In welch einem tieftraurigen Zustand – davon reden die zerrissenen Kleider – kehrten sie in die Stadt zurück, um erneut vor Joseph zu erscheinen!
Juda tritt für Benjamin ein
Alles drehte sich nun um Benjamin, bei dem der silberne Becher gefunden worden war. Da sehen wir Juda, den Bürgen für Benjamin, wie er hervortritt und sich für seinen jüngsten Bruder einsetzt (1. Mose 44,14.16.18). Aus seinen Worten, die er auch im Namen seiner Brüder äussert, zeigt sich echte Buße.
Gewissermassen als Richter wirft Joseph ihnen vor: «Was ist das für eine Tat, die ihr getan habt!» Sie rechtfertigen sich nicht mehr, sondern anerkennen ihre Schuld. Sie bezeichnen ihr böses Tun mit Joseph als Ungerechtigkeit (Vers 16). Das ist Buße!
Weil Joseph nur Benjamin zurückhalten will, beginnt Juda eine längere Rede. Aufrichtig erzählt er, wie alles gekommen ist. Von Benjamins Bruder sagt Juda: Er ist tot (Vers 20). Jakob drückt sich nicht so abschliessend aus (Vers 28). Der Hauptpunkt der Rede Judas aber ist: Benjamin muss unter allen Umständen zu seinem Vater zurückkehren. Da er für ihn Bürge geworden ist, sagt er: «Lass doch deinen Knecht anstatt des Knaben bleiben, als Knecht meines Herrn» (Vers 33). Das ist der Beweis echter Buße. Juda ist bereit, sein Versprechen einzulösen und mit Benjamin anders zu handeln als damals mit Joseph. Damit zeigt er der Buße würdige Frucht.
Durch die Gerichte, die Gott in der Drangsalszeit über Israel bringen wird, wird Er dieses Ziel mit dem Volk Israel erreichen: Ein Überrest wird über die Kreuzigung seines Messias Buße tun und seine Sinnesänderung durch ein verändertes Verhalten beweisen.
Joseph gibt sich zu erkennen
Nun war der Moment gekommen, dass Joseph sich seinen Brüdern zu erkennen geben konnte. Doch dazu mussten alle Ägypter hinausgehen (Vers 1). Joseph wollte mit seinen Brüdern allein sein, wenn er ihnen erklärte: «Ich bin Joseph!» Vergebung und Wiederherstellung eines Gläubigen, der vom Weg abgekommen und in Sünde gefallen ist, kann nur der Herr bewirken. Zudem bleibt es eine persönliche Sache zwischen Ihm und dem Fehlbaren. Das sehen wir auch bei Petrus (Lukas 24,34; 1. Korinther 15,5). Doch die Auswirkungen einer solchen Begegnung werden auch andere erkennen (1. Mose 45,2.16).
So wie Joseph sich hier den Brüdern zu erkennen gab, so wird der Herr Jesus am Ende der Drangsalszeit dem Überrest aus Israel erscheinen. Nachdem diese Gläubigen ihre Schuld über die Kreuzigung ihres Messias eingesehen und darüber Buße getan haben werden, wird Er sich ihnen offenbaren. Sie werden sehen, dass es die gleiche Person ist, den ihre Vorfahren einst gekreuzigt hatten. Der verachtete Jesus von Nazareth ist der Herr, der dann in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird.
In den Worten Josephs erkennen wir prophetisch die beiden Seiten des Kreuzes von Golgatha:
- Die Seite der Menschen ist, dass wir den Sohn Gottes umgebracht haben, ähnlich wie die Brüder Joseph nach Ägypten verkauft haben (Vers 4).
- Die Seite Gottes aber ist, dass Er seinen Sohn in den Tod gegeben hat, damit jeder, der an Ihn glaubt, errettet wird. Joseph erklärte: «Zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt» (1. Mose 45,5-7).
Joseph, dein Sohn, lebt!
In Vers 13 forderte Joseph seine Brüder auf, seinem und ihrem Vater von all seiner Herrlichkeit in Ägypten zu erzählen und ihn dann herabzubringen. Er wollte nun seinen alten Vater bei sich haben und für ihn sorgen.
Auch am Hof des Pharaos, wo Joseph hoch angesehen war, wurde man aktiv (1. Mose 45,17-20). Der Pharao und die Ägypter stellen hier prophetisch die Nationen dar, die zu Beginn des Tausendjährigen Reichs die Rückkehr der Israeliten nach Jerusalem unterstützen werden. Die angebotenen Wagen illustrieren die verschiedenen Transportmittel, die den Israeliten dann zur Verfügung gestellt werden (Jesaja 66,20).
Der Pharao erklärte: «Das Beste des Landes Ägypten soll euer sein.» In dieser Aussage sehen wir, wie in der Zukunft die ganze Bevölkerung der Erde die Vorrangstellung des Volkes Israel anerkennen wird. Dann wird Gott Israel über alle Völker erheben und zur höchsten Nation machen (5. Mose 28,1).
Mit Nahrungsmitteln und Geschenken reich beladen kehrten die elf Männer zu ihrem Vater Jakob zurück. Doch dieser konnte im ersten Moment die Nachricht, die sie mitbrachten, gar nicht fassen: «Joseph lebt noch, und er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten.» Wir können diese Reaktion gut verstehen. Seit dem Tag, an dem er aufgrund des blutigen Gewandes meinte, Joseph sei gestorben, waren immerhin 22 Jahre vergangen. Als er aber alle Worte Josephs hörte und die Wagen sah, die sein Sohn gesandt hatte, wurde er überzeugt. Nun wollte er nach Ägypten aufbrechen, um seinen Sohn Joseph noch einmal zu sehen.
Jakob zieht nach Ägypten
Der alte Mann, der mit seiner Sippe aufbrach, um nach Ägypten zu ziehen, machte sich mit Gott auf den Weg. Er ging nicht im Eigenwillen. Darum wird er hier mit seinem neuen Namen – Israel – genannt. An der Grenze des verheissenen Landes legte er nochmals einen Halt ein. Er wollte sicher wissen, ob dies der richtige Weg sei. Gott antwortete ihm. Er versprach ihm, dass Er ihn begleiten und seine Nachkommen später in das Land Kanaan zurückführen werde. So zog Jakob mit Gott nach Ägypten.
In den Versen 8-27 wird die Familie Jakobs namentlich aufgeführt: seine Söhne und Enkel. Es waren weniger als hundert Personen, die diese Reise machten. Einige Jahrhunderte später zählte das Volk Israel vermutlich über zwei Millionen Menschen (600 000 Gemusterte; 2. Mose 12,37; 4. Mose 1,46), die von Ägypten ins verheissene Land zurückkehrten.
Schliesslich traf Jakob mit seinem lange tot geglaubten Sohn Joseph zusammen. Welch ein Wiedersehen! Nun hatte Jakob keine Wünsche mehr. Dann teilte Joseph dem Pharao die Ankunft seiner Familie mit. Dieser hochgestellte Mann in Ägypten bekannte sich zu den Seinen, die Schafhirten waren und Viehzucht betrieben – ein Beruf, der in Ägypten nichts galt. Damit weist Joseph auf den Herrn Jesus hin, der sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen (Hebräer 2,11). In der Zukunft wird Er sich auch zu Israel bekennen und es öffentlich wieder als sein Volk anerkennen (Jesaja 51,16).
Jakob vor dem Pharao
Nun stellte Joseph seine Familie dem Pharao vor. Er nahm fünf Männer aus seiner Verwandtschaft und brachte sie als Vertreter seiner Familie vor den ägyptischen König. Auf die Frage nach ihrer Berufstätigkeit antworteten sie freimütig: «Deine Knechte sind Schafhirten.» Dann legten sie ihm ihre Notsituation vor und baten den Pharao: «Lass doch deine Knechte im Land Gosen wohnen.» Ihrer Bitte wurde um Josephs willenentsprochen. Sieht es bei uns nicht ganz ähnlich aus? Unsere Stellung vor Gott ist einzig und allein im Herrn Jesus gesichert. Wir sind «begnadigt in dem Geliebten» (Epheser 1,6).
Auch seinen alten Vater Jakob brachte Joseph vor den Pharao. Dieser fragte den Patriarchen nach seinem Alter. Jakob war 130 Jahre alt, aber in seinem Leben hatte er viele verlorene Jahre zu beklagen. Es waren schwere Jahre gewesen mit wenig Frucht für Gott. Ehrlich bekannte er, dass er sein Leben nicht mit dem seiner Vorfahren vergleichen konnte.
Doch jetzt als alter gläubiger Mann lebte er in Gemeinschaft mit seinem Gott. Dadurch war er in der Lage, den Pharao zu segnen (1. Mose 47,7.10). Weil er der Träger der göttlichen Verheissungen war und an der Hand Gottes ging, besass Jakob eine besondere Würde. So konnte dieser einfache Nomade und Viehhirt den vermutlich grössten Monarchen jener Zeit segnen. Der Grundsatz, den wir in Hebräer 7,7 finden, kommt hier deutlich vor uns: «Ohne allen Widerspruch aber wird das Geringere (= der Pharao) von dem Besseren (= Jakob) gesegnet.»
Die Herrschaft und Macht Josephs
Diese Verse sind auf den ersten Blick nicht so leicht verständlich. Es entsteht die Frage: Warum musste sich das ganze Volk der Ägypter dem Pharao verkaufen, um überleben zu können? War das recht?
Sobald wir an die prophetische Seite dieses Abschnitts denken, klärt sich die Sache. Der Geist Gottes will hier ein Bild von der Herrschaft des Herrn Jesus im Tausendjährigen Reich zeigen. Wie Joseph über alles herrschte und alles bestimmte, so wird Christus in seinem Reich unumschränkt regieren.
Joseph versorgte alle Menschen mit Brot. In der Zukunft wird es unter der Herrschaft von Jesus Christus auf der Erde keine Hungersnot geben – weder materiell noch geistlich. Alle Menschen werden genug zu essen haben. Gleichzeitig werden sie den lebendigen und wahren Gott kennen, «denn die Erde wird voll Erkenntnis des Herrnsein, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken» (Jesaja 11,9). Was für eine herrliche Zeit wird das sein!
Schliesslich gehörte alles dem Pharao: das Geld, das Vieh, das Land und die Menschen. Auch diese Tatsache weist auf die Zukunft hin. Sie wird im Blick auf das Tausendjährige Reich durch folgende Bibelstellen bestätigt:
- «Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen» (Haggai 2,8).
- «Mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen» (Psalm 50,10).
- «Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen» (Psalm 24,1).
Jakob steht vor dem Tod
Jakob lebte noch 17 Jahre in Ägypten. Bereits in dieser Zeit begannen sich seine Nachkommen sehr zu mehren (vergleiche 1. Mose 46,3). Doch nun nahte für ihn das Ende seines Lebens auf der Erde. Da rief er Joseph zu sich, um ihm Anweisung für das Begräbnis zu geben. Auf dem Weg nach Ägypten, als Jakob in Beerseba Halt gemacht hatte, hatte Gott ihm unter anderem zugesagt: «Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen, und ich will dich auch gewiss heraufführen» (1. Mose 46,4). An den zweiten Teil dieses Versprechens dachte Jakob jetzt. Joseph musste seinem Vater schwören, dass er ihn nach seinem Tod nicht in Ägypten, sondern im Land Kanaan begraben würde – in der Höhle des Feldes Machpela, wo auch seine Vorfahren beerdigt waren.
Wie schön ist der Schluss von Vers 31! Jakob, der Überlister, betete am Ende seines Lebens an und rühmte die Gnade Gottes, die ihn nie aufgegeben, sondern ans Ziel gebracht hatte.
In den letzten Tagen seines Lebens traf Jakob noch eine wichtige Entscheidung. Er «adoptierte» gewissermassen die beiden Söhne Josephs als seine eigenen. Die Folge war, dass es nicht einen Stamm Joseph, sondern einen Stamm Ephraim und einen Stamm Manasse gab. Auf diese Weise wurde Joseph der Haupterbe, der das doppelte Teil bekam. Jakob gab ihm den Platz des Erstgeborenen (5. Mose 21,17).
Wieder weist uns Joseph auf den Herrn Jesus hin. Gott hat Ihn zum Erben aller Dinge gemacht (Hebräer 1,2). Er wird der Haupterbe von Himmel und Erde sein.
Jakob segnet die Söhne Josephs
Weil Ruben gesündigt hatte, wurde ihm das Erstgeburtsrecht mit dem doppelten Erbteil entzogen und den Söhnen Josephs gegeben (1. Mose 49,4; 1. Chronika 5,1). In Ephraim und Manasse bekam Joseph dieses doppelte Teil. Das weist auf Christus als den Haupterben hin. Manasse und Ephraim sind zudem ein Bild von den beiden Seiten seines Erbes:
- Ephraim, der Jüngere, spricht von den Glaubenden, die ein himmlisches Erbteil besitzen. Es sind einmal alle, die im Glauben gestorben sind und zum Leben auferstehen werden. Aber auch die lebenden Gläubigen, die bei der Entrückung verwandelt werden, gehören zu ihnen. Gemeinsam werden sie mit Christus am himmlischen Segen des Tausendjährigen Reichs teilhaben.
- Manasse, der Ältere, weist auf die Glaubenden hin, die ein irdisches Erbteil haben. Das betrifft alle, die nach der Drangsalszeit als lebende Menschen auf der Erde ins Reich eingehen und den Segen Gottes unter der Regierung von Christus geniessen werden.
Beim Segnen der beiden Söhne Josephs kreuzte Jakob seine Hände. Joseph protestierte dagegen, aber Jakob wusste es besser. Er handelte nach Gottes Ratschluss. Von Manasse sagte er: «Auch er wird gross sein», aber er fügte hinzu: «doch wird sein jüngerer Bruder grösser sein als er» (Vers 19). Das erfüllte sich später. Ephraim wurde zum Repräsentanten des ganzen Zehn-Stämme-Reichs. Doch wichtiger ist die prophetische Seite: Das Vorrecht derer, die im Himmel am Friedensreich teilhaben werden, ist grösser als der Segen derer, die dann auf der Erde leben werden.
Der Segen Jakobs (1)
In diesem Kapitel richtet der alte Patriarch seine letzten Worte an seine Söhne. In Vers 28 wird diese Rede der Segen Jakobs genannt. Doch seine Mitteilung ist eigentlich eine Prophetie, eine Vorausschau auf die Geschichte des Volkes Israel (Vers 1).
In Ruben sehen wir die Anfangszeit des Volkes. Israel war Gottes Erstgeborener (2. Mose 4,22). Und die Sünde Rubens? Sie weist auf die Verdorbenheit der Menschen in Israel hin. Kaum waren sie aus Ägypten befreit, da murrten sie schon. Und am Sinai machten sie das goldene Kalb (2. Mose 32,7).
In seinen Worten über Simeon und Levi dachte Jakob an ihre Gewalttat, die sie in Sichem verübt hatten (1. Mose 34). Hier wird prophetisch der Zustand des Volkes zur Zeit der Richter und Könige vorgestellt.
Über Juda wird am meisten ausgesagt, weil aus ihm der Messias kommen sollte. Vers 10 erfüllte sich zunächst in David. Doch seine volle Bedeutung bezieht sich auf Christus. Beim ersten Kommen legte der Herr Jesus durch seinen Opfertod die Grundlage für Ruhe und Frieden. Bei seinem zweiten Kommen in Herrlichkeit werden Ihm die Völker gehorchen.
Die beiden Söhne Sebulon und Issaschar sprechen von der Zeit, da Israel unter den Völkern zerstreut ist – eine Folge der Verwerfung ihres Messias!
Mit Dan wird die zukünftige Drangsalszeit beschrieben. Dann wird in Israel der Antichrist als hinterlistiger Regent regieren. – Weil Jakob sah, wie schrecklich diese Zeit sein würde, unterbrach er seine Worte und betete zu Gott (Vers 18).
Der Segen Jakobs (2)
Gad ist hier ein Bild des treuen Überrests aus Israel, der in der Drangsalszeit von allen Seiten bedrängt wird. Doch schliesslich wird der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen und die Glaubenden befreien.
Die Aussagen über Aser zeigen uns, wie Christus in der Zukunft dem Volk Israel Segen und Ruhe bringen wird.
Die Worte über Naphtali reden von der Freude, die die befreiten Israeliten dann geniessen werden.
Der Segen Jakobs über Joseph weist vor allem auf Christus hin. Der Ausdruck «Sohn eines Fruchtbaums am Quell» spricht vom Leben des Herrn Jesus, das Frucht zur Ehre und Freude Gottes brachte. Der Segen aus seinem Erlösungswerk überstieg die «Mauer» des Volkes Israel, denn Er ist der Heiland der Welt. «Sein Bogen blieb fest», so dass Er am Kreuz einen endgültigen Sieg über Satan, die Sünde und die Welt errang. In Vers 24b werden zwei Titel unseres Herrn erwähnt: Er ist der Hirte und der Stein Israels. Auch in den Versen 25 und 26 finden wir Hinweise auf Christus. Der Abgesonderte unter seinen Brüdern lässt uns an Hebräer 7,26 denken.
In Benjamin sehen wir die Macht von Jesus Christus im zukünftigen Gericht.
Was Jakob in 1. Mose 47,29.30 bereits mit Joseph besprochen hatte, forderte er jetzt auch von allen seinen Söhnen: Sie sollten ihn im Erbbegräbnis seiner Väter, in der Höhle von Machpela bei Hebron, begraben. Das war sein letzter Wunsch. Dann nahm Gott ihn zu sich.
Jakob wird in Kanaan begraben
Diese Verse machen noch einmal deutlich, was für eine hohe Stellung Joseph im Land Ägypten einnahm. Der Körper Jakobs wurde so behandelt, als ob er eine hochgestellte Persönlichkeit im Reich des Pharaos gewesen wäre. Wie gross war die Trauer, die für ihn veranstaltet wurde!
Dann bat Joseph den Pharao um die Bewilligung, den Schwur gegenüber seinem Vater einzulösen. Der Pharao antwortete positiv: «Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, so wie er dich hat schwören lassen.» So wurde der Körper Jakobs mit einem sehr grossen Trauerzug von Ägypten nach Kanaan überführt und in der Höhle des Feldes Machpela begraben.
Was war der tiefe Grund für diese Anordnungen Jakobs gegenüber seinen Söhnen? Die Gläubigen im Alten Testament wussten noch wenig über das Jenseits. Aber sie glaubten an die Auferstehung. Jakob wollte bei seinen Vätern begraben sein, denn er erwartete wie sie die Auferstehung und die himmlische Stadt (Hebräer 11,13-16). Wenn der Herr Jesus zur Entrückung aller Gläubigen wiederkommen wird, werden auch die Glaubenden des Alten Testaments zum Leben auferstehen (Johannes 5,28.29; 1. Thessalonicher 4,16).
Dass Jakob in Kanaan begraben sein wollte, zeigt auch, dass er an die Verheissung Gottes für seine Nachkommen glaubte. Auch wenn sie für eine Zeit in Ägypten wohnten und dort ein grosses Volk wurden, war doch Kanaan das Land, das ihnen verheissen war. Gott würde es ihnen zu seiner Zeit zum Besitztum geben.
Bekenntnis und Vergebung
Nach dem Tod ihres Vaters kamen die Brüder Josephs nochmals zu ihm und baten ihn: «Ach, vergib doch die Übertretung deiner Brüder und ihre Sünde!» Sie hatten noch keinen inneren Frieden. Mit Tränen antwortete Joseph ihnen: «Fürchtet euch nicht!» – So wird es einmal dem gläubigen Überrest Israels in der Zukunft ergehen. Sie werden erst dann das Bewusstsein der vollen Vergebung ihres Messias haben, wenn Er sie in den Segen des Reichs einführen und ihnen damit erklären wird, dass ihre Schuld gesühnt ist (Jesaja 40,2).
Wir Christen dürfen im Glauben auf ein vollbrachtes Erlösungswerk zurückblicken und wissen: Alle unsere Sünden sind gesühnt. Wir haben neues, ewiges Leben empfangen. Wir haben Frieden mit Gott und sind seine geliebten Kinder. Mit dieser Heilsgewissheit im Herzen wollen wir das Danken nie vergessen!
Auch Joseph wusste, dass die Endbestimmung der Nachkommen Jakobs nicht Ägypten, sondern Kanaan war. Deshalb ordnete er an, dass die Israeliten, wenn sie als Volk das Land Ägypten viele Jahre später verlassen würden, seine Gebeine mitnehmen sollten. Den Zeitpunkt allerdings wusste Joseph nicht. Aber er war felsenfest davon überzeugt, dass Gott diese Verheissung einlösen und sein Volk nach Kanaan bringen würde.
Als es schliesslich so weit war und Israel aus Ägypten zog, nahm Mose die Gebeine Josephs mit sich (2. Mose 13,19). Unter Josua wurden sie in Sichem auf dem Feld begraben, das Jakob einst gekauft hatte (Josua 24,32).
Ein kurzer Überblick
Kapitel 1 – 2: Hiob wird geprüft
- Durch verschiedene Unglücksfälle verliert Hiob seine Kinder und seinen gesamten Besitz. Schliesslich wird er schwer krank.
- Trotz dieser schweren Schläge hält Hiob an seinem Gott fest und sündigt nicht.
Kapitel 3 – 31: Hiob und seine drei Freunde
- Seine drei Freunde meinen, ein Unrecht im Leben Hiobs sei der Grund für sein Elend und seine Leiden.
- Hiob besteht auf seiner Gerechtigkeit und nimmt das Wort gegen Gott, weil er dessen Tun nicht versteht.
Kapitel 32 – 37: Elihu spricht zu Hiob
- Elihu weist Hiob für seine unbedachten Worte und sein Hadern gegen Gott zurecht.
- Elihu stellt Gottes Segensabsichten in seinem Handeln mit den Menschen vor.
Kapitel 38 – 41: Der Herr spricht zu Hiob
- Gott beschreibt viele Wunder in der Natur, um seine eigene Grösse vorzustellen.
- Dabei wird sich Hiob bewusst, wie klein er vor dem Allmächtigen ist.
Kapitel 42: Das Ende von Hiob
- Hiob demütigt sich vor Gott und verurteilt sein Fehlverhalten in der Prüfung.
- Gott segnet Hiob mit dem Doppelten von allem, was er vorher besessen hat.
Der Heilige Geist sendet aus
Wie wichtig ist die Belehrung und Auferbauung der Versammlung! Die Gläubigen brauchen geistliche Nahrung für ihr neues Leben. Sie sollten in den Gedanken Gottes, wie Er sie uns in seinem Wort offenbart und mitgeteilt hat, unterwiesen werden. Es ist der Herr selbst, der seiner Versammlung für diesen Dienst die nötigen Gaben schenkt (Epheser 4,11.12).
In Antiochien gab es verschiedene Personen, die als Propheten und Lehrer wirkten. Die fünf mit Namen genannten Brüder hatten alle eine andere Herkunft. Aber jetzt waren sie eins in Christus und dienten dem gleichen Herrn.
Doch sie dienten nicht nur, sie fasteten auch. Damit wird angedeutet, dass sie in ihrem Dienst ernsthaft nach dem Willen Gottes fragten. Sie wollten das tun, was nach seinen Gedanken war. Da machte ihnen der Heilige Geist klar, dass Er für zwei von ihnen – Barnabas und Saulus – einen besonderen Auftrag hatte.
In Vers 3 geht es nicht nur um die fünf genannten Diener des Herrn, sondern um die ganze örtliche Versammlung. Sie beteten und fasteten, um gemeinsam vor dem Herrn Klarheit über den Dienst von Barnabas und Saulus zu bekommen. Durch das Auflegen der Hände bezeugten sie, dass sie hinter ihnen und ihrem Dienst standen. Dann liessen sie die beiden ziehen.
Es war nicht die Versammlung in Antiochien, die die beiden Missionare aussandte, sondern Gott, der Heilige Geist. Aber die Versammlung hatte sich mit ihnen einsgemacht. Die erste Station war die Insel Zypern, das Geburtsland von Barnabas.
Auf Zypern
Die beiden Missionare nahmen Johannes Markus als Diener mit sich. Er sollte sich um die praktischen Belange kümmern, die es auf einer solchen Reise zu tun gab.
In Römer 1,16 wird vom Evangelium gesagt: «Es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen.» So gingen die beiden Verkündiger zunächst in die Synagogen der Juden und predigten dort das Wort.
Auf ihrer Reise durch die ganze Insel stiessen sie in Paphos, auf einen jüdischen Zauberer, der sich bei einem Staatsbeamten namens Sergius Paulus aufhielt. Dieser verständige Mann interessierte sich für das Wort Gottes. Doch der Teufel versuchte durch sein Werkzeug, den Zauberer Elymas, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Aber jetzt zeigte sich, wer der Stärkere ist, und die Verkündiger der frohen Botschaft standen auf seiner Seite. Ihr Herr, den sie den Menschen als Retter verkündigten, hat am Kreuz den Teufel besiegt. Der Widerstand, dem Paulus und Barnabas hier begegneten, kam von einem besiegten Feind. Mit apostolischer Vollmacht trat Paulus diesem Gegner des Herrn entgegen und sprach ein zeitliches Gericht über den Zauberer aus: Er wurde eine Zeit lang blind.
Die Auseinandersetzung, die sich vor dem hohen Beamten abspielte, blieb nicht ohne Wirkung auf ihn. Er glaubte an das, was er über den Herrn Jesus gehört hatte. Die Lehre, die er hörte, war zwar neu für ihn. Doch das, was er gerade erlebt hatte, bewies ihm den göttlichen Ursprung der Sache.

Verkündigung in der Synagoge
Von Zypern aus segelten Paulus und seine Begleiter nach Perge, das in der heutigen Türkei liegt. Dort erlebten sie eine Enttäuschung. Ihr Diener Johannes Markus verliess sie und kehrte nach Jerusalem zurück. War ihm der Dienst für den Herrn zu schwer? Waren die Anforderungen und Entbehrungen zu gross? Gottes Wort sagt nichts Konkretes dazu. Aber die Bemerkung in Apostelgeschichte 15,38 lässt doch den Schluss zu, dass er aus dem Dienst für den Herrn davongelaufen war.
In der nächsten Stadt, in Antiochien in Pisidien, suchten Barnabas und Paulus am Sabbat wieder die Synagoge auf. Ab Vers 16 gibt uns der Heilige Geist den Wortlaut der Predigt wieder, die Paulus in jener Synagoge gehalten hat. Sie gibt uns ein Muster davon, wie er wohl auch an anderen Orten in den Synagogen gesprochen hat. Dabei wandte er sich sowohl an die Menschen aus dem Volk Israel als auch an die Proselyten, d.h. an Menschen aus den Nationen, die Gott fürchteten und sich dem Judentum zugewandt hatten.
Im ersten Teil seiner Rede skizzierte Paulus kurz die Geschichte Israels vom Auszug aus Ägypten bis auf David, den König nach den Gedanken Gottes. Damit kam er auf die Hauptperson seiner Verkündigung zu sprechen: auf Jesus, den Sohn Davids. Die von Johannes dem Täufer angekündigte Person war der von Gott verheissene Retter Israels. Jesus war der Messias, der weit über Johannes dem Täufer stand. Dieser sagte von dem nach ihm Kommenden: Ich bin nicht würdig, Ihm den geringsten Sklavendienst zu tun.
Christus – gestorben und auferstanden
Nachdem Paulus den Herrn Jesus erwähnt hatte, zeigte er den Zuhörern, dass dieses Wort des Heils (die Botschaft vom gekommenen Erretter) für sie persönlich war. Die Verantwortung der Juden in der Zerstreuung war geringer als die der Juden in Jerusalem, die das Leben Jesu gesehen und seine Worte gehört hatten und Ihn doch kreuzigen liessen. Danach legten sie den gestorbenen Christus in eine Gruft.
Mit Vers 30 kommen wir zum Höhepunkt der Rede von Paulus: zur Auferstehung des Herrn Jesus. «Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt.» Obwohl die Juden in Jerusalem den Messias umgebracht hatten, war Er nicht im Grab geblieben. Er war auferstanden. Er hat die Verwesung nicht gesehen, wie dies in Psalm 16 vorausgesagt war. Die Auferstehung von Jesus Christus war der Beweis dafür, dass Er der Sohn Gottes ist (Vers 33; Römer 1,3.4).
Es war eine gewaltige Botschaft, die die Zuhörer in der Synagoge von Antiochien zu hören bekamen: Der von Gott verheissene Messias war tatsächlich gekommen, aber verworfen und gekreuzigt worden. Doch Er war auferstanden, Er lebte. Die Schriften des Alten Testaments, die dies vorausgesagt hatten, haben sich in Jesus Christus erfüllt.
Petrus hatte in seiner Rede am Pfingsttag ebenfalls Psalm 16 zitiert. Sowohl Petrus als auch Paulus machten deutlich, dass David in Psalm 16 nicht von sich gesprochen hatte. Er war ja gestorben. Es ging um Jesus Christus, den Messias, der die Verwesung nicht sah, weil Gott Ihn auferweckt hatte.
Grosses Interesse und Eifersucht
Zuletzt stellte Paulus seinen Zuhörern den Herrn Jesus als Heiland vor. Durch den Glauben an Ihn empfängt der Mensch Vergebung seiner Sünden. Der Glaubende wird durch seine Gnade gerechtfertigt, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist (Römer 3,22-24).
Bis dahin hatten die Menschen in Israel versucht, das Gesetz Moses zu halten, um dadurch vor Gott gerechtfertigt zu werden. Aber kein Mensch ist in der Lage, aus eigener Kraft jederzeit alle Forderungen des göttlichen Gesetzes zu erfüllen. Jetzt zeigte Paulus diesen Menschen den Weg, den die Gnade Gottes für jeden bereithält. Aber dazu ist Glauben nötig, echter Glauben an den verachteten, gekreuzigten, aber auferstandenen Jesus Christus und an sein am Kreuz vollbrachtes Erlösungswerk. Das Zitat aus dem Propheten Habakuk in Vers 41 warnte alle Zuhörer, doch nicht im Unglauben zu verharren.
Viele wollten diese Worte am nächsten Sabbat nochmals hören. Aber die Interessierten, die ihr Herz dem Evangelium geöffnet hatten, konnten nicht bis zum folgenden Sabbat warten. Sie folgten den beiden Missionaren sofort. Diese ermunterten sie, das Angebot der Gnade im Glauben anzunehmen und es festzuhalten. Man kann sich vorstellen, wie diese Predigt zum Stadtgespräch wurde. So etwas hatten die Leute noch nie gehört. Die Reaktion blieb nicht aus. Am nächsten Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören.
Annahme und Ablehung
Wie traurig ist die Reaktion der Juden! Anstatt sich über das grosse Interesse der Menschen für das Wort Gottes zu freuen, wurden sie eifersüchtig. Sie, die sich so viel auf das Gesetz Moses und ihren Gottesdienst einbildeten, wollten nicht einsehen, dass Gott jetzt für alle Menschen einen neuen Weg geöffnet hatte. Sie widerstanden der Gnade und lehnten den einfachen Weg des Glaubens an den Erretter Jesus Christus und an sein vollbrachtes Erlösungswerk ab. Mit allem Ernst erklärten Paulus und Barnabas diesen eifersüchtigen Juden, sie würden sich nun den Nationen zuwenden. Sie belegten ihre Entscheidung mit einem Wort aus dem Alten Testament (Jesaja 49,6). Mit dem Kommen des Messias sollte das Evangelium auch zu den Nationen gelangen. Er war wirklich der Heiland der Welt.
Die Zuhörer aus den Nationen freuten sich, dass diese Botschaft der Gnade auch ihnen galt. Sie glaubten an den Herrn Jesus und empfingen ewiges Leben. Auch in der Umgebung der Stadt Antiochien verbreitete sich das Wort des Herrn.
Wo der Herr ein Werk hat, versucht der Feind zu stören und zu hindern. So dauerte es hier nicht lange, bis eine von den Juden angezettelte Verfolgung gegen Paulus und Barnabas einsetzte und sie aus ihrem Gebiet vertrieben wurden. Indem sie den Staub von ihren Füssen gegen sie abschüttelten, handelten sie nach dem Wort des Herrn in Lukas 9,5. Die gläubig gewordenen Menschen – Jünger genannt – freuten sich über ihre Errettung und wurden mit Heiligem Geist erfüllt.
Widerstand in Ikonium
In Ikonium, der nächsten Station ihrer Reise, suchten die beiden Missionare wieder zuerst die Synagoge auf. Auch dort nahmen viele Menschen – Juden und Griechen – die Botschaft im Glauben an. Doch der Feind liess nicht locker. Er bekämpft bis heute das Werk des Herrn, wo immer es vor sich geht. Der Widerstand ging wieder von den ungläubigen Juden aus, die auch viele aus den Nationen als Gegner der Christen gewinnen konnten. Aber der Herr liess diesmal nicht zu, dass seine beiden Knechte sofort vertrieben wurden. Sie konnten trotz des Widerstands lange Zeit freimütig das Evangelium verkündigen. Gott bekannte sich durch Zeichen und Wunder zur Botschaft der Gnade.
Dann geschah das, was bis heute immer wieder passiert: Am Herrn Jesus scheiden sich die Geister. «Die Menge der Stadt aber spaltete sich.» Ein Teil der Einwohner hielt sich zu denen, die dem Herrn Jesus widerstanden, die anderen waren mit denen, die Ihn als Retter verkündigten. Sie glaubten an das Evangelium, oder standen ihm zumindest positiv gegenüber.
Der Herr liess nicht zu, dass seine Diener misshandelt und umgebracht wurden. Er sorgte dafür, dass sie früh genug vom geplanten ungestümen Angriff hörten und fliehen konnten. Der Widerstand und die Verfolgung hinderten sie aber nicht, ihren vom Herrn empfangenen Auftrag fortzusetzen. In Lystra und Derbe angekommen, verkündigten sie auch dort das Evangelium. Welch ein Eifer für die Sache des Herrn!
Die Heilung des Gelähmten
In Lystra gab es unter den Zuhörern einen schwer behinderten Mann, der von Geburt an gelähmt war. Mit grösster Aufmerksamkeit folgte er dem, was der fremde Mann verkündigte. Paulus erkannte, dass der Mann Glauben hatte, geheilt oder gerettet zu werden. Er muss auch gemerkt haben, dass es Gottes Wille war, dass dieser Gelähmte geheilt wurde. So rief er ihm mit lauter Stimme zu: «Stelle dich gerade hin auf deine Füsse!» Der Glaubende gehorchte sofort und empfing die nötige Kraft, um aufzuspringen. – So ist es auch in geistlicher Hinsicht. Wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, wird der Herr uns die geistliche Kraft schenken, es praktisch auszuleben.
Nun meinten die Volksmengen, die Götter seien zu den Menschen gekommen. Paulus und Barnabas verstanden wohl nicht, was die Menschen auf Lykaonisch riefen. Als sie jedoch merkten, dass die Leute sie als Götter verehren und ihnen opfern wollten, reagierten sie sofort. Sie waren keine Götter, sondern Menschen wie sie. Aber sie wollten ihnen den einen wahren Gott verkündigen. Die Griechen stellten sich vor, ihre Götter lebten auf dem Olymp und kümmerten sich nicht um die Menschen. Der wahre Gott aber, der der Schöpfer von allem ist, hat das Wohl seiner Geschöpfe am Herzen. Obwohl sie Ihn nicht ehrten, hatte Er ihnen als ihr Erhalter viel Gutes getan.
Trotz dieser klaren Worte wollten die Leute ihnen opfern. Sich von den nichtigen Götzen zum lebendigen Gott zu bekehren, ist immer eine Sache des Glaubens. Aber so weit waren die meisten noch nicht.
Rückkehr nach Antiochien
Wie gross war der Hass der ungläubigen Juden gegenüber Paulus und seiner Botschaft! Sie wehrten sich gegen den Gedanken, dass Gottes Gnade auch für die Nationen war (Apostelgeschichte 22,21.22). In 1. Thessalonicher 2,15.16 schreibt Paulus: Sie gefallen Gott nicht, sind allen Menschen entgegen und wehren uns, zu den Nationen zu reden. In Lystra gelang es den Juden, die Menschen, die Paulus und Barnabas kurz vorher als Götter verehren wollten, derart aufzustacheln, dass sie Paulus steinigten. Doch die gute Hand Gottes war über ihm. So blieb er am Leben. Sein Dienst war noch nicht zu Ende.
Die letzte Station war Derbe. Nachdem sie auch dort das Evangelium gepredigt hatten, kehrten sie auf dem Weg, den sie gekommen waren, nach Perge zurück. Auf dem Rückweg arbeiteten die beiden nicht mehr als Evangelisten. Jetzt betätigten sie sich als Hirten und Lehrer, indem sie die Jünger geistlich befestigten. Sie ermahnten sie, auf dem Glaubensweg zu verharren, auch wenn es Drangsale gab. Solches ist für den, der dem Herrn Jesus treu nachfolgen möchte, nichts Abnormales (2. Timotheus 3,12). Bevor sie diese Jünger, die sich erst vor Kurzem bekehrt hatten, verliessen, befahlen sie sie dem Herrn an, an den sie geglaubt hatten.
Schliesslich kamen Paulus und Barnabas an ihren Ausgangspunkt, nach Antiochien in Syrien, zurück. Vieles hatten sie den dortigen Gläubigen zu erzählen! Sie rühmten die Führung und Bewahrung Gottes, die sie erfahren hatten. Aber vor allem berichteten sie von der Bekehrung derer aus den Nationen.
Ein falsches Evangelium
Nun startete der Feind Gottes einen neuen Angriff auf die gläubigen Christen. In Antiochien tauchten auf einmal Leute auf, die Verkehrtes lehrten. Sie behaupteten, die Gläubigen aus den Nationen müssten äusserlich Juden werden, um errettet zu werden. Sie wollten das Halten des Gesetzes Moses mit der souveränen Gnade vermischen. Wir können uns vorstellen, wie Paulus und Barnabas solchen Ideen entschieden widerstanden. Es entstand ein ernster Zwiespalt. Was war da zu tun?
Die Versammlung in Antiochien entschied, Paulus und Barnabas mit einigen Brüdern nach Jerusalem zu senden, um diese Streitfrage dort zu besprechen. Es ging darum, dass es zwischen Jerusalem und Antiochien keine Trennung gab. Es hätte die Versammlung Gottes gespalten.
Auf dem Weg nach Jerusalem erzählten die beiden Missionare von der Bekehrung derer aus den Nationen. Götzendiener waren durch den Glauben an Jesus Christus errettet und als Glieder zum Leib des Christus, zur Versammlung, hinzugefügt worden. Überall gab es grosse Freude.
Auch in Jerusalem berichteten sie von dem, was Gott unter den Nationen gewirkt hatte. Alle hörten es: die Versammlung, die Apostel und die Ältesten. Einige von den gläubig gewordenen Pharisäern hatten Mühe damit. Sie waren der Überzeugung, alle Christen müssten auch noch das Gesetz Moses halten und sich äusserlich zum Judentum bekennen. Obwohl sie an Christus glaubten, hielten sie noch sehr am Judentum fest.
Besprechung in Jerusalem
Der Widerstand der gläubig gewordenen Pharisäer gegen den Bericht von Paulus und Barnabas über das Wirken Gottes unter den Heiden machte eine Besprechung nötig. So kamen die verantwortlichen Brüder (die Apostel und Ältesten) der Versammlung von Jerusalem mit den Missionaren und Brüdern von Antiochien zusammen, um diese Sache zu behandeln. Nach einer fruchtlosen Diskussion benutzte der Heilige Geist den Apostel Petrus, um göttliches Licht auf die Angelegenheit zu werfen. Er erzählte noch einmal von den Ereignissen im Haus des Römers Kornelius.
Was war damals geschehen? Gott, der die Herzen kennt, antwortete auf den Glauben jener Zuhörer aus den Nationen, indem Er ihnen den Heiligen Geist gab. Gott machte also keinen Unterschied. Alle, die das Evangelium im Glauben annahmen – sowohl die aus den Juden als auch die aus den Nationen –, empfingen den Heiligen Geist. Das Entscheidende war der Glaube, nicht das Einhalten gesetzlicher Vorschriften.
Wie ernst sind die Worte in Vers 10! Da wollten Menschen den Glaubenden etwas Zusätzliches auferlegen, das sich längst als ein untaugliches Mittel erwiesen hatte, um vor Gott gerecht zu werden. «Christus ist das Ende des Gesetzes» (Römer 10,4). Er hat durch sein Kommen die Zeitperiode des Gesetzes abgeschlossen. Wer sich vom Gesetz abwendet und sich im Glauben zu Christus hinwendet, bekommt die Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Nur Jesus Christus ist jetzt der Weg zu Gott, und zwar für alle Menschen.
Christliche Freiheit
Nachdem die Missionare ihren Bericht beendet hatten, ergriff eine weitere wichtige Person das Wort. Es war Jakobus, ein leiblicher Bruder des Herrn Jesus, der als Säule und Stütze in der Versammlung von Jerusalem angesehen wurde (Galater 1,19; 2,9).
Er sprach von einem Volk, das Gott für seinen Namen aus den Nationen nehmen wollte. Damit ist das himmlische Volk Gottes, die Versammlung, gemeint. In der Anfangszeit bestand sie zwar hauptsächlich aus gläubigen Menschen aus den Juden. Heute aber kommen die meisten gläubigen Christen aus den Nationen.
In Vers 16 spricht Jakobus von einem Danach. Die Zeit der Versammlung wird einmal zu Ende gehen – heute stehen wir kurz vor diesem Abschluss. Dann wird Gott sich erneut dem Volk Israel zuwenden. Im Tausendjährigen Reich, wovon dieses Zitat aus dem Propheten Amos handelt, wird Israel unter der Herrschaft des Messias im Zentrum der Gedanken Gottes stehen.
Aber in der jetzigen Zeit, da Gott seine Versammlung auf der Erde hat, sollten den Glaubenden keine weiteren Gesetze auferlegt werden als vier göttliche Anordnungen, die durch alle Zeitalter hindurch Gültigkeit haben (z.B. 1. Mose 9,4).
Mit dem, was zwei führende Brüder in Jerusalem – Petrus und Jakobus – erklärten, sorgte Gott dafür, dass diese wichtige Angelegenheit schriftgemäss geordnet wurde. Viele gläubige Christen aus den Juden hatten Mühe, das aufzugeben, worin sie bis dahin gelebt hatten. Doch die Zeit des Gesetzes war zu Ende.
Mitteilung an die Gläubigen
Das Problem wurde im Kreis der Apostel und Ältesten besprochen. Aber nun fasste die ganze Versammlung einen Beschluss. Sie schrieben einen Brief an die Gläubigen aus den Nationen und sandten ihn durch zwei führende Brüder, die das Besprochene bezeugen konnten, mit Paulus und Barnabas nach Antiochien. Den Wortlaut des Briefes hat Gott uns in seinem Wort aufbewahrt.
Zunächst erklärten sie, dass die Männer, die die Gläubigen in Antiochien beunruhigt hatten, keinen Auftrag von der Versammlung gehabt hatten. Im Gegensatz zu diesen, die etwas Verkehrtes lehrten, waren die Begleiter von Barnabas und Paulus von der Versammlung für diesen Dienst ausgewählt worden. Wie schön ist das Zeugnis, das sie den beiden Missionaren ausstellten! Sie hatten unter Einsatz ihres Lebens dem Herrn gedient.
Der Beschluss selbst war unter der Wirkung des Heiligen Geistes gefasst worden. Er ist bis heute gültig. Kein Christ ist gehalten, das Gesetz zu erfüllen. Es ist auch nicht seine Lebensregel. Gott möchte nicht, dass Gesetz und Gnade irgendwie vermischt werden. Damit würde der einzige Weg der Errettung durch den Glauben an das Erlösungswerk des Herrn Jesus in Frage gestellt. – Die vier aufgezählten Verbote Gottes gelten für die Gottesfürchtigen aller Zeiten: das Essen von Blut, wozu auch der Genuss von Ersticktem gehört, das Vergehen gegen den eigenen Körper und gegen die Ehe, und das Abweichen von Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, zu einem Götzen.
Paulus trennt sich von Barnabas
In Antiochien löste der Brief grosse Freude aus. Auch das mündliche Zeugnis der beiden Abgesandten trug zur Ermunterung und Stärkung der Gläubigen bei. Durch Gottes Gnade war ein Angriff Satans auf die Einheit der Versammlung und auf die Alleingültigkeit des Erlösungswerks abgewehrt worden. Aus dem Galater-Brief und aus anderen Stellen in den Briefen des Apostels Paulus geht hervor, dass die Gefahr der Vermischung von Gesetz und Gnade nicht endgültig gebannt war. Menschen mit jüdischem Hintergrund versuchten später – leider mit Erfolg – weiterhin, diese verkehrte Lehre einzuführen.
Für eine gewisse Zeit wirkten Paulus und Barnabas neben anderen in Antiochien. Aber dann schlug Paulus vor, die Versammlungen aufzusuchen, die auf der ersten Reise entstanden waren. Wegen Johannes Markus, der auf der ersten Reise in seinem Dienst versagt hatte, trennten sich leider die beiden Diener des Herrn. Ihre Meinungen über diesen jungen Mann gingen auseinander. Für Paulus war der Moment noch nicht gekommen, ihn wieder im Werk des Herrn zu beschäftigen. Doch die Zeit kam, da Johannes Markus völlig hergestellt war und der Apostel Paulus über ihn schreiben konnte: «Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst» (2. Timotheus 4,11).
Barnabas und Markus reisten, ohne die Versammlung hinter sich zu haben, nach Zypern. Der neue Begleiter von Paulus war Silas. Sie zogen, «von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen», in Richtung Derbe und Lystra.
Die Befestigung der Versammlungen
In der Versammlung von Lystra fanden die beiden Diener des Herrn einen jüngeren Mann mit Namen Timotheus. Seine Mutter war Jüdin, sein Vater ein Grieche. Sie war gläubig, vom Vater wissen wir es nicht.
Timotheus hatte ein gutes Zeugnis von zwei Versammlungen. Man kannte ihn als einen treuen Jünger des Herrn Jesus. Er hatte sich an seinem Wohnort bewährt. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, dem Herrn in einem grösseren Arbeitsfeld zu dienen: als Mitarbeiter und Begleiter des Apostels der Nationen.
Warum beschnitt Paulus diesen Mann? Handelte er damit nicht gegen den Beschluss von Jerusalem, der den Gläubigen aus den Nationen keine weiteren gesetzlichen Forderungen auferlegte? Diese Beschneidung hatte nichts mit der Errettung zu tun, die Timotheus nur durch den Glauben an den Herrn Jesus empfangen hatte. Aber als beschnittener Sohn einer Jüdin hatte er Zugang zu den Juden, was für seinen Dienst wichtig und nützlich war (1. Korinther 9,20).
So zogen sie zu dritt weiter: Paulus, Silas und Timotheus. Überall, wo sie Gläubige trafen, teilten sie ihnen die Beschlüsse mit, die in Jerusalem festgesetzt worden waren. Auf diese Weise befleissigten sie sich, die Einheit des Geistes im Band des Friedens zu bewahren (Epheser 4,3). Die Besuche dieser drei Diener des Herrn dienten zur Befestigung der Versammlungen im Glauben. Gleichzeitig kamen weitere Menschen zum Glauben an den Erretter. So gab es ein inneres und ein äusseres Wachstum der Versammlungen.

Der Heiligen Geist führt nach Europa
In den Versen 6-10 zeigt uns der Heilige Geist ein interessantes Beispiel göttlicher Führung. Die Fortsetzung der Reise von Lystra führte die drei Knechte des Herrn durch weite Teile der heutigen Türkei, immer in Richtung Westen. Der Heilige Geist hinderte sie, in der Provinz Asien das Wort zu reden. Auch der Versuch, nach Bithynien zu reisen, wurde ihnen untersagt. War es verkehrt, in Asien das Evangelium zu verkündigen? Nein, ganz und gar nicht. Später wirkte Paulus drei Jahre lang in Ephesus (Apostelgeschichte 19,10; 20,31). Aber jetzt hatte der Herr etwas anderes im Sinn. In Troas wies Er dem Apostel Paulus durch einen Traum den Weg nach Europa. Nachdem dieser die Sache mit seinen Begleitern besprochen hatte, zogen alle den Schluss, dass Gott sie nach Mazedonien rief.
In Philippi gab es keine Synagoge, aber einen Gebetsort an einem Fluss ausserhalb der Stadt. Diesen suchten sie am Sabbat auf. Dort trafen sie nur Frauen, die zusammengekommen waren. Wo blieb der mazedonische Mann, den Paulus im Traum gesehen hatte?
Eine dieser Frauen, eine begüterte Purpurhändlerin aus Thyatira, hörte aufmerksam zu, als Paulus ihnen das Evangelium verkündete. Ähnlich wie bei Kornelius war sie für die Botschaft zubereitet. Der Herr öffnete ihr Herz und schenkte ihr den Glauben an Ihn. Nachdem sie getauft worden war, zeigte sich das neue Leben, das sie empfangen hatte: Sie lud die fremden Männer in ihr Haus ein. Die Bruderliebe ist ein Kennzeichen derer, die aus Gott geboren sind (1. Johannes 3,10.14).
Widerstand in Philippi
Es scheint, dass die Verkündiger der frohen Botschaft jenen Gebetsort am Fluss regelmässig aufsuchten. Doch nun regte sich der Widerstand Satans. Wie immer war er auch hier auf dem Plan, um dem Werk des Herrn zu schaden. Er benutzte dazu eine arme Sklavin, die einen Wahrsagegeist hatte, also dämonisch belastet war.
In Philippi trat der Feind nicht mit offenem Widerstand gegen Paulus auf, wie wir das bisher gesehen haben. Hier wirkte er als Engel des Lichts. Oberflächlich gesehen unterstützte er die Diener des Herrn. Aber die Frau sagte kein Wort vom Herrn Jesus, dem Erretter. Doch das Heil für die Menschen gründet sich einzig und allein auf Ihn und sein Erlösungswerk. Paulus erkannte die Stimme des Feindes und gebot dem bösen Geist im Namen Jesu Christi von der Frau auszufahren.
Jetzt änderte der Teufel seine Taktik. Als brüllender Löwe sorgte er dafür, dass Paulus und Silas mit Ruten blutig geschlagen und ins innerste Gefängnis geworfen wurden. Auslöser für diese heftige Reaktion waren die Herren dieser Sklavin, die durch ihre Wahrsagerei an ihr verdient hatten. Nun war dies plötzlich zu Ende. Ihre Wut war gross.
Ohne die Sache näher zu untersuchen, behaupteten sie, Paulus und Silas seien Juden, die mit ihrer Botschaft die ganze Stadt verwirrten. Da sie das Wirken von Paulus und Silas als Angriff auf sie als Römer ausgaben, fanden sie bei den höchsten Beamten der Stadt Gehör. Ohne Prozess wurden die beiden wie die schlimmsten Verbrecher behandelt.
Das Erdbeben
Es war für Paulus und Silas bestimmt schwer, mit blutendem Rücken, die Füsse fest in den Stock geschlossen, im innersten Gefängnis zu sitzen. Sie waren doch dem Willen des Herrn gefolgt und hierher gekommen. Und jetzt? – Nach einigen notvollen Stunden im Kerker kamen ihre Herzen beim Herrn zur Ruhe. Nun konnten sie beten und sogar lobsingen. So etwas kann nur der Herr in den Seinen zustande bringen. Für die anderen Gefangenen war dies etwas Einmaliges. Solches hatten sie noch nie erlebt. Dann folgte Gottes Antwort auf den Lobgesang der Seinen: Ein Erdbeben erschütterte das Gefängnis so stark, dass sich alle Türen öffneten und alle Fesseln lösten. Welch ein Schrecken für den Kerkermeister, der für die Gefangenen verantwortlich war! Mit einem Selbstmord wollte er der Vergeltung für die entlaufenen Gefangenen zuvorkommen. Doch Paulus konnte ihn vor dieser schrecklichen Sünde zurückhalten.
Nun fiel der grausame Gefängnisaufseher innerlich gebrochen vor Paulus und Silas nieder. Zitternd fragte er: «Was muss ich tun, um errettet zu werden?» Ein göttliches Erdbeben hatte sein Herz und Gewissen zutiefst erschüttert. Diesem Mann mussten die Diener des Herrn nicht mehr die Buße vorstellen. Sie konnten ihn direkt auf den Herrn Jesus hinweisen. Der Mann und alle, die in seinem Haus waren, hörten das Wort des Herrn, glaubten und wurden getauft. Das neue Leben, das Gott ihnen schenkte, zeigte sich sofort: Er nahm die beiden Gefangenen zu sich, wusch ihnen die Striemen ab und bewirtete sie.
Ausweisung aus Philippi
Gottes Wort sagt uns nicht, weshalb die Stimmung bei der obersten Stadtbehörde von Philippi umgeschlagen hatte und sie die beiden Gefangenen freilassen wollten. Hatte das Erdbeben auch sie erschüttert? Der bekehrte Kerkermeister gab die erhaltene Botschaft an Paulus weiter. Doch der Apostel akzeptierte diese Behandlung nicht. Warum nicht?
Es ging ihm nicht um ihn, sondern um die junge Versammlung in Philippi. Hätten die beiden einen Vorteil für sich gesucht, dann hätten sie am Tag zuvor schon ihr römisches Bürgerrecht geltend machen und den Rutenschlägen entgehen können. Wenn sie aber jetzt öffentlich rehabilitiert wurden und dann die Stadt verliessen, kam dies auch dem Ansehen der gläubigen Christen in Philippi zugut. Deshalb die Antwort von Paulus in Vers 37.
Zur Wirkung des Erdbebens kam bei den Hauptleuten jetzt noch die Furcht dazu, römische Bürger ohne Prozess geschlagen zu haben. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf den Wunsch von Paulus einzugehen und sie höflich aus der Stadt hinauszubegleiten.
Paulus und Silas waren bereit, Philippi zu verlassen, doch nicht ohne vorher ins Haus der Lydia zu gehen und sich von den Brüdern zu verabschieden. In der kurzen Zeit, in der Paulus und Silas in Philippi wirken konnten, hatte sich eine ganze Anzahl Menschen bekehrt. Sie bildeten nun die dortige örtliche Versammlung. Nach relativ kurzer Betreuung durch die Diener des Herrn waren sie jetzt auf sich gestellt. Doch der Herr war ihr Mittelpunkt und sorgte für sie.
Paulus und Silas in Thessalonich
In Apostelgeschichte 16,10-16 ist der Text in der Wir-Form abgefasst. Jetzt in Kapitel 17 geht der Bericht wieder in der dritten Person Mehrzahl weiter. Wir können daraus schliessen, dass Lukas, der inspirierte Schreiber der Apostelgeschichte, den Apostel Paulus auf der Reise von Troas nach Europa begleitet hatte. Doch jetzt war er in Philippi geblieben.
Die nächste grosse Stadt war Thessalonich. Dort gab es eine Synagoge, die der Apostel nach seiner Gewohnheit als Erstes aufsuchte. An drei Sabbaten war es ihm möglich, den Zuhörern aus den Schriften des Alten Testaments zu zeigen, dass der angekündigte Messias leiden und sterben, aber dann aus den Toten auferstehen musste. Der zweite Hauptpunkt seiner Botschaft lautete: Jesus, der vor Kurzem gelebt hatte und von den Juden in Jerusalem umgebracht worden, aber nach drei Tagen auferstanden war, ist der Christus. Einige Juden liessen sich überzeugen. Viele von den Griechen, die sich dem Judentum zugewandt hatten, glaubten.
Das erweckte den Neid der ungläubigen Juden. Mit Hilfe von bösen Männern aus dem Gassenpöbel inszenierten sie einen Volksauflauf. Doch der Herr sorgte dafür, dass Paulus und Silas nicht in die Hände dieser gewalttätigen Menschen fielen. Aber Jason und einige Brüder wurden vor die Obersten der Stadt geschleppt. Die Anklage gegen die Missionare stimmte nicht. Sie wiegelten weder den Erdkreis auf, noch handelten sie gegen den Kaiser. Denken wir an das Wort des Herrn in Lukas 20,25!
Es geht weiter nach Beröa und Athen
Noch in der gleichen Nacht verliessen Paulus und Silas die Stadt Thessalonich und reisten nach Beröa weiter. Die Juden in jener Synagoge waren edler als die in Thessalonich. Sie verglichen die Botschaft, die ihnen verkündigt wurde, mit dem geschriebenen Wort Gottes. Weil sie die Sache bestätigt fanden, nahmen sie sie im Glauben an. Hier waren es nicht nur einige (Vers 4), sondern viele. Auch von den griechischen Frauen und Männern glaubten viele an das Evangelium.
Aber der Feind ruhte nicht. Er benutzte die ungläubigen Juden aus Thessalonich, um auch in Beröa eine Verfolgung gegen Paulus anzuzetteln. Diesmal reiste Paulus allein weiter nach Athen. Silas und Timotheus blieben in Mazedonien. Sie folgten dem Apostel später. – Aus dem ersten Thessalonicher-Brief geht hervor, dass Timotheus von Athen aus einen Besuch in Thessalonich machte, um die Gläubigen zu befestigen und zu trösten. Er kam mit einem guten Bericht zurück (1. Thessalonicher 3,1-8).
Während Paulus in Athen auf seine Mitarbeiter wartete, bedrückte ihn der schreckliche Götzendienst in jener Stadt. Er unterredete sich mit verschiedenen Leuten – Juden, Proselyten, Marktbesuchern und Philosophen –, bis einige merkten, dass er etwas für sie Unbekanntes verkündigte. Aus reiner Neugier wollten sie mehr über die neue Lehre wissen. So führten sie Paulus auf den Areopag, wo sich auch der athenische Gerichtshof befand. – Vers 21 zeigt, dass Athen nicht nur eine Stätte des Götzendienstes, sondern auch ein Sammelpunkt für menschliche Philosophie war.
Die Rede auf dem Aeropag
Der Apostel Paulus redete nicht gegen den Götzendienst der Griechen, aber er knüpfte dort an. Er hatte in der Stadt einen Altar gefunden, der dem unbekannten Gott geweiht war. Diesen verkündigte er ihnen, und zwar als den einzig wahren Gott, der auch der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Der lebendige Gott ist viel grösser und gewaltiger, als dass ein Mensch Ihn erfassen könnte. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut sind. Er hat auch nichts von ihnen nötig, da Er selbst der Geber von allem ist.
Die Menschen hätten in der Schöpfung erkennen sollen, dass Gott der Ursprung des Lebens und damit auch der Menschen ist. Er hat sie erschaffen. Doch sie haben das Göttliche auf ein menschliches Niveau herabgezogen und aus verschiedenen Materialien Götter ihrer eigenen Erfindung gemacht. Aber jetzt waren die Zeiten der Unwissenheit vorbei. Gott hatte sich in seinem Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden war, offenbart. Nun fordert Er alle auf, Buße zu tun und von ihrer Götterverehrung umzukehren, denn Er wird die Welt richten. Richter wird Der sein, der einst am Kreuz gestorben, aber aus den Toten auferstanden ist.
Warum verkündigte Paulus diesen Menschen nicht das Evangelium vom Heiland der Welt? Die Gewissen mussten zuerst aufgerüttelt werden, um ihnen die Heilsbotschaft zu sagen. Der Spott vieler zeigt, wie sie sich nicht beeindrucken liessen. Es gab einige, die glaubten. Ihnen konnte Paulus die von Gott geschenkte Errettung vorstellen.
Paulus kommt nach Korinth
Es scheint, dass die meisten Menschen in Athen nicht bereit waren, in aller Einfachheit an das Evangelium zu glauben. Sie hatten sich zu sehr dem Götzenkult und den verschiedenen menschlichen Philosophien geöffnet. Jedenfalls zog Paulus von Athen aus weiter nach Korinth. Das war eine ganz andere Stadt. Neben dem Götzendienst, den es auch hier gab, lebten die Menschen in groben Sünden (vergleiche 1. Korinther 6,9-11).
In dieser Stadt fand der Apostel ein jüdisches Ehepaar, bei dem er als Zeltmacher arbeiten konnte. Neben seiner theologischen Ausbildung – er hatte unter Gamaliel studiert (Apostelgeschichte 22,3) – hatte er auch einen handwerklichen Beruf erlernt. Mit dieser Tätigkeit konnte er, wenn es nötig wurde, seinen Lebensunterhalt selbst verdienen (Apostelgeschichte 20,34).
An den Sabbaten unterredete er sich in der Synagoge. Als Silas und Timotheus aus Mazedonien in Korinth eintrafen, bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist, den er ihnen aus den Schriften vorgestellt hatte. Das wollten viele nicht glauben, so dass Paulus sich nun den Nationen zuwandte. Justus, Krispus und ihre Angehörigen gehörten wohl zu den ersten Menschen, die in Korinth an den Herrn Jesus glaubten und seine Jünger wurden.
Weil die Mehrheit der Juden das Evangelium ablehnte, schenkte der Herr seinem Diener eine besondere Ermunterung. Er sollte sich durch den Widerstand nicht einschüchtern lassen, sondern reden und nicht schweigen. Der Herr selbst wollte mit ihm sein und ihn beschützen.
Widerstand und Weiterreise
Der Widerstand der Juden gegen das Evangelium liess nie nach. Es scheint, dass sie hier dachten, eine Gelegenheit zu haben, Paulus vor der römischen Gerichtsbarkeit anzuklagen. Doch bevor der Angeklagte etwas sagen konnte, zog der Richter bereits einen Schlussstrich unter die Sache. Mit Streitfragen der Juden über Worte, Namen und ihr Gesetz wollte er nichts zu tun haben. Mit dieser Haltung unterstützte der Richter eigentlich die Sache des Herrn. Hätten die Christen nach römischem Recht etwas Unrechtes getan, hätte er sich bestimmt mit dem Fall befasst. Doch dem war nicht so. Es scheint jedoch, dass die Menschen in Korinth auf die Juden nicht gut zu sprechen waren. Jedenfalls liessen sie ihre Wut an Sosthenes, dem Synagogenvorsteher aus. Doch dem Richter war das egal.
Ab Vers 18 wird uns vom weiteren Verlauf der Reise von Paulus berichtet. Aquila und Priszilla begleiteten ihn dabei. Aus Vers 21 wird klar, dass es sich um die Rückreise nach Jerusalem und Antiochien handelt. Weil er unbedingt zum Fest (vermutlich zum Pfingstfest) in Jerusalem sein wollte, machte er nur einen kurzen Halt in Ephesus, der Hauptstadt der Provinz Asien. Er versprach den Juden in Ephesus, nach seinem Besuch in Jerusalem wiederzukommen. In der Zwischenzeit blieben Aquila und Priszilla dort zurück. Sie hatten in der langen Zeit, da Paulus bei ihnen gewohnt und gearbeitet hatte, viel vom Apostel gelernt. Das durften sie jetzt in Ephesus weitergeben.

Apollos
Vers 23 beschreibt den Anfang der dritten Missionsreise des Apostels Paulus. Es lag ihm am Herzen, die entstandenen Versammlungen zu befestigen. Die geistliche Erbauung der Gläubigen ist auch heute ein wichtiges Thema. Wenn unser Glaubensleben stagniert, bedeutet dies oft Rückschritt. Zudem ist dann die Gefahr grösser, von verkehrten Lehren beeinflusst und vom Herrn abgezogen zu werden. Der Galater-Brief zeigt, wie sehr der Feind den Jüngern in der galatischen Landschaft schaden konnte.
Während Paulus unterwegs war, tauchte in Ephesus ein begabter jüdischer Mann auf: Apollos. Er hatte eine sehr gute Schriftkenntnis, aber er wusste nicht alles über den Herrn Jesus. Das Zeltmacher-Ehepaar Priszilla und Aquila, die von Paulus belehrt worden waren, erkannten dies sofort. Sie luden ihn zu sich nach Hause ein «und legten ihm den Weg Gottes genauer aus». Dieser gelehrte Mann war demütig genug, auf das einfache Arbeiterpaar zu hören und von ihnen zu lernen. Sie selbst besassen nicht die Begabungen von Apollos. Aber da sie treu im Kleinen waren und ihm bei sich zu Hause geistlich weiterhalfen, leisteten sie einen wichtigen Beitrag am Werk des Herrn.
Als Apollos nach Achaja weiterreiste, konnten die Brüder ihn empfehlen. Anderseits war er selbst den Glaubenden eine Hilfe, und zwar mit seiner guten Kenntnis des Alten Testaments und mit dem, was er bei Priszilla und Aquila gelernt hatte. Ohne den treuen Dienst jenes Ehepaars hätte Apollos nicht so öffentlich für den Herrn Jesus eintreten können.
Paulus in Ephesus
Apollos hatte Ephesus bereits verlassen und war in Korinth tätig. Da erreichte Paulus auf seiner dritten Reise diese Stadt. Dort fand er zunächst einige Jünger, die ähnlich wie Apollos noch nicht die ganze christliche Wahrheit gehört hatten. Sie waren mit der Taufe des Johannes getauft worden. Das war eine Taufe zur Buße, durch die ein Jude zum Ausdruck brachte, dass er seine Sünden bekannt hatte und bereit war, den kommenden Messias zu empfangen (Matthäus 3,1-3). Seither war Christus gekommen, aber abgelehnt worden und am Kreuz gestorben. Am dritten Tag war Er auferstanden und nach 40 Tagen in den Himmel zurückgekehrt. Von dort hatte Er den Heiligen Geist auf die Glaubenden ausgegossen. Nachdem diese Jünger das ganze Evangelium gehört hatten, wurden sie mit der christlichen Taufe getauft. Da hier ein besonderer Umstand vorlag, legte Paulus ihnen die Hände auf. Er machte sich eins mit ihnen als Christen. Dann empfingen sie den Heiligen Geist.
Der Widerstand und die Ablehnung der ungläubigen Juden veranlassten Paulus, die Jünger des Herrn Jesus von der Synagoge abzusondern. Nun versammelten sie sich in der Schule des Tyrannus. Das wurde ein Ausgangspunkt für die Verbreitung des Wortes des Herrn in die ganze Provinz, deren Hauptstadt Ephesus war.
Die Botschaft ging an Juden und Griechen. Die Gnade bringt das Heil zu allen Menschen (Titus 2,11). Die Zeichen und Wunder, die Gott durch Paulus wirkte, unterstrichen und bestätigten das Verkündigte. Es war offensichtlich, dass Gott dahinter stand.
Wachstum trotz Widerstand
Diesmal suchte der Feind dem Wirken Gottes mit Nachahmung zu schaden. Jüdische Beschwörer versuchten, den Namen des Herrn Jesus zu missbrauchen und in diesem Namen ebenfalls böse Geister auszutreiben. Doch es misslang gründlich. Der satanische Geist offenbarte sein wahres Gesicht. Der von ihm besessene Mann zeigte den jüdischen Beschwörern den Meister. Sie konnten nur ihre nackte Haut retten.
Durch dieses Ereignis wurde allen bekannt, was für eine böse Macht der Teufel ist, dass aber der Herr Jesus stärker ist als Satan. Er hat ihn am Kreuz besiegt. Schliesslich wurde der Name des Herrn Jesus gerühmt. Nur in diesem Namen findet der Glaubende die nötige Kraft.
Das Geschehene brachte allen Jüngern zum Bewusstsein, wie schlimm sie vor ihrer Bekehrung versklavt waren. Es führte sie dazu, konsequent und radikal mit jeder Art von Okkultismus zu brechen. Sie bekannten ihre Taten und verbrannten ihre Zauberbücher in aller Öffentlichkeit. Nachdem dieses grosse Hindernis beseitigt war, «wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm überhand».
Die Verse 21 und 22 zeigen etwas von dem, was im Herzen des Apostels im Blick auf seinen zukünftigen Dienst vorging. Er hatte den grossen Wunsch, auch Rom zu sehen. Vorher aber nahm er sich vor, nach Jerusalem zu reisen. Andere Stellen des Neuen Testaments zeigen, dass er dabei eine Gabe der Gläubigen aus den Nationen den verarmten Glaubenden in Jerusalem bringen wollte (Römer 15,25-27).
Aufruhr in Ephesus
In der Apostelgeschichte wird an verschiedenen Stellen vom christlichen Bekenntnis, das sich zu jener Zeit sehr schnell ausbreitete, als «von dem Weg» gesprochen (Apostelgeschichte 9,2; 19,9.23; 24,14.22). Das war keine jüdische Sekte, wie gewisse Leute behaupteten, sondern etwas Neues, das Gott selbst gewirkt hatte. Doch solange Satan der Fürst und Gott dieser Welt ist, wird es Widerstand gegen die gläubigen Christen geben. So war es auch in Ephesus.
Immer mehr Menschen wurden vom Evangelium ergriffen, glaubten an den Herrn Jesus und kehrten dem Götterkult der Griechen den Rücken. Das bekamen auch die Silberschmiede in Ephesus zu spüren. Sie verkauften silberne Miniaturen des Tempels der Göttin Artemis, der in Ephesus stand. Ihr Umsatz ging spürbar zurück. Demetrius war entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen und der Verehrung der Göttin Artemis neuen Schwung zu geben. Wütend über den Verlust ihres Geschäfts schrien alle Betroffenen: «Gross ist die Artemis der Epheser!» Schliesslich kam die ganze Stadt in Aufruhr. Die Demonstranten rissen Gajus und Aristarchus, zwei Reisegefährten von Paulus, mit sich fort. Für Paulus selbst war es zu gefährlich, unter das Volk zu gehen. Es gab eine richtige Massenhysterie.
Doch der Herr liess die Seinen nicht im Stich. Sein Werkzeug war ein ungläubiger, aber menschlich weiser Mann: der Stadtschreiber. Er konnte die Menge beruhigen und ihr zeigen, dass die mitgerissenen Männer weder Tempelräuber waren noch die Göttin gelästert hatten. Dem Demetrius empfahl er den Rechtsweg.
Durch Mazedonien und Griechenland
Dass es damals in Ephesus für Paulus und seine Begleiter wirklich um Leben und Tod ging, zeigt auch der zweite Korinther-Brief (2. Korinther 1,8-16). Den ersten Korinther-Brief schrieb Paulus von Ephesus aus. Den zweiten schrieb er aus Mazedonien, wohin er infolge des Aufruhrs weitergereist war.
Über diesen Teil der Reise des Apostels Paulus – also von Ephesus über Mazedonien bis nach Griechenland und zurück durch Mazedonien bis nach Troas – berichtet uns die Bibel keine Einzelheiten. Es war vor allem ein Dienst an den Gläubigen in den Versammlungen, den er in jener Zeit ausübte. Den Widerstand der Juden bekam er trotzdem zu spüren. Durch Gottes Gnade konnte er ihrem Anschlag entrinnen.
In Vers 4 werden uns eine ganze Reihe gläubiger Männer mit Namen aufgezählt, die den Apostel begleiteten. Auch Lukas war wieder dabei, denn ab Vers 5 ist der Bericht in der Wir-Form gehalten. Für den Herrn Jesus waren sie bereit, mit dem Apostel die Reisestrapazen und die Feindschaft, die er von verschiedenen Seiten zu spüren bekam, zu teilen. Gott hat ihren Einsatz für die Sache des Herrn gesehen und ihre Namen in seinem ewigen Wort festgehalten. Welch eine Ehre!
Warum blieben sie sieben Tage in Troas? Vers 7 gibt uns die Antwort. Paulus wollte mit den Gläubigen in Troas am ersten Tag der Woche das Brot brechen und den Tod des Herrn verkündigen. Um am Sonntag nicht irgendwo unterwegs zu sein, wo es keine Versammlung gab, blieb er bis zum ersten Tag der Woche in Troas.
Ein Sonntag in Troas
Unter den Christen war es damals bereits üblich, am ersten Tag der Woche zum Brotbrechen zusammenzukommen. Sie brachen das Brot nicht mehr täglich, wie ganz am Anfang (Apostelgeschichte 2,46). Paulus benutzte diese Zusammenkunft der Gläubigen in Troas, um auch das Wort zu verkünden. Er hatte nicht mehr viel Zeit, denn er wollte am nächsten Tag abreisen. Daher dauerte seine Verkündigung bis Mitternacht.
Ein junger Mann sass im Fenster, während Paulus das Wort verkündete. Auf einmal wurde er vom Schlaf überwältigt, verlor das Gleichgewicht und fiel vom dritten Stock hinunter. Doch der Herr brachte in seiner Barmherzigkeit den jungen Mann ins Leben zurück – ein grosser Trost für alle! – Diese Geschichte enthält eine geistliche Belehrung für uns: Es ist für jeden von uns gefährlich, sich am Rand der Gläubigen aufzuhalten, sozusagen an der Grenze zur Welt. Man fällt dann leichter und schneller in eine Sünde. Möchten wir wachsam sein und uns nahe beim Herrn, dem Mittelpunkt der Gläubigen, aufhalten.
Ab Vers 13 wird die Weiterreise des Apostels beschrieben. Er wollte ein Stück zu Fuss gehen – vielleicht um mit seinem Herrn allein zu sein. Das Ziel von Paulus war das Pfingstfest in Jerusalem. Um rechtzeitig dort anzukommen, durfte er sich unterwegs nicht zu lange aufhalten. Warum wollte er unbedingt nach Jerusalem zurück? Lagen ihm seine eigenen Landsleute so sehr am Herzen? Wir können es annehmen. Doch der Herr hatte ihn eigentlich zu den Nationen gesandt (Apostelgeschichte 22,21; 26,17.18).
Die Abschiedsrede des Apostels
Auf seinem Weg nach Jerusalem entschloss sich Paulus, an Ephesus vorbeizureisen. Da er den dortigen Gläubigen aber noch Wichtiges zu sagen hatte, liess er die Ältesten von Ephesus nach Milet kommen. Was er ihnen mitteilte, hat Gott zu unserem Nutzen und zu unserer Belehrung in seinem Wort festgehalten.
Zunächst zeigen uns die Worte des Apostels etwas von seinem hingebungsvollen Dienst für den Herrn. In aller Demut, mit Tränen und unter ständigem Widerstand von aussen diente er Ihm und den Gläubigen. Er nahm keine Rücksicht auf sein Leben, auch wenn er eine Vorahnung über eine mögliche Gefangennahme hatte.
Seiner Rede können wir den inhaltlichen Umfang seiner Verkündigung entnehmen. Er hat den ungläubigen Menschen – sowohl Juden als Griechen – die Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus bezeugt. Denen, die an den Erlöser glaubten, sagte er das Evangelium der Gnade Gottes, d.h. er stellte den ganzen Umfang des Heils vor, das der Glaubende bei seiner Bekehrung empfängt. Weiter predigte er das Reich Gottes. Er zeigte den gläubig Gewordenen, dass sie unter der Regierung Gottes stehen. Ihr Heiland ist auch ihr Herr, der von den Seinen möchte, dass sie Ihm gehorchen und Ihm als Jünger nachfolgen. Schliesslich verkündigte er den ganzen Ratschluss Gottes. Das sind alle seine Pläne mit den Glaubenden. Gott hatte diese Pläne von Ewigkeit her in seinem Herzen. Sie betreffen jeden persönlich, aber auch die Gesamtheit der Erlösten, die zusammen die Versammlung Gottes bilden.
Gott und das Wort seiner Gnade
Der Apostel sah den Werdegang des christlichen Bekenntnisses voraus. Daher folgen jetzt Ermahnungen, die nicht nur für die damalige Zeit galten. Auch wir sollten sie zu Herzen nehmen. Der Versammlung Gottes, die Paulus als Herde bezeichnet, drohen Gefahren von aussen und von innen. Wenn er von seinem Abschied spricht, meint er damit sein Ableben. Ergänzend können wir sagen: Nach dem Ableben aller Apostel kamen böse, ungläubige Menschen und schadeten der Herde. Der Apostel bezeichnet sie als reissende Wölfe. Diese Gefahr besteht bis heute. Deshalb müssen wir Acht haben auf Menschen, die sich unter die Gläubigen mischen wollen. Aus welchen Motiven versuchen sie es? Die zweite Gefahr droht von innen. Männer «aus euch selbst» können aufstehen und falsche Lehren verbreiten. Wie oft hat sich dies seither bewahrheitet! Viele Christen sind durch Irrlehrer vom Herrn abgezogen worden und Anhänger von Menschen geworden.
Paulus hat die Gläubigen nicht Menschen anbefohlen, sondern Gott und dem Wort seiner Gnade. Darauf dürfen wir uns bis heute stützen. Unsere Bewahrung finden wir beim Herrn und im Festhalten seines Wortes. – Das praktische Leben des Apostels war ein leuchtendes Beispiel, das auch wir nachahmen dürfen. Wie weit haben wir schon gelernt, dass Geben seliger ist als Nehmen? – Der Abschied vom geliebten Apostel geschah unter Gebet und in rührender Zuneigung. Alle waren traurig. Sie merkten, dass sie ihn auf dieser Erde nicht mehr sehen würden.
Die Mitteilung über das Passah
Die Mitteilungen des Herrn über das Passahlamm enthalten viele bildliche Hinweise auf unsere Errettung vor dem göttlichen Gericht:
- Die neue Zeitrechnung für das Volk Israel deutet darauf hin, dass die Bekehrung ein Neuanfang in unserem Leben ist. Für Gott zählen nur die Tage, die wir als Erlöste leben.
- So wie jede israelitische Familie ein Lamm für sich nehmen musste, brauchten wir alle persönlich den Herrn Jesus als unseren Erretter.
- Das Lamm musste fehlerlos, männlich und einjährig sein. Ebenso ist Christus als sündloser Mensch in göttlicher Kraft auf dem Zenit seines Lebens für uns gestorben.
- Nachdem das Opfertier geschlachtet worden war, sollten die Israeliten das Blut an die beiden Pfosten und an den Türsturz ihres Hauses streichen. Diese Handlung spricht davon, dass wir durch den Glauben an das vergossene Blut des Herrn Jesus Schutz vor dem göttlichen Gericht gefunden haben.
- In der Nacht assen die Israeliten vom gebratenen Fleisch des Opferlamms. Auch das hat eine Bedeutung für uns: Wir beschäftigen uns mit unserem Heiland und denken daran, wie Er zu unserer Errettung am Kreuz gelitten hat und gestorben ist.
- «Sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen.» Gott sieht das Blut unseres Erlösers, das eine vollkommene Sühnung bewirkt hat. Darum hat Er uns bei der Bekehrung alle Sünden vergeben und sichert uns seither eine ewige Errettung vor dem Gericht zu.
Sieben Tage nichts Gesäuertes essen
«Dieser Tag soll euch zum Gedächtnis sein.» Nie sollte das Volk Israel den Tag vergessen, an dem es durch das Blut des Passahlamms vor dem göttlichen Gericht über die Erstgeburt verschont worden war. Darum gab Gott ihnen die Anweisung, jedes Jahr am 14. Tag des ersten Monats das Passah als Erinnerung an ihre Erlösung zu feiern.
Auch wir wollen uns immer wieder an unsere Errettung erinnern und dabei besonders an den Herrn Jesus denken. Welchen Preis hat Er bezahlt, um uns vor dem ewigen Gericht zu retten! Damit wir seine Leiden und sein Sterben am Kreuz nicht vergessen, hat Er selbst das Gedächtnismahl eingesetzt. Jeden Sonntag, wenn wir das Brot brechen, werden unsere Gedanken auf seinen Tod gelenkt.
Anschliessend an die Passahfeier sollten die Israeliten sieben Tage ungesäuertes Brot essen. Während dieser Zeit durfte in ihren Häusern kein Sauerteig gefunden werden. Ausserdem war am ersten und am siebten Tag jede Arbeit untersagt.
Der Apostel Paulus erklärt uns die geistliche Bedeutung davon: «Auch unser Passah, Christus, ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit» (1. Korinther 5,7.8). Weil der Herr Jesus uns durch seinen Opfertod errettet hat, sollen wir nun ein Leben zur Ehre Gottes führen. Das bedeutet, dass wir die Sünde in jeder Form konsequent verurteilen und täglich die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, um uns so zu verhalten, wie es Ihm gefällt.
Die Vorschrift des Passahs
In der Information an das Volk Israel erkennen wir die beiden wesentlichen Punkte unserer Errettung:
- Der Herr gab seinem Volk mit dem Lamm ein Rettungsmittel vor dem Tod der Erstgeborenen. – Genauso hat Gott den Herrn Jesus vor Grundlegung der Welt als Lamm zuvor erkannt und vor ungefähr 2000 Jahren am Kreuz für uns als Opfer gegeben (1. Petrus 1,18-20).
- Um vor dem Gericht in Sicherheit zu sein, mussten die Israeliten das Blut des Passahlamms an die Pfosten und den Türsturz streichen. – Auch wir müssen persönlich an den Erlöser Jesus Christus glauben, sonst nützt uns das Angebot Gottes nichts (Römer 3,22-26).
Mit der jährlichen Passahfeier erinnerte sich das Volk Israel an die Rettung vor dem Gericht und an die Befreiung aus Ägypten. Damit auch die nachfolgenden Generationen wussten, warum sie dieses Fest jedes Jahr feierten, sollten die Eltern es ihren Kindern erklären.
Da stellen sich uns zwei ernste Fragen: Wissen wir, warum wir jeden Sonntag das Gedächtnismahl des Herrn halten? Können wir unseren Kindern anhand des Wortes Gottes die Bedeutung des Brotbrechens erklären? Wenn wir am Sonntag mit unbeteiligtem Herzen in den Gottesdienst gehen, hat es wenig Wert für Gott und keine Überzeugungskraft für unsere Kinder.
Die Reaktion der Israeliten in Vers 28 ist sehr schön: Sie glaubten und gehorchten dem Wort Gottes. Sie folgten ihrem Führer, von dem es heisst: «Durch Glauben hat er das Passah gefeiert und die Besprengung des Blutes, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste.»
Die Erstgeborenen in Ägypten sterben
Weil sich der Pharao verstockt hatte und nicht bereit gewesen war, auf Gott zu hören, traf nun das furchtbare Gericht ein. Wie der Herr es angekündigt hatte, starb alle Erstgeburt im Land Ägypten. Daraus lernen wir zwei Grundsätze, die zu allen Zeiten gültig sind:
- Gott warnt immer, bevor Er bestraft. Leider wollen viele Menschen nicht auf seinen Warnruf hören. Ihnen gilt das ernste Wort: «Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht» (Hebräer 3,15).
- Obwohl Gott mit seinen Geschöpfen geduldig ist und oft lange wartet, bis Er mit Gericht einschreitet, kann es für eine Umkehr plötzlich zu spät sein. Darum heisst es in 2. Korinther 6,2: «Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.»
Noch in der gleichen Nacht forderte der Pharao das Volk Israel auf, Ägypten zu verlassen. Nun ging alles sehr schnell. Die Israeliten packten ihre Sachen, beraubten die Ägypter und verliessen das Land, in dem sie viele Jahre als Sklaven gedient und gelitten hatten.
Der Auszug Israels aus Ägypten illustriert die Tatsache, dass ein Mensch, der den Herrn Jesus als Retter vor dem göttlichen Gericht angenommen hat, von nun an nicht mehr zu den Ungläubigen gehört. Das Kreuz des Heilands schützt ihn nicht nur vor der Strafe seiner Sünden, sondern trennt ihn auch von der Welt (Galater 1,4; 6,14). Die Frage ist, ob wir daraus die Konsequenzen für unser Leben gezogen haben. Haben wir die Beziehungen und Freundschaften mit der Welt ganz abgebrochen?
Israel verlässt Ägypten
Es war eine bedeutungsvolle Nacht für das Volk Israel, als es Ägypten verliess, um ins verheissene Land zu ziehen. Jakob war mit 70 Menschen nach Ägypten gekommen, nun machte sich ein Millionenvolk auf den Weg nach Kanaan. Nichts blieb im Land der Knechtschaft zurück. Die Israeliten nahmen sowohl ihre Kinder als auch ihr zahlreiches Vieh mit.
Sie backten den Teig zu ungesäuerten Broten, um die Wirkung des Sauerteigs zu stoppen. Der Sauerteig ist ein Bild der Sünde, die im Leben von Erretteten nicht mehr zum Zug kommen soll.
Viel Mischvolk begleitete das erlöste Volk. Sie stellen Menschen dar, die sich den Glaubenden anschliessen, ohne eine echte Umkehr erlebt zu haben und ohne neues Leben zu besitzen. Wenn Gott durch das Evangelium kraftvoll wirkt und viele Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, besteht besonders die Gefahr, dass einige nur aus Begeisterung mitgehen.
Es scheint, dass der Herr gerade aus diesem Grund ab Vers 43 klare Anordnungen für die Teilnahme am Passahfest gab. Menschen, die nicht zum Volk Israel gehörten, durften nicht davon essen. Die Beschneidung – das äussere Zeichen der Zugehörigkeit zu Israel – war Voraussetzung, damit jemand das Passah feiern konnte.
Der gleiche Grundsatz gilt für die Teilnahme am Gedächtnismahl. Menschen, die kein Leben aus Gott besitzen, sind keine Glieder am Leib des Christus. Deshalb können sie nicht am Brotbrechen teilnehmen.
Anweisungen über die Erstgeborenen
Die Erstgeborenen aus dem Volk Israel waren durch das Blut des Passahlamms vom Gericht verschont worden. Nun gehörten sie dem Herrn, denn Er sagte zu Mose: «Heilige mir alles Erstgeborene.»
Es werden hier zwei Heilstatsachen dargestellt, die fest miteinander verbunden sind: Erlösung und Heiligung. Durch den Glauben an den Heiland und sein Werk am Kreuz haben wir Vergebung der Sünden bekommen und sind von der Macht der Sünde befreit worden. Wir sind nun erlöst. Gleichzeitig sind wir – was unsere Stellung betrifft – aus der Welt herausgenommen und für Gott auf die Seite gestellt worden. Wir sind nun für Ihn geheiligt. Als Folge davon möchte der Herr, dass wir ein heiliges, Gott geweihtes Leben führen.
Darum spricht Mose ab Vers 3 nochmals über den Sauerteig, der im erlösten Volk während sieben Tagen nicht vorhanden sein durfte. Diese Zeit spricht von unserem ganzen Leben als Glaubende. Wir sollen nicht mehr in der Sünde leben, sondern uns Gott zur Verfügung stellen. Paulus und Petrus machen beide deutlich, dass dies der Wille Gottes für uns ist (Römer 6,13; 1. Petrus 4,2).
Von ihren Tieren sollten die Israeliten alle Erstgeborenen dem Herrn darbringen. Eine Ausnahme bildete der Esel. Warum? Weil er ein eindrucksvolles Bild des natürlichen Menschen ist: Wie der Esel, dieses unreine und eigenwillige Tier, sind auch wir in Unreinheit geboren worden und haben im Eigenwillen gelebt. Doch Jesus Christus, das Lamm Gottes, hat uns durch sein Blut erlöst. Welche Gnade!
Der Weg zum Schilfmeer
Gott wählte für die Israeliten den Weg nach Kanaan aus. Sie sollten nicht die kürzeste Strecke durch das Land der Philister gehen. Das hatte seinen Grund. Auf diesem Weg wären sie sofort in den Kampf mit Feinden verwickelt worden. Stattdessen liess der Herr sie durch die Wüste ziehen, damit sie Erfahrungen mit sich selbst und mit ihrem Gott machen konnten.
So ist es normalerweise auch mit jungen Christen. Gott bringt sie nicht gleich in Situationen, wo sie den Kampf für die Wahrheit führen müssen. Sie sollen zuerst Gottes Fürsorge erfahren und die Lektion lernen, dass sie in sich selbst keine Kraft für das Glaubensleben haben.
Am Ende seines Lebens hatte Joseph im Glauben gesagt: «Gott wird sich euch gewiss zuwenden; so führt meine Gebeine von hier hinauf!» (1. Mose 50,25). Als der Herr nun dieses Wort wahr machte, vergass Mose nicht, die Gebeine Josephs mitzunehmen.
Die Wolken- und Feuersäule war für die Israeliten einerseits ein sichtbares Zeichen für die Gegenwart Gottes. Anderseits besassen sie damit einen sicheren Führer durch die Wüste. Der Herr selbst leitete sie am Tag durch die Wolkensäule und in der Nacht durch die Feuersäule.
Gott weiss nicht nur den besten Weg für uns. Er will auch bei uns sein und uns Schritt für Schritt führen. Der Tag spricht von den einfachen Lebenslagen, die Nacht stellt schwierige Umstände dar. In jeder Situation will der Herr uns leiten. Leben wir deshalb in seiner Abhängigkeit!
Der Pharao jagt Israel nach
Gott wollte das Volk Israel endgültig aus der Macht des Pharaos befreien. Darum führte Er es nach Pi-Hachirot. Vor ihnen lag das Rote Meer, hinter ihnen war Ägypten und auf beiden Seiten befand sich eine gebirgige Wüste. In dieser ausweglosen Situation konnte die Rettung nur noch von oben kommen.
Der Pharao bedauerte es nachträglich, dass er die Israeliten freigelassen hatte. Nun liess er seine Armee ausrücken, um die Geflohenen wieder unter seine Gewalt zu bringen. Weil die Ägypter mit Pferden und Wagen viel schneller waren als das Volk Israel, das zu Fuss ging, erreichten sie es bald.
Doch es sollte nicht zu einem Kampf zwischen den Ägyptern und den Israeliten kommen. Gott selbst würde dem Feind entgegentreten und sich am Pharao und seiner mächtigen Armee verherrlichen. Ein letztes Mal wollte der Herr seine Macht im Gericht an Ägypten entfalten, um allen Völkern zu zeigen, wie gross und herrlich Er ist.
Diese Begebenheit spricht prophetisch von der zukünftigen Befreiung der glaubenden Israeliten. Wenn die Not aufs Höchste gestiegen sein wird, wird der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen und sie aus der Hand der Feinde erretten.
Die geistliche Bedeutung für uns Christen ist folgende: Jeder Erlöste muss lernen, dass er die Versuchungen des Teufels und der Sünde nicht aus eigener Kraft überwinden kann. Aber er darf im Glauben erfassen: Durch den Tod des Herrn Jesus bin ich von der Macht der Sünde und des Satans befreit!
Steht und seht die Rettung des HERRN!
Die Israeliten standen am Ufer des Roten Meeres – vor sich das Wasser, hinter sich die heraneilende Armee der Ägypter. Weil sie keinen Ausweg sahen, schrien sie voll Furcht zu Gott. Da bekamen sie zur Antwort: «Fürchtet euch nicht! Steht und seht die Rettung des Herrn.» Sie brauchten nichts zu tun. Gott selbst wollte sie vom Pharao und seinen Soldaten befreien. Darum heisst es weiter: «Der Herr wird für euch kämpfen, und ihr werdet still sein.»
Die Situation und Reaktion des Volkes Israel ist vergleichbar mit den Erfahrungen eines Menschen, der noch nicht lange bekehrt ist. Obwohl er die Vergebung seiner Sünden besitzt, hat er mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen. Er merkt jetzt, wie böse und verdorben er ist. Obwohl er nicht mehr sündigen will, sündigt er doch noch. Satan nutzt diese Tatsache aus und weckt in seinem Herzen Zweifel an der Errettung. Da hilft nur eins: Der Glaube an das, was Gott in seinem Wort sagt. In Römer 8,1 heisst es: «Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.» Das darf jedes Kind Gottes für sich in Anspruch nehmen.
Um einen Angriff der Ägypter unmöglich zu machen, stellte sich Gott in der Wolkensäule zwischen Israel und dessen Feinde. – Etwas Ähnliches tut Gott, wenn Satan eine Anklage gegen uns erheben will. Er tritt selbst für uns ein und rechtfertigt uns vor dem Feind (Römer 8,33). Er weist auf das Erlösungswerk seines Sohnes hin, das die sichere Grundlage unserer ewigen Errettung ist.
Die Befreiung aus Ägypten
Mose, den der Herr zum Retter seines Volkes bestimmt hatte, streckte seine Hand über das Meer aus. Da spalteten sich die Wasser durch das Eingreifen Gottes, so dass sich die Israeliten in Sicherheit bringen konnten. Während sie das rettende Ufer erreichten, ertranken die ägyptischen Soldaten in den zurückkehrenden Wasserfluten. Das Volk Israel ging diesen Weg der Rettung im Glauben an Gottes Wort (Hebräer 11,29). Der Pharao und seine Truppen hingegen betraten das Meer im Unglauben und in Auflehnung gegen Gott. Das Ergebnis brachte diesen bedeutsamen Unterschied klar ans Licht: Kein Ägypter konnte sich retten und kein Israelit kam in den Wellen um.
Das Rote Meer spricht vom Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus. Der Durchzug des Volkes Israel illustriert uns, wie wir durch den Glauben an seinen Tod von der Macht der Sünde und des Teufels befreit werden.
- Jesus Christus hat durch seinen Tod die Macht des Teufels gebrochen. Als Folge davon befreit Er alle, die sich Ihm anvertrauen, aus der Sklaverei Satans (Hebräer 2,14.15).
- Der Herr Jesus ist am Kreuz der Sünde gestorben. Nun rechnet Gott allen Glaubenden den Tod seines Sohnes an. Dadurch sind sie frei gemacht von der Macht der Sünde (Römer 6,5.6).
Wenn wir im Glauben erfassen, dass wir mit Christus gestorben sind, gehen wir sozusagen durch das Rote Meer. Wir verlassen den Machtbereich Satans und müssen der Sünde nicht mehr dienen.
Das Lied der Erlösung
Israel steht als ein erlöstes Volk am anderen Ufer des Roten Meeres und singt dem Herrn ein Loblied. Daraus wird ersichtlich, dass nur Menschen, die Gott kennen und seine Rettung erfahren haben, Ihn von Herzen loben können. Es ist das erste Lied, das in der Bibel erwähnt wird. Im Lauf der Zeit haben viele glaubende Menschen Gott gelobt (Psalm 101,1). Auch vom Herrn Jesus heisst es, dass Er mit seinen Jüngern ein Loblied gesungen hat (Matthäus 26,30). Im Himmel werden wir mit allen Erlösten das neue Lied zur Ehre des Lammes Gottes singen (Offenbarung 5,9). Ist dieser Ausblick nicht ein Ansporn für uns, jetzt schon täglich unserem Herrn zu singen (Psalm 34,2)?
Die Israeliten singen nicht von dem, was sie sind oder getan haben. Der Inhalt ihres Liedes ist die Person und das Werk Gottes:
- Sie nennen Ihn einen Kriegsmann und bewundern seine Macht, Erhabenheit und Heiligkeit. Sie kommen zum Schluss, dass niemand mit dem Herrn zu vergleichen ist.
- Sie beschreiben, wie Gott ihre Rettung vollbracht hat. Er selbst stürzte die Wagen des Pharaos und seine Heeresmacht ins Meer. Dazu war nur ein Hauch seines Mundes nötig.
Vers 13 zeigt, welches Ziel Gott mit der Erlösung seines Volkes verfolgte: Er brachte sie aus Ägypten zu sich in die Wüste, damit Er in ihrer Mitte wohnen konnte. – Auch heute hat der Herr einen Plan mit den erlösten Menschen. Er möchte sie an den Ort führen, wo Glaubende in seinem Namen versammelt sind und Er in ihrer Mitte ist (Matthäus 18,20).
Loben und murren
Im zweiten Teil des Liedes richten die Israeliten ihren Blick auch nach vorn. Sie beschreiben die Furcht der Völker, denen sie auf ihrem Weg nach Kanaan begegnen werden. Im Glauben halten sie daran fest, dass diese Nationen Gott nicht daran hindern können, sein erlöstes Volk ins verheissene Land zu bringen.
Ab Vers 22 beginnt die Wüstenwanderung. Sie spricht von den Erfahrungen, die jeder Glaubende in seinem Leben nach der Bekehrung macht. Die Welt, in der er sich auf dem Weg zum Himmel noch aufhalten muss, ist für ihn eine Wüste geworden. Sie bietet seinem neuen Leben weder Nahrung noch Erfrischung.
Nachdem das Volk drei Tage durch die Wüste gewandert war, ohne Wasser zu finden, kam es nach Mara. Dort gab es Wasser, aber es war nicht geniessbar. Was für eine bittere Enttäuschung! – Auch wir werden auf der Suche nach innerer Erfrischung von der Welt immer enttäuscht. Wir erleben sogar bittere Momente, wenn uns vielleicht alte Freunde im Stich lassen, weil wir dem Herrn Jesus nachfolgen.
Was tat Mose, als das Volk wegen des bitteren Wassers gegen ihn murrte? Er rief den Herrn um Hilfe an und warf dann ein Holz ins Wasser. Da wurde das Wasser süss. – Dieses Holz erinnert uns an das Kreuz, wo der Herr Jesus aus Liebe sein Leben für uns gegeben hat. Der Blick auf seine unendliche Liebe gibt uns Kraft, die bitteren Erfahrungen zu überwinden.
In Elim konnte sich das Volk erfrischen und ein wenig ausruhen. – Auch uns schenkt der Herr Momente der Ruhe, um unseren Glauben durch das Wort zu beleben.
Gottes Antwort auf den Hunger
Die Station nach Elim war die Wüste Sin. Die Israeliten waren bereits mehr als einen Monat auf der Reise. Nun hatten sie nichts mehr zu essen. Wieder murrten sie gegen Mose und Aaron. Meinten sie wirklich, dass Gott sie aus Ägypten erlöst habe, um sie in der Wüste vor Hunger sterben zu lassen? – Oft verhalten wir uns genauso wie das Volk Israel. Obwohl wir bei unserer Bekehrung Gottes Gnade erfahren haben, machen wir im Alltag bei jeder Schwierigkeit unserem Unmut Luft, anstatt auf die Hilfe des Herrn zu vertrauen.
Gott gab sein Volk nicht auf. In seiner Güte kündigte Er den Israeliten an, wie Er es in der Wüste mit Nahrung versorgen wollte: «Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen.» – Dieses Brot vom Himmel spricht vom Herrn Jesus, der die geistliche Nahrung für uns Christen ist (Johannes 6,35). Beim Lesen der Evangelien lernen wir Ihn kennen, wie Er vom Himmel auf die Erde kam, hier als vollkommener Mensch lebte und am Kreuz für uns starb. Diese Beschäftigung mit Jesus Christus anhand des Wortes Gottes nährt und stärkt unser neues Leben.
Wenn die Israeliten ihren Unwillen durch Murren offenbarten, zeigte Gott als Antwort darauf seine herrliche Grösse, wie sie sich zu ihren Gunsten entfaltete. Das war Gnade! Sie sahen die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Sie erfuhren seine Güte und Allmacht, als Er ihnen am Abend Fleisch und am Morgen Brot zu essen gab. Gott selbst war mit ihnen in der Wüste und versorgte sie so, dass sie keinen Mangel haben mussten.
Wachteln und Brot aus dem Himmel
Gott gab seinem Volk klare Anweisungen, wann und wie es das Manna einsammeln sollte. Diese Anordnungen haben eine geistliche Bedeutung für uns im Blick auf das Aufnehmen von geistlicher Nahrung aus dem Wort Gottes:
- Ausser am Sabbat sollten die Israeliten jeden Tag hinausgehen und das Manna auflesen (Vers 4). – Das bedeutet für uns, dass wir täglich einen Abschnitt aus der Bibel lesen. Wir haben diese Tagesration aus dem Wort Gottes für unser Glaubensleben nötig.
- Jeder Israelit sollte seinen eigenen Bedarf einsammeln (Vers 16). Das gilt genauso für uns: Die Predigt vom Sonntag ersetzt das persönliche Bibellesen nicht. Forschen wir selbst im Wort Gottes, damit wir daraus Wegweisung für den Alltag bekommen!
- Der Israelit musste das Manna frühmorgens einsammeln. Sobald die Sonne heiss wurde, zerschmolz es (Vers 21). – Wir wissen, dass am Morgen unser Geist noch frisch und unbelastet ist. Darum können wir zu diesem Zeitpunkt das Wort Gottes am besten aufnehmen.
Wir lesen hier zum ersten Mal vom Sabbat als einer Verordnung für das Volk Israel – und zwar nicht in Verbindung mit dem Gesetz, sondern mit dem Manna. Daraus lässt sich folgender Grundsatz ableiten: Israel kann die Ruhe, die durch den siebten Tag oder den Sabbat dargestellt wird (1. Mose 2,3), nur in Beziehung zu Christus, dem wahren Brot des Lebens, geniessen. – Auch wir finden auf der Erde nur echte Ruhe, wenn wir zum Herrn Jesus kommen und Ihn in seinem Gehorsam und seiner Demut nachahmen (Matthäus 11,28-30).
Das Manna zur Aufbewahrung
Die Beschreibung des Mannas in Vers 31 enthält Hinweise auf Jesus Christus und das Wort Gottes:
- Das Brot aus dem Himmel sah weiss aus. Das lässt uns an die Reinheit unseres Herrn denken. Obwohl Er in der Welt ständig von der Sünde umgeben war, blieb Er doch heilig und unbefleckt (Hebräer 7,26).
- Der Geschmack des Mannas war wie Kuchen mit Honig. Etwas Ähnliches erleben wir, wenn wir die Bibel lesen: «Wie süss sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund!» (Psalm 119,103).
Mose musste einen Krug voll Manna aufbewahren. Später wurde dieser goldene Krug in die Bundeslade gestellt (Hebräer 9,4). Dieses verborgene Manna erinnerte die folgenden Generationen daran, wie Gott sein Volk in der Wüste mit Nahrung versorgt hatte.
So werden auch wir uns in der himmlischen Herrlichkeit ewig am Herrn Jesus freuen, der für uns das verborgene Manna ist (Offenbarung 2,17). Wir werden daran denken, wie Er vom Himmel gekommen ist und auf der Erde als himmlischer Mensch abgesondert von der Sünde gelebt hat. Die Aussicht auf diese zukünftige Freude an unserem Herrn ermutigt uns, jetzt als himmlische Christen abgesondert von der Welt zu leben.
Die Israeliten assen das Manna 40 Jahre lang (Vers 35). Jeden Tag – ausser am Sabbat – liess der Herr dieses Brot vom Himmel regnen. Sie mussten es nur einsammeln. Dank dieser schmackhaften und vollwertigen Nahrung brauchten sie nie Hunger zu leiden. So zeugte das Manna während der ganzen Wüstenwanderung von der unaufhörlichen Treue Gottes.
Wasser aus dem Felsen
Die Israeliten zogen aus der Wüste Sin weiter nach Rephidim. Weil es dort nichts zu trinken gab, litten sie Durst. Das war eine Erprobung von Gott. Würden sie Ihm, der ihnen bis hierher geholfen hatte, vertrauen? Nein! Sie murrten gegen Mose und offenbarten so, was sich auch in unseren Herzen findet: Unglaube und Unzufriedenheit. Gerade die Bezeichnung, die Mose diesem Ort gab, macht deutlich, wie schlimm dieses Verhalten der Israeliten war. Obwohl sie die Gegenwart Gottes in der Befreiung aus Ägypten deutlich erfahren hatten, fragten sie ungläubig: «Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht?»
Wieder begegnete Gott dem Murren des Volkes in Gnade. Er wies Mose an, mit seinem Stab den Felsen zu schlagen. Da kam Wasser heraus, so dass alle ihren Durst stillen konnten.
Das fliessende Wasser aus dem geschlagenen Felsen stellt eine weitere Hilfsquelle für unseren Glaubensweg durch die Welt dar:
- Der Fels ist ein Bild von Christus, der am Kreuz von Golgatha die Schläge des heiligen Zornes Gottes über die Sünde erdulden musste (1. Korinther 10,4; 2. Korinther 5,21).
- Das Wasser aus dem Felsen spricht vom Heiligen Geist, der nach dem Erlösungswerk und der Himmelfahrt des Herrn Jesus auf die Erde gekommen ist, um in allen Glaubenden zu wohnen (Johannes 7,37-39).
Der Heilige Geist gibt uns Einsicht in das Wort Gottes und Kraft, damit sich das neue Leben entfalten kann.
Der Kampf gegen Amalek
In Rephidim machte Israel eine weitere Erfahrung auf seiner Wüstenreise. Es wurde von Amalek angegriffen. Später erinnerte Mose daran, wie niederträchtig dieser Feind das Volk Gottes attackierte: «Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir her, als du erschöpft und müde warst» (5. Mose 25,18).
Josua sollte nun eine Armee aufstellen und gegen Amalek kämpfen. Zur gleichen Zeit erhob Mose auf dem Berg seine Hände in Fürbitte für das Volk. Davon hing schliesslich der Sieg über den Feind ab.
Dieser Kampf enthält auch eine geistliche Lektion für uns:
- Der Angriff von Amalek illustriert uns, wie der Teufel unser sündiges Fleisch anspricht, um uns auf dem Glaubensweg aufzuhalten.
- Josua ist ein Bild des Herrn Jesus, der in der Kraft des Heiligen Geistes seine Erlösten im Kampf gegen den Feind anführt.
- In Mose, der mit dem Stab der Autorität Gottes auf dem Berg war, sehen wir, wie sich der Herr Jesus im Himmel für uns verwendet.
- Aaron und Hur weisen auf seinen doppelten Dienst als Hoherpriester und Sachwalter hin, den Er für uns tut. Mit seiner Hilfe können wir trotz unserer Schwachheit einen Sieg über den Feind erringen.
- Der Altar mit dem Namen «Der Herr, mein Banner!» lenkt unsere Gedanken nach Golgatha. Wir führen diesen Kampf gegen den Feind im Bewusstsein, dass der Herr Jesus am Kreuz den Teufel besiegt hat.
Die Kernbotschaft des Philipper-Briefs
Zwei Briefe im Neuen Testament beschreiben die Entfaltung des christlichen Lebens:
- Der erste Thessalonicher-Brief zeigt die Frische dieses Lebens am Beispiel der jungbekehrten Christen in Thessalonich. Sie lebten in Hingabe an Gott und erwarteten das Kommen des Herrn Jesus. Dieser frische geistliche Zustand kann mit einem blühenden Apfelbaum im Frühling verglichen werden.
- Der Philipper-Brief beschreibt die Reife des christlichen Lebens. Paulus selbst ist ein Beispiel davon, wie sich nun alles um Christus dreht. Er hat in den vielfältigen Erfahrungen seines Lebens mit dem Herrn gelernt, die Gesinnung Jesu Christi zu offenbaren und in der Kraft des Heiligen Geistes über die Umstände zu triumphieren. Sein gereifter geistlicher Zustand gleicht einem Apfelbaum im Herbst, der voller gesunder Früchte ist.
In den Kapiteln 2 und 3 unterweist uns der Apostel, wie sich unser christliches Leben in dieser Schönheit entfalten kann.
- Zuerst lenkt er unsere Blicke auf Jesus, der auf der Erde demütig und gehorsam gelebt hat. Wenn wir seine Gesinnung nachahmen, sehen die Menschen in unserem Verhalten etwas von Ihm.
- Dann weist Paulus auf Christus im Himmel hin. Der tiefe Eindruck seiner herrlichen Person richtet uns ganz auf Ihn dort oben aus. Er wird zum Mittelpunkt unseres Lebens, dem sich alles andere unterstellt.
Paulus dankt für die Philipper
Obwohl Paulus der eigentliche Verfasser des Briefs ist, verbindet er sich mit Timotheus, der sein vertrauter Mitarbeiter war und die Gläubigen in Philippi gut kannte. Beide sind Knechte Christi Jesu, die seinem Beispiel folgten und den Erlösten in Demut dienten. Der Apostel wünscht den Philippern Gnade und Frieden. Sie hatten beides nötig, um einmütig den Glaubensweg weiterzugehen und trotz Widerstand den Dienst am Evangelium fortzusetzen.
Paulus betete mit Freuden für die Gläubigen in Philippi, weil sie sich in einem guten geistlichen Zustand befanden. Das zeigte sich in ihrer beharrlichen Teilnahme am Evangelium. Ihr Einsatz für die Verbreitung der guten Botschaft war kein Strohfeuer, sondern bezeugte, dass Gott in ihnen wirkte. Wir sehen hier, wie die beiden Seiten nebeneinander herlaufen:
- Einerseits ist es die Aufgabe der Glaubenden, mit dem Herrn Jesus zu leben und von Ihm zu zeugen.
- Anderseits beginnt Gott bei ihrer Bekehrung ein gutes Werk, das Er vollenden wird. Am Tag Jesu Christi, d.h. vor seinem Richterstuhl, wird offenbar werden, was Gott in ihrem Leben zu seiner Ehre bewirkt hat.
Paulus bittet für die Philipper
Aus Vers 7 erkennen wir, dass die Philipper eine gute Beziehung zu Paulus hatten. Sie trugen ihn auf einem sorgenden, liebenden und betenden Herzen. Ausserdem bezeugten sie ihm ihre Verbundenheit mit seiner evangelistischen Arbeit durch ihre materielle Unterstützung (Philipper 4,15-17). Gott wusste, wie Paulus die Gläubigen in Philippi liebte und sich nach ihnen sehnte, obgleich er sie nicht besuchen konnte.
Auf das Dankgebet in den Versen 3-8 folgen in den Versen 9-11 einige Bitten, die auch unser Glaubensleben betreffen:
- Unsere Liebe zum Herrn Jesus, zu den Gläubigen und zu den Verlorenen nimmt in dem Mass zu, wie wir uns mit der göttlichen Liebe zu uns beschäftigen.
- Unsere Liebe soll durch die Erkenntnis des Wortes Gottes geprägt sein, indem wir die biblischen Grundsätze mit Einsicht im täglichen Leben umsetzen.
- Wie freut sich der Herr, wenn wir aufrichtig sind und uns so verhalten, dass wir uns selbst und anderen keinen Anstoss zur Sünde geben.
- Eine gerechte Lebensführung ehrt und verherrlicht Gott. In einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus können wir diese Frucht bringen (Johannes 15,5).
Das Evangelium breitet sich aus
Ab Vers 12 spricht Paulus über seine persönliche Situation. Er befand sich schon ungefähr vier Jahre in Haft, was bestimmt nicht leicht für ihn war. Trotzdem war er nicht entmutigt, sondern erkannte, dass Gott dadurch einen zweifachen Segen bewirken konnte. Einerseits wurden durch seine Gefangenschaft neue Zuhörer mit dem Evangelium erreicht (Vers 13). Anderseits wurden neue Verkündiger ermutigt, den Menschen die gute Botschaft zu bringen (Vers 14). Leider geschah es nicht bei allen mit guten Beweggründen: Einige predigten Christus aus Neid und Streit, andere jedoch aus Liebe.
Paulus zeigt hier durch seine Einstellung, wie ein Christ in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes über schwierige Umstände triumphieren kann.
Das Leben ist für mich Christus
Paulus freute sich nicht über die unguten Motive in der Verkündigung des Evangeliums, sondern über die Tatsache, dass Christus gepredigt wurde. Das Heil in Vers 19 ist nicht die Errettung der Seele bei der Bekehrung, sondern die Bewahrung in den Schwierigkeiten auf dem Weg zum himmlischen Ziel. Paulus vertraute darauf, dass er in seiner Haft vom Heiligen Geist die Kraft bekommen würde, dem Herrn treu zu bleiben. Er hatte den Wunsch, Ihn in jeder Situation zu verherrlichen, ob er nun am Leben blieb oder den Märtyrertod erleiden sollte. Der Grund dafür lag in der Tatsache, dass Christus sein Lebensinhalt war. Alles drehte sich um diese herrliche Person. Folglich sah Paulus im Sterben einen Gewinn: Dann würde er bei Christus im Paradies sein!
Paulus sah zwei Möglichkeiten vor sich: Entweder würde er freigelassen, um noch eine gewisse Zeit auf der Erde zu leben. Oder er würde als Märtyrer sterben und zu Christus in die Herrlichkeit gehen, was für ihn persönlich viel besser wäre. Weil er jedoch ganz auf den Herrn Jesus ausgerichtet war und sich selbst vergass, erkannte er, dass sein Bleiben auf der Erde noch nötig war. Paulus wusste, wie kostbar dem Herrn die Erlösten sind. Darum wollte er ihnen noch eine Zeit lang dienen. Wie glich der Apostel in seiner Selbstlosigkeit seinem Meister!
Die Verse 25 und 26 zeigen, was der Besuch eines Dieners in einer Versammlung bewirken kann: Durch die Unterweisung wird das Glaubensleben gefördert und durch die Gemeinschaft wird die geistliche Freude vertieft.
Im Evangelium mitkämpfen
Es lag dem Apostel am Herzen, dass die Philipper in ihrem Glaubensleben nicht von ihm abhängig waren. Darum gab er ihnen in seinem Brief manche Anweisungen. Sie sind auch für uns wichtig. Im gelesenen Abschnitt legt Paulus zuerst grossen Wert auf unsere Lebensführung. Wie kann sie dem Evangelium des Christus angemessen sein? Wenn unser Verhalten im Alltag die Gnade Gottes und unsere himmlische Berufung widerspiegelt.
Im Weiteren werden wir aufgefordert, gemeinsam ein Zeugnis für den Herrn zu sein: Wir sollen an dem Ort, wo wir als Christen zusammengestellt sind, in einem Geist feststehen und in einer Seele mitkämpfen. Es geht darum, dass wir trotz des Widerstands durch den Feind miteinander an der Wahrheit des Evangeliums festhalten und uns für die Verbreitung der guten Botschaft einsetzen. Wenn Christus der Zentralpunkt unseres Lebens ist, kann Er diese Einmütigkeit bewirken.
Wir brauchen uns von denen, die der Ausbreitung des Evangeliums aktiv widerstehen, nicht einschüchtern zu lassen. Wenn sie in ihrer Feindschaft verharren, werden sie ewig verloren gehen. Wir hingegen, die wir Jesus Christus als persönlichen Erlöser angenommen haben, besitzen eine ewige Errettung. Weil Gott sie uns geschenkt hat, wird Er auch dafür sorgen, dass wir das himmlische Ziel erreichen. Auf dem Weg dorthin erfahren wir das Glück unserer Glaubensbeziehung zu Christus und die Leiden vonseiten der Welt (Apostelgeschichte 5,41; 2. Timotheus 3,12). Beides gehört zusammen, wie es auch das Leben und der Dienst des Apostels Paulus deutlich machen.
Demütig und einmütig
In der Versammlung von Philippi gab es ein Problem, das der Apostel nun anspricht: Die Gläubigen hatten Mühe miteinander, obwohl sie alle dem Herrn Jesus nachfolgen und dienen wollten. Bevor Paulus ihnen zeigt, wie sie einander begegnen sollen, lobt er ihr Verhalten ihm gegenüber. Durch ihre materielle Unterstützung war er ermuntert und getröstet worden, denn sie hatten ihm dadurch ihre Verbundenheit und ihr Mitgefühl ausgedrückt. – Wir erkennen hier, dass der Umgang mit den Christen, die wir nur ab und zu sehen, einfacher ist als mit den Gläubigen, die sich mit uns am gleichen Ort versammeln.
Die Philipper konnten die Freude des Apostels noch steigern, indem sie untereinander gleich gesinnt und einmütig waren. Damit ist nicht Uniformität im Denken und Handeln gemeint. Das wäre eine Übereinstimmung, die von aussen aufgedrückt wird. Es geht um etwas anderes. Paulus bittet um eine gleiche Denkweise, ohne die Vielfalt unter den Glaubenden einzuschränken. Es geht darum, dass wir alle die Ehre des Herrn und das Wohl der anderen suchen. Das Gegenteil davon ist eine egoistische Einstellung, die schnell zu Streit und Ehrsucht führt, weil in diesem Fall jeder selbst im Mittelpunkt stehen möchte.
Stattdessen werden wir aufgefordert, in Demut den anderen höher zu achten als uns selbst und in Liebe dem anderen Beachtung zu schenken. Das ist nur möglich, wenn wir uns selbst verleugnen und vom Herrn Jesus lernen. Darum wird uns ab Vers 5 seine beispielhafte Gesinnung in seinem Leben auf der Erde vorgestellt.
Die Gesinnung des Herrn Jesus
Die Verse 6-8 beschreiben den Weg, den Jesus Christus freiwillig gegangen ist. Er, der von Ewigkeit her Gott ist, wurde Mensch. Durch diesen ersten Schritt des Hinabsteigens nahm Er Knechtsgestalt an, um seinem Gott und den Menschen zu dienen. Obwohl Er sündlos ist, glich Er äusserlich den anderen Menschen. Doch Er stieg noch tiefer hinab, weil Er den letzten Platz einnehmen wollte. Als gehorsamer Mensch erniedrigte Er sich bis zum Tod am Kreuz. Das war der zweite Schritt seines Hinabsteigens. Der Weg unseres Herrn auf der Erde ist einzigartig. Unmöglich können wir Ihm darauf folgen. Aber wir stehen voll Bewunderung vor Ihm still, der sich so tief erniedrigt hat!
In diesen Versen erkennen wir auch die Gesinnung, die Jesus auf seinem Lebensweg offenbart hat. Er war von Herzen demütig und gehorsam. Darin können wir Ihn nachahmen. Gott möchte, dass in unserem Verhalten etwas von der Einstellung sichtbar wird, die den Herrn Jesus in seinem Leben auf der Erde gekennzeichnet hat.
In seiner freiwilligen Erniedrigung hat Er seinen Gott und Vater völlig geehrt. Darum hat Gott Ihn hoch erhoben und Ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben. Christus besitzt nun den Namen, der über jeden Namen ist, d.h. Er nimmt als Mensch eine Stellung ein, in der Er alle anderen übertrifft. Bald wird seine Überlegenheit für alle sichtbar sein, wenn sich jedes Knie vor Ihm beugen und jeder Mund seine Herrschaft anerkennen wird. Seine zukünftige Erhöhung wird zur Verherrlichung seines Gottes und Vaters ausschlagen.
Gehorchen und Licht verbreiten
Nach der Aufforderung zur Demut in Vers 3 folgt nun in Vers 12 die Erinnerung an den Gehorsam. Beides hat uns der Herr Jesus vorgelebt.
Der Apostel fordert uns auf, das eigene Heil zu bewirken. Damit will er uns zu einem selbstständigen Glaubensleben anhalten. Die Errettung der Seele konnten wir nicht selbst erlangen. Sie ist ein Geschenk Gottes. Um jedoch auf dem Weg zum himmlischen Ziel aus den Gefahren errettet zu werden, ist es nötig, dass wir uns nahe beim Herrn aufhalten und uns davor fürchten, Ihn zu verunehren. Gott unterstützt uns dabei, damit wir gern seinen Willen tun und uns bewahren lassen.
Wenn wir alles im Namen des Herrn Jesus tun, der nie gemurrt und nie an der Liebe Gottes gezweifelt hat, können wir in einer dunklen Welt Himmelslichter sein und den Menschen den Weg zu Gott zeigen. Wir stellen dann durch unser Verhalten das Wort des Lebens dar, d.h. wir offenbaren die Wesenszüge unseres Meisters, der immer makellos und aufrichtig gewesen ist.
Ein solches Leben ist nicht nur zur Ehre Gottes, sondern auch eine Ermutigung für die Mitarbeiter, die uns durch ihren Dienst geistlich unterstützen. Sie werden am Richterstuhl des Christus Lohn für ihren Einsatz und ihre Treue bekommen.
Paulus glich in seiner Denkweise dem Herrn Jesus. Bescheiden nannte er den eigenen Dienst ein kleines Trankopfer, während er im hingebungsvollen Glauben der Philipper das Hauptopfer sah. Sein Herz war voll Freude, weil er gern den unteren Platz einnahm und sich mit den Gläubigen in Philippi verbunden fühlte.
Timotheus und Paulus
Paulus dachte nicht an seine Bedürfnisse, sondern an das Wohl der Philipper. Darum war er bereit, auf Timotheus zu verzichten und ihn nach Philippi zu senden. Dieser Mitarbeiter besass die gleiche Gesinnung wie der Apostel. Er war von Herzen für das geistliche Wohlergehen der Gläubigen besorgt. Weil Paulus und Timotheus dasselbe dachten und zu erreichen suchten, standen sie sich innerlich sehr nahe. – Wir sehen an ihrem Beispiel deutlich, wie eine selbstlose, demütige Denkweise die Herzen miteinander verbindet und eine Einmütigkeit unter den Erlösten bewirkt.
In diesem Moment hatte Paulus keinen Mitarbeiter bei sich, der so die Gesinnung des Herrn Jesus mit ihm teilte wie Timotheus. Traurig musste er sagen: «Alle suchen das Ihre.» Dieser kurze Satz stellt uns ins Licht Gottes. Wie bin ich persönlich eingestellt? Suche ich meine eigenen Interessen oder liegen mir die Glaubensgeschwister am Herzen?
Timotheus hatte sich als Mitarbeiter im Werk des Herrn bewährt. Seine selbstlose Hingabe war echt und dauerhaft. Viele Jahre hatte er in einer guten Beziehung mit dem Apostel Paulus am Evangelium gedient. – Wie schön, wenn es heute diese gute geistliche Gemeinschaft zwischen älteren und jüngeren Mitarbeitern gibt!
Sobald der Apostel wusste, wie seine Verhandlung in Rom ausgehen würde, sollte Timotheus die Philipper besuchen und sie darüber informieren. Paulus vertraute zugleich dem Herrn, dass er selbst zu ihnen kommen würde. Wie lagen ihm doch die Philipper am Herzen!
Epaphroditus
Aus Philipper 4,18 wissen wir, dass Epaphroditus die materielle Gabe der Philipper dem gefangenen Apostel gebracht hatte. Unterwegs oder in Rom war er bei der Erfüllung dieses Auftrags todkrank geworden. Von dieser Krankheit war er aber inzwischen genesen. Nun sollte Epaphroditus mit dem Brief des Apostels Paulus zu den Philippern zurückkehren.
Epaphroditus war ein Gläubiger, der verbindend wirkte. Das wird aus seiner Aufgabe und aus seiner Einstellung ersichtlich:
- Mit seiner Reise nach Rom und zurück nach Philippi stellte er einen Kontakt zwischen den Gläubigen seines Heimatortes und dem Apostel her. Er informierte Paulus über die Situation der Philipper und konnte ihnen die Umstände des Apostels mitteilen.
- In seiner selbstlosen Gesinnung dachte Epaphroditus mehr an die Sorgen der Philipper als an seine eigene Krankheit. Darum zog es ihn nach Philippi und verband es ihn mit Paulus, der auch so uneigennützig eingestellt war (Vers 28).
Der Apostel benutzte seine Gabe der Krankenheilung nicht, um seinen Mitarbeiter gesund zu machen. Warum? Weil das nicht dem Zweck dieser Gabe – nämlich der Unterstützung des Evangeliums – entsprochen hätte. Aber er durfte erfahren, wie sich Gott über ihn erbarmte und Epaphroditus heilte.
Gläubige, die sich wie Epaphroditus für das Werk des Herrn und für die Seinen einsetzen, sollen wir anerkennen und schätzen (Vers 29). Vergessen wir nicht: Jeder Dienst erfordert Verzicht und bringt Leiden mit sich.
Religiöse Vorzüge
In diesem Kapitel zeigt uns der Apostel, was uns Kraft und Motivation für ein Leben in der Gesinnung des Herrn Jesus gibt. Es ist der Glaubensblick nach oben auf den verherrlichten Christus und nach vorn auf das Ziel. Paulus beginnt mit zwei Aufforderungen:
- Freut euch im Herrn! Er ist die Quelle einer Freude, die nicht vergeht und uns im Glauben stärkt.
- Hütet euch vor bösen Arbeitern, die den christlichen Glauben mit jüdischen Elementen vermischen. Dadurch wollen sie dem natürlichen Menschen wieder Platz zur Entfaltung geben. Doch sie zerstören damit alles.
In Vers 3 geht es um eine geistliche Beschneidung: Die Glaubenden halten daran fest, dass der alte Mensch am Kreuz gerichtet worden ist. Als Folge davon verurteilen sie das, was aus ihrer alten Natur kommt. Im Gottesdienst lehnen sie alles Zeremonielle ab und unterstellen sich der Führung des Heiligen Geistes. Sie haben den Wunsch, dass der Herr Jesus geehrt wird, und stützen sich nicht auf menschliche Fähigkeit und Tatkraft, sondern auf Gott.
Wenn jemand Grund hätte, auf «Fleisch», d.h. auf seine Person, seine Bildung und seine Frömmigkeit zu vertrauen, dann wäre es Paulus gewesen. Er war ein gebürtiger Israelit aus dem Stamm Benjamin. Als Pharisäer zählte er zu den strenggläubigen Menschen in Israel. Sein Eifer für den jüdischen Glauben und seine Gesetzestreue galten als vorbildlich. Alle diese Vorzüge machten Paulus in der Gesellschaft zu einem angesehenen religiösen Menschen. Doch welchen Wert hatte diese menschliche Gerechtigkeit vor Gott?
Christus gewinnen
Als Paulus vor Damaskus eine Begegnung mit dem verherrlichten Christus hatte, sah er seine menschlichen Vorzüge in einem anderen Licht. Alles, was ihm bis zu diesem Zeitpunkt wertvoll war, achtete er für Verlust, weil es ihn daran hinderte, den Herrn Jesus zu erkennen. Er konnte nicht gleichzeitig ein religiöses Ansehen bei den Menschen geniessen und Christus zum Lebensinhalt haben. Das eine schloss das andere aus.
Der Herr Jesus Christus im Himmel ist so vortrefflich, dass es Paulus nicht schwerfiel, alles andere für Dreck zu achten. Er hatte nur einen Wunsch, der sein ganzes Leben bestimmte: Er wollte Christus in der himmlischen Herrlichkeit gewinnen. Darum strebte er im täglichen Leben nicht mehr nach einer menschlichen Gerechtigkeit, sondern nach einem Verhalten, das mit Gott übereinstimmte. Auf diesem Weg konnte er Christus praktisch erkennen, wie Er das Herz ganz erfüllt und auf das himmlische Ziel ausrichtet. Wer den himmlischen Herrn so kennt und erfährt, sucht keinen Platz mehr auf der Erde, sondern sehnt sich nach dem Himmel.
Auf dem Weg dorthin wünschte Paulus, dass die göttliche Auferstehungskraft in ihm wirkte, damit das neue Leben zur Entfaltung kam. Weil ihm Christus so viel bedeutete, war er auch bereit, wie sein Meister durch Leiden und durch den Tod zu gehen. Paulus wusste, dass er zur Auferstehung aus den Toten gelangen und so die himmlische Herrlichkeit erreichen würde. Sein zielgerichtetes Leben spornt uns an, ebenfalls ganz auf Christus im Himmel ausgerichtet zu sein.
Ans Ziel laufen
Paulus war noch nicht zur Auferstehung aus den Toten gelangt und noch nicht im verherrlichten Körper bei Christus im Himmel angekommen. Aber er lief auf dieses Ziel zu. Wo fand er die Kraft dazu? In Christus Jesus, dieser unvergleichlich herrlichen Person! Von Ihm war Paulus so ergriffen, dass er Ihm mit Energie entgegenlief.
Paulus war seinem Herrn sehr nahe, aber er hatte das Ziel noch nicht erreicht. Darum lief er unentwegt weiter. Er blickte nicht zurück, um zu sehen, was er alles zurückgelassen hatte oder wie weit er schon gelaufen war. Nein, er schaute nach vorn, ans Ziel. Er streckte sich nach Christus aus und wurde so wie von einem Magneten angezogen. Sein Glaubenslauf war nicht ein Krampf, sondern die glückliche Folge davon, dass der Herr Jesus sein Herz erfüllte.
Gott hat die Glaubenden der Gnadenzeit von Anfang an dazu bestimmt, bei Christus im Himmel zu sein. Erlöste, die diese Berufung Gottes im Herzen erfassen und im Leben verwirklichen, sind «vollkommen», weil sie sich auf das richtige Ziel ausrichten. Davon sollen sie sich durch nichts abhalten lassen. Gläubige, die «anders gesinnt» sind, haben Christus in der Herrlichkeit noch nicht als ihr Lebensziel. Doch Gott wird dafür sorgen, dass in ihrem Herzen dieses Licht aufgeht und sie beginnen, dem verherrlichten Herrn entgegenzulaufen.
Obwohl wir noch nicht alle auf den Himmel ausgerichtet leben, sollen wir den Glaubensweg trotzdem gemeinsam weitergehen und dabei die Gesinnung Jesu Christi offenbaren.
Das Bürgertum im Himmel
In Vers 17 fordert uns der Apostel auf, seinem guten Beispiel zu folgen. Ein Nachahmer ist jemand, der einen anderen genau beobachtet und es ihm gleichtut. Es geht hier darum, dass wir Paulus und alle zielorientierten Christen in ihrem Wettlauf zu Christus im Himmel zum Vorbild nehmen und sie darin nachahmen.
In den Versen 18 und 19 warnt uns Paulus vor dem schlechten Einfluss irdisch gesinnter Menschen, die uns von einer himmlischen Ausrichtung abbringen können. Er nennt sie «Feinde des Kreuzes des Christus», weil sie meinen, ohne das Kreuz von Golgatha auszukommen. Sie anerkennen Jesus als historische Persönlichkeit. Aber sie nehmen seinen Tod nicht als Grundlage ihrer Errettung an und wollen der Schmach seines Kreuzes ausweichen. Darum werden sie ewig verloren gehen. Diese religiösen Menschen leben so, dass sie selbst und der Genuss des Irdischen im Mittelpunkt stehen. Ausserdem möchten sie auf der Erde zu Ehre und Ansehen kommen. Das ist eine Schande für sie, weil ein Christ dadurch gekennzeichnet sein soll, dass er die Ehre seines Herrn sucht und auf den Himmel ausgerichtet ist.
Unser Bürgertum ist im Himmel. Darum warten wir sehnsüchtig auf den Moment, an dem der Herr Jesus unsere Errettung zum Abschluss bringen wird. Er wird wiederkommen und in göttlicher Kraft unseren schwachen, sterblichen Körper umgestalten, so dass wir uns mit einem verherrlichten Körper im Himmel aufhalten können. Dort werden wir Christus gleich sein und Ihn sehen wie Er ist (1. Johannes 3,2). Was für eine herrliche Hoffnung!
Freude im Herrn
Die Aussicht auf das herrliche Ziel nimmt der Apostel als Anlass, um den geliebten Brüdern und Schwestern in Philippi einige Hinweise für das Glaubensleben zu geben. Sie gelten auch uns. Zuerst fordert er uns auf, im Herrn festzustehen. Anstatt in den Schwierigkeiten mutlos zu werden und aufzugeben, sollen wir bei unserem Herrn bleiben.
Sowohl Evodia als auch Syntyche setzten sich für das Evangelium ein. Aber sie waren uneins. Nun ermahnt Paulus sie, im gleichen Sinn und Geist zu handeln, d.h. einander in einer demütigen Gesinnung zu begegnen. Epaphroditus, der treue Mitknecht des Apostels, konnte ihnen dabei behilflich sein, weil er gelernt hatte, selbstlos an andere zu denken (Philipper 2,25.26).
Der Herr Jesus ist Quelle und Inhalt einer echten und bleibenden Freude. Lassen wir uns durch notvolle Situationen nicht davon abhalten, uns in Ihm zu freuen! Unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen soll milde und nachgiebig sein. Jesus hat es uns vorgelebt. Nie hat Er auf seine Rechte gepocht, nie ist Er den Menschen mit Härte begegnet.
Immer wieder steigen Sorgen in unseren Herzen auf. Sie trüben den Blick zum Herrn, nehmen uns die Freude weg und beschäftigen uns mit uns selbst. Wie können wir sie loswerden? Durch das Gebet! Werfen wir die Sorgen auf Gott! Er nimmt sie uns ab und gibt uns seinen Frieden, so dass unser Herz und unsere Gedanken zur Ruhe kommen. Wenn wir zu Gott beten und Ihm unsere Anliegen vorstellen, wollen wir das Danken nicht vergessen. Wie viel Gutes hat Er uns schon geschenkt!
Das Gute erwägen und tun
In den Versen 6 und 7 lernen wir, in unserem Leben das Vertrauen auf Gott zu setzen. Nun führt uns Paulus in den Versen 8 und 9 einen Schritt weiter. Er zeigt uns, wie wir die Gemeinschaft mit Gott geniessen können. Dazu ist zweierlei nötig:
- Es gilt, das Wahre und Gute zu erwägen (Vers 8). Dann beschäftigen wir uns mit dem, was von Gott kommt. Das führt uns in die Gemeinschaft mit Ihm.
- Paulus fordert uns auch auf, seine Belehrungen zu befolgen (Vers 9). Wenn wir dem Wort Gottes gehorchen, ist der Gott des Friedens mit uns, so dass wir in der Lage sind, seine Liebe zu geniessen (Johannes 14,23).
Paulus drückt in Vers 10 seine Freude darüber aus, dass die Gläubigen in Philippi an ihn gedacht und ihn materiell unterstützt haben. Eine Zeit lang ist es ihnen nicht möglich gewesen. Als sich dann aber eine Gelegenheit bot, lebten sie auf und sandten ihm gern durch Epaphroditus eine Unterstützung (Vers 18).
Ab Vers 11 spricht Paulus über seine persönlichen Erfahrungen im Blick auf seinen täglichen Lebensbedarf. Er kannte Zeiten des Mangels und Zeiten des Überflusses. Durch jede Situation ging er mit dem Herrn. Dabei lernte er, sich in der aktuellen Lage mit dem zu begnügen, was vorhanden war. Die Kraft, um in allen Umständen zufrieden und glücklich zu sein, bekam Paulus vom Herrn. Aus seinen Erfahrungen wusste er: «Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.» Auch uns will der Herr Jesus jeden Tag Kraft geben, damit wir im neuen Leben über die Umstände triumphieren können.
Erfahrungen mit dem Herrn
Paulus stellt uns hier einige geistliche Aspekte vor, die mit der praktischen Unterstützung von Dienern des Herrn zusammenhängen:
- Die materielle Gabe ist ein Ausdruck der Gemeinschaft mit dem Diener und seiner Situation (Vers 14).
- Paulus hat die Gabe von der Versammlung in Philippi bekommen (Vers 15). Das stimmt mit seinen Belehrungen über das Sammeln und Verwalten des Geldes in der örtlichen Versammlung überein (1. Korinther 16,1-3).
- Die Unterstützung der Diener im Werk des Herrn soll eine Frucht des neuen Lebens sein. Das hat einen geistlichen Wert für Gott (Vers 17).
- Durch unsere materielle Freigebigkeit sammeln wir uns Schätze im Himmel (Lukas 12,33; 1. Timotheus 6,19). Paulus sagt es hier so: Die Gabe aus Philippi als eine Frucht, die Gott bewirkt hat, wird dem «Konto» der Philipper im Himmel gutgeschrieben (Vers 17).
- Der Apostel nennt die materielle Unterstützung der Diener «einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig» (Vers 18). Damit bezeugt er, wie der Herr solche Gaben wertschätzt.
- Aus der Erfahrung mit seinem Gott weiss Paulus, dass Gott keinem Geber etwas schuldig bleibt, sondern nach seinem Reichtum alles Nötige gibt (Vers 19).
In Vers 20 verbinden sich der Empfänger und die Geber miteinander und sagen mit anderen Worten ausgedrückt: Wir kennen gemeinsam unseren Gott und Vater im Himmel und wünschen zusammen, dass Er verherrlicht wird. Auch durch die gegenseitigen Grüsse soll diese Verbundenheit der Gläubigen zum Ausdruck kommen.
Einführung in die Psalmen
Die Psalmen schildern nicht so sehr die Ereignisse, sondern die Gefühle und Empfindungen der Glaubenden in verschiedenen Situationen. Unter der Leitung des Geistes Gottes bringen sie ihre Hoffnungen und Befürchtungen, ihre Schmerzen und ihr Gottvertrauen zum Ausdruck.
Die Psalmdichter lebten in einer anderen Zeit als wir. Sie kannten das Erlösungswerk des Herrn Jesus noch nicht und besassen deshalb keine Heilssicherheit. Weil sie in der Zeit des Gesetzes lebten, baten sie um Rache und Vergeltung an ihren Feinden. Ausserdem hatten sie eine irdische Hoffnung: Sie erwarteten den Segen des Reichs Gottes im Land Israel.
Aus diesem Grund tragen die Psalmen einen prophetischen Charakter. Beim Lesen hören wir die Stimme der Glaubenden aus dem Volk Israel, wie sie in der Not der zukünftigen Drangsalszeit zu Gott rufen und auf seine Hilfe hoffen. Einige Psalmen bringen auch die Gefühle des Herrn Jesus zum Ausdruck, wenn Er prophetisch über seine Leiden und seine Herrlichkeit spricht (Lukas 24,44; 1. Petrus 1,11).
Wir können also nicht jede Aussage in den Psalmen direkt auf uns Christen übertragen. Dennoch gibt es vieles, was in diesem Bibelbuch auch zu unserer Ermunterung und Ermahnung geschrieben ist:
- Wir lernen, wie wichtig das Gebet für uns ist. Gott hört und antwortet, wenn wir zu Ihm rufen.
- Das Gottvertrauen der Psalmdichter spornt uns an, geduldig auf die Hilfe des Herrn zu warten.
- Gottesfurcht ist ein Kennzeichen aller Gläubigen, die mit Gott leben und Ihm gefallen möchten.
Der Gerechte und der Gottlose
Im ersten Psalm werden einige Merkmale des Gottesfürchtigen und die allgemeine Regierung Gottes auf der Erde vorgestellt.
Der Mensch, der an Gott glaubt und mit Ihm leben möchte, sondert sich von der gottlosen Welt ab:
- Er lebt nicht nach den Ideen und Gedanken der gottlosen Menschen.
- Er handelt nicht so wie die Ungläubigen, die bedenkenlos sündigen.
- Er hält sich nicht dort auf, wo sich Menschen über Gott und die Bibel lustig machen.
Stattdessen macht sich der Glaubende das Wort Gottes zur Richtschnur seines Lebens. Er freut sich über das, was Gott in seinem Wort sagt, und nimmt sich Zeit zum Bibellesen. Er denkt auch über das Gelesene nach.
Die Absonderung von der Welt und die Hinwendung zum Wort Gottes wirkt sich auf das Leben des Gläubigen aus. Er bringt Frucht für Gott und zeugt durch sein Verhalten vom Herrn Jesus. Es wird sichtbar, dass er von Gott gesegnet ist.
Im Gegensatz dazu hat das Leben des Ungläubigen keinen Wert für Gott. Er kann zwar in der Welt zu Ruhm und Ansehen kommen, aber in den Augen des Herrn ist er wie Spreu, die einmal verbrannt werden wird (Lukas 3,17). Wenn er sich am zukünftigen Gerichtstag vor Gott verantworten muss, wird er zu ewiger Strafe verurteilt werden.
Das Bewusstsein, dass Gott den Weg des Gerechten anerkennt und in der Zukunft belohnen wird, spornt uns an, getrennt von der Welt zur Ehre des Herrn zu leben.
Christus als König in Israel
In diesem Psalm kündigt Gott an, dass Jesus Christus als König in Zion regieren wird.
Er beginnt mit der Rebellion der Völker gegen Gott (Psalm 2,1-3). Sie wollen die göttliche Oberherrschaft, die Er durch seinen Gesalbten auf der Erde ausüben möchte, nicht anerkennen. Darum sind vor ungefähr 2000 Jahren Pilatus, Herodes und die führenden Juden übereingekommen, den Sohn Gottes zu kreuzigen (Apostelgeschichte 4,25-28). In der Zukunft werden die Nationen nochmals gegen Christus kämpfen, aber dabei eine Niederlage erleiden (Offenbarung 17,14; 19,19).
In den Versen 4-9 erfahren wir den Plan Gottes mit seinem Christus und mit der Erde. Er wird der Rebellion der Völker durch Gericht ein Ende machen und seinen König auf dem Berg Zion einsetzen. Wer ist denn der Gesalbte des Herrn, der König in Zion sein wird? Es ist ein Mensch, der von Gott gezeugt worden ist und von Ihm als Sohn anerkannt wird (Vers 7). Das kann nur Jesus sein, der vom Heiligen Geist gezeugt und deshalb Sohn Gottes genannt wurde (Matthäus 1,20; Lukas 1,35).
Als Sohn Gottes hat der Herr Jesus das Recht, die Königsherrschaft zu fordern. Er wird sie von Gott bekommen, und zwar nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt (Epheser 1,10). Durch Gericht wird Er sich alle Völker unterwerfen.
Der Psalm endet mit einem Appell an die Regenten der Erde (Psalm 2,10-12), sich der Autorität Gottes zu beugen und seinen Sohn als Weltenherrscher anzuerkennen. Das wird der einzige Weg sein, um dem zukünftigen Gericht zu entgehen.
In der Bedrängnis zu Gott rufen
Dieser Psalm beschreibt die Erfahrungen, die die Glaubenden aus dem Volk Israel in der zukünftigen Drangsalszeit machen werden:
- Sie sind von vielen Feinden umgeben, die sie bedrängen und ihnen weismachen wollen, dass Gott ihnen nicht helfen könne (Psalm 3,2.3).
- Trotzdem halten sie am Herrn fest. Sie glauben, dass Er sie beschützen kann. Darum beten sie zu Ihm und suchen bei Ihm Hilfe (Psalm 3,4.5).
- Weil sie in der Bedrängnis auf Gott vertrauen, besitzen sie im Herzen einen tiefen Frieden. Deshalb können sie ruhig schlafen. Sie fürchten sich nicht vor ihren Bedrängern (Psalm 3,6.7).
- Ungeachtet ihrer notvollen Situation blicken die gläubigen Juden vertrauensvoll in die Zukunft. Sie sind überzeugt, dass der Herr zur rechten Zeit aufstehen und alle bestrafen wird, die sie bedrängen. Das Gericht an ihren Feinden wird für sie Rettung aus tiefster Not bedeuten (Psalm 3,8.9).
Was können wir Christen aus diesem Psalm lernen? Unser Leben verläuft nicht immer reibungslos. Oft werden wir von Problemen regelrecht bedrängt. Wenn wir dann mit unseren Schwierigkeiten zu Gott gehen, Ihn um Hilfe bitten und Ihm die Lösung auch zutrauen, kommen wir innerlich wieder zur Ruhe. Diese Erfahrung wird durch Philipper 4,6.7 bestätigt: «Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus.»
Gerecht leben und Gott vertrauen
In diesem Psalm gelangt der Glaubende zu einer wichtigen Erkenntnis: Damit Gott seine Gebete erhört, muss er in Übereinstimmung mit Ihm leben.
Der Erlöste ist von gottlosen Menschen umgeben, die ihn bedrängen. In dieser Not ruft er zum Herrn. Im Blick auf seine Feinde appelliert er an Gottes Gerechtigkeit, die dem Bösen Einhalt gebieten soll. Für sich selbst bittet er um Gnade und um die Erhörung seiner Gebete.
In den Versen 3 und 4 werden die Gottlosen und die Gottesfürchtigen einander gegenübergestellt:
- Menschen, die bewusst ohne Gott leben, interessieren sich nicht für seine Herrlichkeit. Stattdessen suchen sie Ehre in der Welt und lieben die Lüge.
- Menschen, die gottesfürchtig und gerecht leben möchten, werden von Gott geschätzt. Er hört sie, wenn sie zu Ihm rufen.
Die Verse 5 und 6 zeigen die Voraussetzungen für ein Leben, das Gottes Zustimmung findet. Es erfordert Ehrfurcht vor Ihm und die Bereitschaft, alles zu meiden, was Er als Sünde verurteilt. Gottesfurcht zeichnet sich auch durch ein gerechtes Verhalten – das uns etwas kosten kann – und durch Vertrauen auf den Herrn aus.
Die äussere Situation des Gläubigen, der gottesfürchtig lebt und auf Gott vertraut, mag unverändert schwierig sein. Aber er bekommt vom Herrn zwei wertvolle Geschenke: eine Freude, die nicht von den Umständen abhängt, und einen Frieden, der ihn ruhig schlafen lässt.
Gott hört, führt und segnet
Dieser Psalm drückt die Empfindungen der Gläubigen in der zukünftigen Drangsalszeit aus. Weil sie unter der Gottlosigkeit der Welt seufzen, rufen sie zu Gott und bitten Ihn, die Gottlosen zu bestrafen, damit die Gerechten den Segen des Herrn geniessen können.
Die Verse 2-4 enthalten Unterweisungen zum Gebet, die auch für uns wichtig sind:
- Wer Gott kennt, weiss, dass er zu jeder Zeit und in jeder Situation zu Ihm beten kann.
- Wer früh am Morgen betet, misst dem Gebet eine hohe Priorität bei. Er setzt die beste Zeit dafür ein.
- Wer auf die Antwort Gottes harrt, sucht nicht selbst nach einer Lösung, sondern wartet geduldig auf Ihn.
In den Versen 5-7 wird Gott beschrieben. Er freut sich nicht über das Böse in der Welt und verabscheut jede Sünde. Er kann den Sünder nicht in seiner Gegenwart dulden, sondern muss ihn bestrafen, wenn er nicht Buße tut. Das ist zu allen Zeiten wahr.
Der glaubende Überrest aus Israel ist überzeugt, dass er zum Haus Gottes kommen wird, um Ihn dort in Ehrfurcht anzubeten. Bis er an diesem Ziel ist, hat er zwei Bitten, die auch uns kennzeichnen sollen:
- «Leite mich, Herr, in deiner Gerechtigkeit.» Ist es unser Wunsch, ein gerechtes Leben zu führen?
- «Ebne vor mir deinen Weg.» Möchten wir den Weg gehen, den Gott für uns vorgesehen hat!
Die gläubigen Juden wissen, dass der Herr die Gottlosen bestrafen (Vers 11) und die Gerechten segnen wird (Vers 13). Weil sie zu Gott Zuflucht nehmen, werden sie an der Freude des Tausendjährigen Reichs teilhaben.
Buße und Hilferuf in grösster Not
Die gläubigen Juden in der Endzeit sehen in ihrer Drangsal die erziehende Hand Gottes. Weil sie das Erlösungswerk des Herrn Jesus nicht kennen, kommen sie zum Schluss, Gott sei zornig und strafe sie. Trotzdem nehmen sie Zuflucht zum Herrn und erwarten die Befreiung von Ihm.
Als Christen wissen wir, dass der Heiland die Strafe für unsere Sünden am Kreuz getragen hat. Wenn Gott uns in den Schwierigkeiten des Lebens erzieht, bestraft Er uns nicht für das, was wir verkehrt gemacht haben. Es kann aber sein, dass Er uns das ernten lässt, was wir gesät haben (Galater 6,7). Wir müssen dann die Folgen unseres Versagens tragen, was aber nie eine Strafe Gottes ist.
Die Hoffnung der Glaubenden aus Israel ist das Leben auf der Erde im Tausendjährigen Reich. Darum bitten sie in der Bedrängnis um Bewahrung. Sie möchten am Leben bleiben und in den Segen des Reichs eingehen, um den Herrn zu preisen. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass viele gläubige Juden in der Drangsalszeit den Märtyrertod erleiden werden. Doch sie werden auferstehen und den göttlichen Segen im himmlischen Bereich des Reichs geniessen (Offenbarung 20,4).
Der zukünftige Überrest aus Israel seufzt und weint unter der erziehenden Hand Gottes, weil er einerseits den Druck der Leiden spürt und anderseits über die begangenen Sünden Buße tut. Auf diese Demütigung reagiert der Herr in Gnade. Er erhört die Gebete des Überrests und befreit ihn aus der Hand seiner Feinde.
Ungerechte Verfolgung
In diesem Psalm hören wir wieder die Stimme der gläubigen Juden in der zukünftigen Drangsalszeit. Weil sie bedrängt sind und verfolgt werden, nehmen sie Zuflucht zu Gott und bitten Ihn um Rettung und Befreiung. Zweimal nennen sie Ihn «Herr, mein Gott» (Psalm 7,2.4). Sie haben eine persönliche Beziehung zu Gott und machen persönliche Erfahrungen mit Ihm.
Sind sie uns darin nicht ein Bespiel? Pflegen wir täglich die Gemeinschaft mit Gott? Leben wir im Alltag bewusst mit unserem Herrn? Dann erfahren wir, wie Er uns in den Schwierigkeiten hilft.
Die Treuen aus Israel sind sich im Umgang mit ihren Mitmenschen keines Unrechts bewusst. Sie üben sogar Gnade an ihren Feinden. Ihr gerechtes und gütiges Verhalten veranlasst sie, Gott freimütig um Befreiung von den Bedrängern zu bitten.
In den Versen 7-9 geht es um die gerechte Regierung Gottes über die Menschen: Er bestraft die Gottlosen und segnet die Gerechten. Auf diesen Grundsatz beruft sich der Überrest in seinem Gebet. Wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit erscheint, wird Er danach handeln.
Zuerst wird Er in seinem Zorn die Gottlosen richten und dadurch den bedrängten Überrest befreien. Später wird Er an einer Gerichtssitzung das Verhalten der Völker gegenüber den gottesfürchtigen Juden beurteilen und sie entsprechend belohnen oder bestrafen (Matthäus 25,31-46). Schliesslich wird auch der Überrest beurteilt werden. Sein gerechtes und aufrichtiges Leben wird die göttliche Zustimmung erhalten.
Gerechtes Gericht
Die Glaubenden in der zukünftigen Drangsalszeit sehnen sich danach, dass die Bosheit der Ungläubigen ein Ende nimmt. Darum rufen sie zu Gott und bitten Ihn um sein Eingreifen im Gericht. Zugleich beten sie zu Ihm, dass Er sie auf dem Weg, den sie in Übereinstimmung mit Ihm gehen möchten, bestärke und bewahre.
Die erste Bitte ist in der christlichen Zeit nicht angebracht. Da sollen wir für unsere Feinde beten (Lukas 6,27.28). Die zweite Bitte hingegen passt durchaus in die Zeit der Gnade. Weil wir von einer bösen Welt umgeben sind, haben wir die göttliche Bewahrung nötig, damit wir auf dem rechten Weg bleiben.
Gott prüft unsere Zuneigungen (= Herz) und unser Unterscheidungsvermögen (= Nieren). Er sieht, ob wir Ihn von Herzen lieben und welches Urteil wir über Gut und Böse haben.
Wenn Gott auch langmütig ist und mit dem Gericht wartet, so ist Er doch ein gerechter Richter. Einmal wird Er jeden bestrafen, der nicht Buße tun und zu Ihm umkehren will. Das wird besonders in der zukünftigen Gerichtszeit deutlich werden. Auch keiner, der ohne Vergebung seiner Sünden gestorben ist, wird seiner Strafe entgehen.
Die Verse 15-17 beschreiben die gottlosen Menschen. Um anderen schaden zu können, schrecken sie nicht vor dunklen Machenschaften zurück. Aber Gott sorgt dafür, dass sie in die Grube fallen, die sie selbst für andere gegraben haben.
Weil Er in der Zukunft der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen wird, werden Ihn die Glaubenden preisen.
Der Sohn des Menschen
Dieser Psalm stellt den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit als Sohn des Menschen vor, wie Er über die ganze Schöpfung regiert. Aufgrund seiner universellen Herrschaft wird der «Herr», der eine Beziehung zu Israel eingegangen ist, im Himmel und auf der Erde anerkannt sein.
Die Kinder und Säuglinge stehen für den schwachen Überrest aus Israel in der Zukunft. Gott wird gerade ihn auswählen, um seine Macht und Herrlichkeit zu verkünden. Dadurch werden seine Feinde zum Schweigen gebracht. Eine Vorerfüllung davon finden wir in Matthäus 21,15, wo Kinder dem Herrn Jesus zuriefen: «Hosanna dem Sohn Davids!»
Der Himmel mit den zahlreichen Sternen ist ein besonderes Zeugnis der Grösse und Allmacht Gottes. Wie klein ist doch der Mensch im Vergleich zum Universum! Trotzdem denkt Gott an ihn. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Sohn des Menschen.
- Seine Erniedrigung: Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Durch seine Menschwerdung und seinen Tod hat Er sich unter die Engel erniedrigt, denn diese himmlischen Geschöpfe können nicht sterben.
- Seine Erhöhung: Gott hat Ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben. Dort sehen wir Ihn im Glauben mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt (Hebräer 2,9). Im Tausendjährigen Reich wird Er als Sohn des Menschen Herrscher über die ganze Schöpfung sein.
Gott wird Christus die Verwaltung von Himmel und Erde anvertrauen (Epheser 1,10). Dadurch wird die göttliche Herrlichkeit auf der ganzen Erde offenbar werden.
Befreiung und Lob
Die gläubigen Juden in der Zukunft werden den Herrn für die Befreiung aus der Hand der Feinde preisen und sich über diese Rettung von Herzen freuen. Sie werden alle Ehre dem Höchsten geben, der im Tausendjährigen Reich von allen Menschen auf der ganzen Erde anerkannt sein wird.
Die Aussage in Vers 4 erinnert an Johannes 18,6, wo der Herr Jesus kurz seine Macht zeigte, so dass seine Feinde zurückwichen und zu Boden fielen. Wie viel mehr wird dies der Fall sein, wenn Er in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Dann werden die Widersacher sogar umkommen.
Gleichzeitig werden die Glaubenden aus Israel nach jahrelanger Unterdrückung und Drangsal zu ihrem Recht kommen. Christus wird als gerechter Richter ihre Sache in die Hand nehmen und ihnen das Erbteil zurückgeben.
Mit dem zweiten Kommen des Herrn wird sich die Situation auf der Erde grundlegend verändern:
- Vorher kann die gottlose Welt unter der Zulassung Gottes ungerecht handeln und die Glaubenden bedrängen. Das Böse kann über das Gute triumphieren.
- Wenn Christus erscheint, wird Er die ganze Erde richten und die Gottlosen bestrafen. Dann wird die Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit triumphieren.
Bis dieser Wechsel stattfindet, ist Gott für die Glaubenden eine hohe Festung. Während sie in einer bösen Welt leben und ungerecht behandelt werden, finden sie bei Ihm ihre Zuflucht. Sie vertrauen auf Ihn und wissen, dass Er sie nie im Stich lassen wird. – Ist das nicht eine grosse Ermutigung für uns?
Das Gericht der Gottlosen
David hält daran fest, dass Zion der Wohnort Gottes auf der Erde ist. Im Blick darauf fordert er die Glaubenden zu zweierlei auf:
- «Singt Psalmen dem Herrn!» – Heute loben die Erlösten ihren Gott und Vater in der Versammlung. Sie beten Ihn als heilige Priester an (1. Petrus 2,5).
- «Verkündet unter den Völkern seine Taten!» – Heute haben die Gläubigen die Aufgabe, ihren Mitmenschen durch ihr Verhalten zu zeigen, wer Gott ist (1. Petrus 2,9).
In der zukünftigen Gerichtszeit wird der Überrest den Herrn um Rettung anrufen, damit er in Zion Gottes Lob verkünden und sich über die Befreiung freuen kann.
Das göttliche Eingreifen im Gericht wird die grosse Wende bringen: Die Glaubenden werden aus den Toren des Todes emporgehoben (Vers 14) und die Ungläubigen werden in die Grube versinken (Vers 16).
Durch die Bestrafung der Gottlosen wird der Herr auf der Erde bekannt gemacht werden (Vers 17). In der Drangsalszeit wird Er sich durch Gericht verherrlichen. Heute verherrlicht Er sich durch Gnade, indem Er das Evangelium verkünden lässt und Menschen errettet, die an den Heiland glauben.
Die Bestrafung der gottlosen Nationen wird gleichzeitig die Befreiung der Gläubigen aus Israel mit sich bringen. Sie werden arm und elend sein, aber der Herr wird sie nicht vergessen – auch wenn es manchmal den Anschein haben wird. Das Gericht Gottes auf der Erde wird bei den Menschen, die verschont werden, Gottesfurcht und Demut bewirken (Vers 21).
Kennzeichen des Gottlosen
In diesem Psalm wird der «Gottlose» mehrmals erwähnt. Im Allgemeinen sind damit Menschen gemeint, die Gott vollständig aus ihrem Leben ausklammern und Feinde der Gläubigen sind. Im Besonderen handelt es sich um den Antichristen, der die Gottlosigkeit und die Gesetzlosigkeit verkörpern wird (2. Thessalonicher 2,3-8).
Die Verse 2-11 beschreiben verschiedene Kennzeichen des Gottlosen:
- Er ist hochmütig und bedrängt den Elenden, der an Gott glaubt (Vers 2).
- In seiner Habsucht und Gier strebt er nach Besitz und Reichtum (Vers 3).
- Er glaubt nicht, dass es einen Gott gibt (Vers 4).
- Äusserlich hat er in seinem Leben Erfolg (Vers 5).
- Er ist überheblich und glaubt, das Glück auf seiner Seite zu haben (Vers 6).
- Seine Worte sind voll Falschheit und Verwünschungen. Man kann ihm nicht trauen (Vers 7).
- Er ist hinterlistig und schreckt weder vor Gewalt noch vor Mord zurück (Vers 8).
- Wie ein Raubtier lauert er auf seine Beute und schlägt plötzlich aus dem Hinterhalt zu (Vers 9).
- Er handelt böse und meint, Gott sehe es nicht (Vers 11). Zu diesem verkehrten Schluss kommt er, weil Gott das Böse oft nicht sofort bestraft (Prediger 8,11).
Wir sind von einer Welt umgeben, die diese Merkmale aufweist. Sie lehnt sich gegen Gott auf und hasst die Gottesfürchtigen. Wir bekommen ihren Widerstand zu spüren, weil wir an den Herrn Jesus glauben (Johannes 15,18).
Gott kommt den Bedrängten zu Hilfe
In der Endzeit werden die Glaubenden aus Israel der Gottlosigkeit ihrer Zeitgenossen besonders stark ausgesetzt sein. In ihrer Not werden sie zu Gott rufen und Ihn bitten, zu ihrer Rettung einzugreifen.
Weil sie an den lebendigen Gott glauben, wissen sie, dass Er alles Böse auf der Erde wahrnimmt. Zu seiner Zeit wird Er einschreiten und die Gottlosen bestrafen. Dieses Bewusstsein stärkt ihr Gottvertrauen:
- Wenn sie verfolgt, geplagt und bedrängt werden, überlassen sie die Vergeltung dem Herrn.
- Wenn sie wie die Waise niemand haben, der sich für sie einsetzt, glauben sie, dass Gott ihr Helfer ist (Psalm 68,6).
Gott wird das Flehen und das Vertrauen der gläubigen Juden erhören. Durch das Gericht am Gottlosen wird Christus sie aus ihrer Bedrängnis befreien. Er wird dafür sorgen, dass seine Autorität als König auf der Erde anerkannt wird.
Diese Gebetserhörung wird den Glauben der Treuen stärken, wie sie es auch in Psalm 138,3 zum Ausdruck bringen: «An dem Tag, als ich rief, antwortetest du mir; du hast mich ermutigt: In meiner Seele war Kraft.» Ihr Gott ist auch unser Gott. Obwohl wir nicht in der gleichen Weise bedrängt werden, können wir doch ähnliche Glaubenserfahrungen machen.
Wenn der Herr Jesus im Tausendjährigen Reich über die Erde regieren wird, wird es für alle Sicherheit und Frieden geben. Die Schwächeren werden nicht mehr benachteiligt werden, denn der Herr wird jeden Morgen die Gottlosen aus dem Land vertilgen (Psalm 101,8).
Gott vertrauen und bei Ihm bleiben
Die Psalmen 9 und 10 beschreiben das gottlose Umfeld, in dem sich die Glaubenden aus Israel in der Zukunft befinden werden. In den Psalmen 11 bis 15 bringen sie ihre Empfindungen und Gefühle mitten in dieser schwierigen Situation zum Ausdruck.
Psalm 11 beantwortet eine wichtige Frage: Was soll der Gläubige tun, wenn die Bosheit und Ungerechtigkeit in der Welt überhandnehmen? Der Unglaube rät zur Flucht: Wenn der Druck des Bösen zunimmt, möchten wir am liebsten wie ein Vogel davonfliegen. Aber der Glaube sucht Hilfe, Bewahrung und Unterstützung bei Gott.
Trotz grosser Turbulenzen auf der Erde bleibt zweierlei wahr:
- Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Obwohl die meisten Menschen nicht nach Ihm und seinem Wort fragen, hält Gott seine heiligen Ansprüche aufrecht.
- In den Himmeln ist sein Thron. Von dort herrscht Er über alles. Nichts läuft Ihm aus den Händen. Die Umwälzungen auf der Erde erschüttern Ihn nicht.
Gott schaut vom Himmel auf die Erde und sieht alles. In seiner gerechten Regierung über die Menschen prüft und erzieht Er die Seinen, damit sie im Glauben Fortschritte machen. Im Gegensatz dazu hasst Er die Ungläubigen, die gottlos und gewalttätig sind. Obwohl Er sie nicht sofort richtet, werden sie seiner Strafe nicht entgehen.
Vers 7 enthält eine Ermutigung für uns: Gott schätzt es, wenn wir gerecht und aufrichtig sind. Er blickt mit Wohlwollen auf uns.
Bei Gott Zuflucht suchen
David kommt sich allein und verlassen vor. Kein gottesfürchtiger Mensch ist in seiner Nähe. Er ist nur von Leuten umgeben, denen er nicht vertrauen kann. Der Herr lässt ihn diese Erfahrung machen, damit er bei Ihm Zuflucht sucht und sich ganz auf Ihn stützt. – Paulus erlebte etwas Ähnliches. Als er sich vor dem römischen Kaiser verantworten musste, stand ihm niemand bei. Da erfuhr er den Beistand des Herrn, der die Seinen nie im Stich lässt (2. Timotheus 4,16-18).
In diesem Psalm stellt David die Worte der Ungläubigen (Psalm 12,3-5) den Worten des Herrn (Vers 7) gegenüber:
- Die Gottlosen lügen und prahlen, um sich selbst gut hinzustellen. Sie schmeicheln, reden trügerisch und geben gross an. – Kommen wir nicht zum gleichen Schluss, wenn wir in den Medien lesen, was die ungläubigen Menschen sagen?
- Im Gegensatz dazu sind die Worte Gottes vollkommen rein. Was in der Bibel steht, ist wahr und zuverlässig (Psalm 19,8-10). – Ist es nicht ein grosser Trost für uns, dass der Herr alle seine Verheissungen erfüllen wird?
Vers 6 wird sich in der Zukunft erfüllen, wenn Lüge und Gottlosigkeit auf der Erde ihren Höhepunkt erreichen werden. Dann wird Gott auf das Flehen der gläubigen Juden antworten. Er wird sie aus grösster Not befreien und vor ihren Bedrängern in Sicherheit bringen.
Vers 8 enthält ein Versprechen, das für alle Zeiten wahr ist. Gott bewahrt die Seinen mitten in einer bösen Welt (Johannes 17,15-17).
Bei Gott verharren
Auch dieser Psalm spricht von den Erfahrungen der Glaubenden aus Israel in der kommenden Drangsalszeit. Sie werden bedrängt und Gott greift nicht ein. Da haben sie den Eindruck, der Herr habe sie vergessen.
Weil sie nicht wissen, wie lange die notvolle Situation noch anhält, fragen sie viermal: «Bis wann?» Trotzdem glauben sie, dass Gott sie aus ihrer Bedrängnis retten wird. Darum beten sie zu Ihm.
In unseren Herzen steigen manchmal ähnliche Gedanken und Gefühle auf. Wir sind in grosser Not und rufen zu Gott um Hilfe. Doch es ändert sich nichts. Da suchen wir unter dem Druck der Umstände selbst nach einer Lösung. Weil wir meinen, wir müssten die Situation aus eigener Kraft in den Griff bekommen, sind wir bekümmert und mit Sorgen erfüllt. Das ändert sich erst, wenn wir unsere Zuflucht zu Gott nehmen und Ihm unsere Anliegen bringen. Dadurch werden unsere Augen erleuchtet, d.h. wir bekommen neue Zuversicht.
Der Psalm endet mit einem herrlichen Glaubenssieg. Die Situation hat sich nicht verändert, aber das Herz ist wieder auf den Herrn ausgerichtet.
- Das Gebet zu Gott bewirkt Vertrauen in seine Güte. Der Glaubende hält fest, dass der Herr die Seinen nie im Stich lässt und sie zur rechten Zeit rettet.
- Dieses Gottvertrauen ruft im Herzen Freude über Gottes Rettung hervor, obwohl Er noch nicht eingegriffen hat.
- Diese Freude führt zum Lob Gottes. Der Gläubige rühmt die Wohltaten des Herrn, die er in der künftigen Befreiung erfahren wird (2. Chronika 20,19).
Der gottlose Mensch
In der zukünftigen Drangsalszeit wird das Böse auf der Erde den Höhepunkt erreichen. Was vom natürlichen Menschen in diesem Psalm gesagt wird, ist immer wahr, wird sich dann aber völlig entfalten.
Der törichte und gottlose Mensch will nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Weil er die göttliche Autorität nicht anerkennt, sündigt er skrupellos.
Aber der Herr sieht alles, was auf der Erde geschieht. Sein Urteil ist eindeutig: Von Natur aus ist kein Mensch gut. Alle sind von ihrem Schöpfer abgewichen und haben ein verdorbenes Herz. In Römer 3 zitiert Paulus diese Aussage, um die gesamte Menschheit von ihrer Schuld vor Gott zu überzeugen. Nachdem er klargemacht hat, dass alle das göttliche Gericht verdient haben, stellt er die Erlösung vor: Wer an die Person und das Werk des Herrn Jesus glaubt, wird von Gott gerecht gesprochen.
In den Versen 4-6 erkennen wir einen Sachverhalt, der sich immer wieder zeigt: Menschen, die nicht an Gott glauben und sich Ihm widersetzen, sind auch gegen die Gläubigen feindlich eingestellt. Sie fürchten sich sogar vor ihnen, weil sie wahrnehmen, dass Gott in ihrer Mitte ist. Ein Beispiel dafür sind die Kanaaniter. Sie glaubten nicht an den lebendigen Gott und widerstanden den Israeliten beim Einzug ins Land Kanaan. Gleichzeitig fürchteten sie sich vor ihnen, weil der Herr mit Israel war (Josua 2,9-11).
Der letzte Vers weist deutlich auf die Zukunft hin. Die gläubigen Juden leiden unter dem Druck der Gottlosen, erwarten aber die Rettung vom Herrn.
Merkmale des Gottesfürchtigen
In Vers 1 stellt der gläubige Überrest aus Israel eine Frage: Wer wird am Segen des Tausendjährigen Reichs teilhaben, wenn der Herr den Sitz seiner Regierung in Zion aufschlagen wird?
Ab Vers 2 folgt die Antwort: Es sind Menschen, die in Übereinstimmung mit Gott leben, weil sie eine Glaubensbeziehung zu Ihm haben. Aus den einzelnen Merkmalen, die aufgezählt werden, lernen wir, wie auch wir ein Leben zur Ehre des Herrn führen können:
- In Vers 2 geht es um unseren persönlichen Charakter als Glaubende: Er soll durch eine aufrichtige Lebensführung, gerechte Handlungen und wahre Worte gekennzeichnet sein.
- Vers 3 befasst sich mit unserem Verhältnis zu denen, die uns nahestehen: Wie schnell reden wir schlecht über unsere Mitmenschen. Das soll jedoch nicht vorkommen. Echte Gottesfurcht bewahrt uns davor, dass wir einander in der Ehe und Familie Böses tun.
- In Vers 4 wird die richtige Einstellung zu Gut und Böse gezeigt. Wenn wir uns am Massstab des Wortes Gottes ausrichten, verurteilen wir das Böse und anerkennen alle, die Gott gefallen möchten. Ausserdem achten wir darauf, dass unsere innere Haltung nicht durch den Einfluss der Welt verändert wird.
- Vers 5 betrifft unser Verhalten in der Geschäftswelt und bei der Arbeit. Wir sollen immer ehrlich sein und nie jemand übervorteilen.
Der Psalm endet mit einer Verheissung: «Wer dies tut, wird nicht wanken in Ewigkeit.» Ist das nicht ein Ansporn für uns, gottesfürchtig zu leben?
Christus als der vollkommene Mensch
Dieser Psalm spricht prophetisch vom Herrn Jesus, wie Er für Gott gelebt und Ihm vollkommen gedient hat.
Abhängigkeit von Gott und Vertrauen auf Ihn prägten sein tägliches Leben (Vers 1). Freiwillig unterordnete Er sich als Mensch der Autorität Gottes (Vers 2). Zugleich freute Er sich an allen, die in Israel Buße taten und sich von Johannes taufen liessen (Vers 3). Mit diesen «Herrlichen» verband Er sich.
Dem Herrn Jesus genügte sein Gott völlig (Vers 5). Er war ganz auf Ihn ausgerichtet. Alles, was Ihm begegnete, nahm Er aus der Hand Gottes an. Er betrachtete die einzelnen Lebenssituationen als liebliche Örter, weil Er wusste, dass Er sich auf dem Weg Gottes befand (Vers 6).
Jesus Christus liess sich jeden Morgen das Ohr öffnen, um von Gott belehrt zu werden (Jesaja 50,4). So bekam Er täglich göttlichen Rat und Wegweisung (Vers 7). In allem, was der Herr tat, hatte Er immer Gott vor sich (Vers 8). Nie wandte Er sein Auge von Ihm ab, sondern lebte in ununterbrochener Gemeinschaft mit seinem Vater (Johannes 14,31; 16,32).
Im Blick auf seinen Tod und seine Auferstehung setzte Er die Hoffnung auf seinen Gott und wurde nicht enttäuscht (Psalm 16,9.10). Gott sorgte dafür, dass Er würdig begraben wurde und die Verwesung nicht sah. Weil der Herr Jesus fromm und gottesfürchtig gelebt hatte, auferweckte Ihn Gott. 40 Tage nach seiner Auferstehung fuhr Er in den Himmel auf. Dort – in der Gegenwart Gottes, am Ort völliger Freude – nahm Er als Mensch den Platz zur Rechten Gottes ein (Vers 11; Hebräer 12,2).
Einige Psalmen sprechen eindrücklich von Christus, z.B. Psalm 2, 8, 16, 22 oder 40. Buchtipp dazu: Christus in den Psalmen
Gerecht und gottesfürchtig leben
Auch dieser Psalm enthält viele prophetische Hinweise auf den Herrn Jesus.
Weil Er in seinem Leben gerecht handelte und wahr redete, konnte Er immer freimütig zu Gott beten (Vers 1). Nie setzte Er seine Rechtsansprüche durch, sondern übergab sich dem, der gerecht richtet (Jesaja 49,4; 1. Petrus 2,23). Seine Bitte war, dass Gott sein Recht ausführe (Vers 2).
Gott sah nicht nur, wie vollkommen Christus lebte. Er prüfte auch sein Herz und stellte dabei fest, dass die Gedanken und Empfindungen des Herrn Jesus ebenfalls tadellos waren (Vers 3). Es gab überhaupt keine Ungleichheit zwischen dem inneren und äusseren Leben unseres Herrn (Johannes 8,25).
Das Wort Gottes leitete Ihn in allem, was Er tat (Vers 4). Als der Teufel Ihn in der Wüste versuchte, wich Er keinen Schritt vom rechten Weg ab, weil das Wort die absolute Richtschnur seines Handelns war. Lieber wollte Er Hunger leiden, als ungehorsam sein.
Obwohl der Herr im Voraus wusste, dass der Weg, den Gott Ihn auf der Erde führte, viele Leiden mit sich bringen und am Kreuz enden würde, hielt Er an den Spuren Gottes fest (Vers 5). Er machte sein Angesicht wie einen Kieselstein und ging mit Entschiedenheit hinauf nach Jerusalem und hinaus nach Golgatha (Lukas 9,51; Johannes 19,17).
Auf diesem Weg erfuhr Jesus Christus den Widerstand seiner Feinde. Aber Er wusste, dass Gott alle rettet, die auf Ihn vertrauen. Darum nahm Er im Gebet Zuflucht zu Ihm (Psalm 17,6.7).
Rettung vor dem Gottlosen
Das gerechte und aufrichtige Verhalten des Herrn Jesus rief einerseits eine besondere Wertschätzung vonseiten Gottes (Vers 8) und anderseits den Widerstand vonseiten der Ungläubigen hervor (Vers 9). Darum bewahrte Ihn Gott, so dass die Menschen Ihm nichts antun konnten, solange die Stunde des Menschen und die Gewalt der Finsternis noch nicht gekommen war (Lukas 22,53).
Die Verse 10 und 11 beschreiben die ungläubigen Menschen, wie Christus sie erlebte und wie die treuen Juden in der Zukunft sie erfahren werden:
- «Ihr fettes Herz verschliessen sie.» Obwohl sie im Wohlstand leben, helfen sie den Notleidenden nicht (Matthäus 12,9-14).
- «Mit ihrem Mund reden sie stolz.» Sie sind hochmütig und geben gern gross an (Johannes 8,33).
- «Bei unseren Schritten haben sie uns jetzt umringt.» Sie bedrängen die Gerechten (Lukas 11,53).
- «Sie richten ihre Augen darauf, uns zu Boden zu strecken.» Sie verfolgen die Heiligen bis aufs Blut (Lukas 22,2).
Ab Vers 13 ruft Jesus zu Gott und bittet Ihn um Rettung vor dem Gottlosen und von den Leuten dieses Zeitlaufs. Gott erhörte dieses Gebet und rettete Christus nach seinem Tod durch die Auferstehung aus der Hand der ungläubigen Menschen (Hebräer 5,7). Als Auferstandener verliess Er die Welt, kehrte in den Himmel zurück und ging in die strahlende Herrlichkeit der Gegenwart Gottes ein. Aufgrund seiner persönlichen Gerechtigkeit stand Ihm als Mensch dieser Wechsel in die himmlische Welt zu.
Gottes Lob für seine Rettung
Dieser Psalm ist ein Lied von David, das die Rettung besingt, die Gott ihm von allen seinen Feinden verschafft hat. Gleichzeitig ist es eine Beschreibung der Geschichte Israels von der Befreiung aus Ägypten bis zur Einführung ins Tausendjährige Reich. Immer wieder gibt es auch einen Bezug zu Christus, der Ähnliches wie das Volk Israel durchlebt hat.
Zuerst lobt David den Herrn für die Rettung und beschreibt, wie er Gott erfahren hat. Er hat ihm Kraft gegeben, ihn aus Gefahren gerettet und vor Feinden beschützt. – Genauso können wir in allen Situationen des Lebens mit Gott rechnen. Er wird auch uns zu Hilfe kommen.
In den Versen 5-7 erkennen wir den Herrn Jesus, wie Er die Leiden des Todes erduldete. Es war furchtbar für Ihn, dass die Menschen Ihn an ein Kreuz nagelten und umbrachten. Doch Gott hörte auf sein Rufen und auferweckte Ihn aus den Toten.
Die Verse 8-16 weisen mehr auf das hin, was das Volk Israel in Ägypten erlebte. In dieser poetischen Beschreibung erkennen wir einzelne Plagen, die das Land Ägypten trafen: Hagel, Finsternis (2. Mose 9,23; 10,22). Ausserdem wird Gottes Handeln am Schilfmeer beschrieben. Er spaltete das Meer für die Israeliten und verwirrte die ägyptische Armee, die ihnen nachjagte (2. Mose 14,21-25). Das war damals eine gewaltige Machtentfaltung Gottes zur Befreiung Israels und im Gericht an Ägypten. Auf ähnliche Weise wird Er in der zukünftigen Gerichtszeit zur Rettung seines Volkes eingreifen.
Der HERR rettet und belohnt
Die Verse 17-20 sprechen einerseits davon, wie Gott das Volk Israel von allen Feinden rettete und ins verheissene Land brachte. Anderseits wird hier von Christus gesprochen, wie Gott Ihn nach dem Tod durch die Auferweckung dem Zugriff der ungläubigen Menschen entzog. Nachdem der Soldat die Seite des Herrn Jesus durchstochen hatte, konnte Ihn kein Gottloser mehr antasten.
Wenn wir die Verse 21-25 auf David anwenden müssten, kämen wir in Schwierigkeiten. Nur Einer konnte diese Worte aussprechen – Jesus Christus, der vollkommene Mensch. Er lebte gerecht, blieb immer rein, wich nie von seinem Gott ab und befolgte jederzeit das Wort Gottes. Als Einziger war Er völlig untadelig, so dass der Herr Ihm nach seiner Gerechtigkeit vergalt und Ihn aus den Toten auferweckte.
Sein vollkommenes Leben zeigt uns, was Gott auch bei uns wertschätzt und belohnt. Er freut sich, wenn wir dem Beispiel unseres Herrn folgen und Ihn in unserem Verhalten nachahmen (1. Petrus 2,21-23).
Die Verse 26 und 27 stellen die Grundsätze der gerechten Regierungswege Gottes mit den Menschen und im Besonderen mit den Glaubenden vor. Es wird hier klar, dass wir das ernten, was wir gesät haben (Galater 6,7). Wenn wir gütig sind, erfahren wir Gottes Güte. Wenn wir verkehrt handeln, muss der Herr uns widerstehen.
Vers 28 zeigt, dass Gott auch gnädig mit uns ist. Er erbarmt sich über uns und hilft uns in notvollen Situationen. Mit einer demütigen Gesinnung erschliessen wir uns die Quelle seiner Gnade.
Mit Gott einen Sieg erringen
Die Erfahrungen Davids mit seinem Gott in den Versen 29-32 machen uns Mut, den Glaubensweg vertrauensvoll mit dem Herrn zu gehen:
- Auf dunklen Strecken gibt Er uns durch sein Wort Licht (Psalm 119,105).
- Mit unserem Gott sind wir in der Lage, dem Feind kühn entgegenzutreten und Hindernisse zu überwinden.
- Auch wenn wir nicht jede Führung des Herrn in unserem Leben verstehen, wollen wir doch im Glauben festhalten, dass sein Weg vollkommen ist.
- Gott kann uns auf dem Weg zum himmlischen Ziel bewahren (Judas 24). Suchen wir Schutz bei Ihm!
Wenn wir unseren Gott auf diese Weise im Alltag erleben, wird Er uns noch grösser und wichtiger (Vers 32).
Ab Vers 33 wird der Kampf beschrieben, den Christus in der Zukunft gegen seine Feinde führen wird, um sein Reich auf der Erde aufzurichten. Er wird hier als Mensch gesehen, wie Er in Abhängigkeit von Gott alles ausführen wird. Der Herr wird Ihm die Kraft für den Kampf geben und Ihm zum Sieg verhelfen. Sein Triumph wird gross sein. Seine Feinde werden nicht vor Ihm bestehen können. Er wird sie wie Staub vor dem Wind zermalmen (Vers 43). Das erinnert uns an den Traum von Nebukadnezar im Propheten Daniel. Der König von Babel sah ein grosses Standbild, das von einem Stein zermalmt wurde. Dieser Stein ist ein Bild vom Herrn Jesus, wie Er alle Weltmächte besiegen wird, um dann ein Königreich aufzurichten, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird (Daniel 2,44.45).
Christus als König der Könige
Die Verse 44-46 beschreiben die Macht und Herrschaft des Herrn Jesus als König der Könige im Tausendjährigen Reich. Er wird von Gott als Regent über alle Völker eingesetzt werden:
- Das wiederhergestellte Israel – bestehend aus dem gläubigen Überrest – wird Ihn bereitwillig als König anerkennen und Ihm dienen (Psalm 110,3).
- Weil seine Macht und Herrlichkeit so aussergewöhnlich sein werden, werden sich die Menschen aus den Nationen sofort seiner Autorität beugen und Ihn als Weltenherrscher akzeptieren.
- Einige ihrer Nachkommen – die Söhne der Fremde – werden sich nur mit Schmeichelei unterordnen. Am Ende der 1000 Jahre Friedensherrschaft werden sie sich unter der Führung Satans gegen den Herrn auflehnen und gerichtet werden (Offenbarung 20,7-10).
Nach dem Sieg über seine Feinde wird Christus mit dem befreiten Überrest aus Israel den Herrn für die Errettung loben (Psalm 18,47-51). Durch diesen Lobpreis werden sie den lebendigen Gott unter den Völkern bekannt machen.
Wir können diese Schlussverse in zweierlei Weise auf uns übertragen:
- Wir verkündigen jetzt in unserem Leben die Eigenschaften Gottes, der uns aus der Gewalt der Finsternis errettet und in das Reich seines Sohnes versetzt hat (1. Petrus 2,9; Kolosser 1,13).
- In der Zukunft werden wir vor aller Welt ein Zeugnis für unseren Herrn sein, der uns errettet, bewahrt und ans Ziel gebracht hat (2. Thessalonicher 1,10).
Das Zeugnis der Schöpfung
Dieser Psalm kann in zwei Teile gegliedert werden: In den Versen 1-7 erfahren wir etwas von der Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Die Verse 8-15 beschreiben, wie sich der Herr durch das geschriebene Wort Gottes zu erkennen gibt.
Es ist hier vor allem der Himmel, der die Herrlichkeit und Allmacht des Schöpfers bezeugt. Das hat zwei Gründe:
- Erstens ist der Himmel nicht so vom Menschen verdorben worden wie die Erde. Auf unserem Planeten sehen wir doch vielerorts die negativen Folgen der Sünde. Aber der Blick zum Sternenhimmel gibt uns einen deutlichen Eindruck von der Grösse Gottes.
- Zweitens kann jeder Mensch auf der Erdkugel dieses Zeugnis Gottes sehen. Überall ist es z.B. möglich, den herrlichen Anblick eines Sonnenaufgangs zu betrachten.
Die Schöpfung bezeugt ohne Worte die Existenz des allmächtigen Gottes. Es ist eine stumme Demonstration seiner Herrlichkeit. Trotzdem ist es eine deutliche Sprache an den Menschen. Der Apostel Paulus drückt es so aus: «Das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden» (Römer 1,20).
Gott offenbart sich in der Schöpfung, damit die Menschen, die sonst nichts von Ihm wissen, Ihn kennen lernen können. Er möchte, dass sie sich seiner Autorität beugen und Ihn verehren. Doch die meisten tun es nicht. Anstatt ihren Schöpfer zu verherrlichen, machen sie eigene Götter, die sie anbeten (Römer 1,21-23).
Das Zeugnis des Wortes Gottes
In den Versen 8-10 benutzt der Psalmdichter verschiedene Ausdrücke für das Wort Gottes. Er beschreibt, wie es ist und was es bewirkt:
- Die Bibel ist vollkommen, denn der Geist Gottes hat den Schreibern alles wörtlich eingegeben. Wir können uns voll auf ihre Aussagen verlassen. Alles, was in diesem Buch steht, erweist sich als richtig. Das Wort Gottes enthält keine Hintergedanken, es ist lauter, rein und wahr. Im Gegensatz zu dem, was Menschen sagen oder schreiben, besteht die Bibel ewig (Jesaja 40,8; Matthäus 24,35).
- Das Wort Gottes stellt uns innerlich wieder her, gibt uns Weisheit für den Glaubensweg und schenkt Freude ins Herz (Psalm 119,162). Es erleuchtet unsere Augen, damit wir eine Situation richtig beurteilen können. Wenn wir die Bibel lesen und das Wort Gottes aufnehmen, bekommen wir für alles die rechte Sicht.
Der Wert des Wortes Gottes ist unermesslich, er übersteigt jeden materiellen Reichtum (Gold) und ist besser als jeder natürliche Genuss (Honig).
Doch es stellt sich die Frage: Wie stehen wir zur Bibel? Sind wir Knechte, die sich dem Wort Gottes unterordnen und es im Alltag befolgen? Dann kann Gott uns durch sein Wort von verborgenen Sünden reinigen und vor Fehltritten bewahren.
Der Herr hört alle unsere Worte und nimmt alle unsere Überlegungen wahr. Das soll uns dazu bringen, unsere Zunge zu zügeln und schlechte Gedanken zu verurteilen. Wie freut Er sich, wenn wir Ihm auch darin gefallen möchten!
Gott rettet seinen Christus
In diesem Psalm sprechen die Glaubenden aus Israel zu Christus über seine Leiden vonseiten seines Volkes.
Der Herr Jesus wurde von der jüdischen Führungsschicht bedrängt und mithilfe der Römer ans Kreuz gebracht. In dieser Not rief Er zum Herrn und wurde erhört. Er musste zwar durch den Tod gehen, aber Gott sorgte für eine würdige Grablegung, so dass der Körper des Herrn in Sicherheit ruhen konnte (Vers 2).
Jesus Christus durfte mit der göttlichen Hilfe rechnen, weil Er immer mit der Heiligkeit und Gnade Gottes übereinstimmte (Vers 3).
- Er war in seinem Leben das vollkommene Speisopfer. Er tat nie eine Sünde und lebte in ganzer Hingabe an Gott.
- Am Kreuz gab der Herr Jesus als das wahre Brandopfer sein Leben, um Gott unendlich zu verherrlichen.
Darum rettete Gott Ihn aus dem Tod, indem Er Ihn nach drei Tagen zum Leben auferweckte. Er nahm seinen Gesalbten in den Himmel auf und setzte Ihn zu seiner Rechten. Freuen wir uns mit Ihm über diese Ehre?
Die Leute, die ohne Gott leben, stützen sich in Notsituationen auf menschliche Hilfsmittel. Sie zählen auf ihre eigenen Möglichkeiten – und werden über kurz oder lang scheitern. Aber die Gläubigen, die ihr Leben mit Gott führen, handeln anders. Weil sie gesehen haben, wie Er seinen Christus erhört und errettet hat, rechnen sie mit seiner Unterstützung – und werden nicht beschämt. In Jeremia 17,5-8 wird dieser doppelte Grundsatz bestätigt: Wer auf Menschen vertraut, hat kein Gelingen. Wer sich jedoch auf den Herrn verlässt, ist reich gesegnet.
Gott verherrlicht seinen Christus
Dieser Psalm beschreibt die Herrlichkeit des Herrn Jesus – und zwar aus dem Blickwinkel des Volkes Israel:
- Gott hat seine Macht entfaltet, um seinen Christus aufzuerwecken. Dadurch hat Er Ihn aus dem Tod errettet (Vers 2).
- Gott ist Ihm mit Segnungen entgegengekommen und hat Ihn zum König über Israel bestimmt (Vers 4). Wenn Er zum zweiten Mal zu seinem Volk kommen wird, wird Ihn ein gläubiger Überrest annehmen.
- Gott hat den Herrn Jesus erhört: Er ist auferweckt worden, um ewig zu leben (Vers 5). Auf seine Bitte: «Nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage!», hat Er zur Antwort bekommen: «Von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre» (Psalm 102,25).
- Gott hat Ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Bald wird seine Majestät und Pracht vor aller Welt sichtbar werden (Vers 6).
- Gott hat seinen Christus zum Vermittler seines Segens gemacht (Vers 7). Unter seiner Regierung werden alle Völker der Erde gesegnet sein (1. Mose 22,18).
Der Grund, warum sich die Bitten und Wünsche des Herrn Jesus erfüllen, ist sein vollkommenes Gottvertrauen.
Wenn Christus als König der Könige auf der Erde erscheinen wird, wird sein gerechter Zorn alle Feinde treffen (Psalm 21,9-13). Obwohl sie mit riesigen Heeren gegen Ihn antreten werden, werden sie nichts gegen Ihn vermögen (Offenbarung 19,19-21). Keiner, der sich Ihm widersetzt, wird der Strafe entgehen. Die Glaubenden aus Israel werden sich über seinen Sieg freuen und den Herrn dafür loben (Vers 14).
Leiden im Verlassensein von Gott
Dieser Psalm spricht prophetisch vom Herrn Jesus. Das Hauptthema sind seine tiefen Leiden in den drei Stunden der Finsternis (Matthäus 27,45.46). Weil Gott zu rein ist, um Böses zu sehen, musste Er sich vom Heiland abwenden, als Dieser die Strafe für unsere Sünden trug und zur Sünde gemacht wurde.
In seiner Not rief Jesus: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Wie furchtbar war es für Ihn, der sein ganzes Leben mit Gott geführt hatte, nun von Ihm verlassen zu sein! Dennoch hielt Er in tiefem Vertrauen an seinem Gott fest. Er rechtfertigte sogar Gottes Handeln mit den Worten: «Doch du bist heilig.» Er wusste, dass die göttliche Heiligkeit dieses furchtbare Gericht forderte, damit sündige Menschen begnadigt werden können.
Die Glaubensmänner im Alten Testament setzten ihr Vertrauen auf Gott. In Notsituationen riefen sie zu Ihm und wurden erhört. Aber der Herr Jesus, der wie kein anderer vollkommen auf seinen Gott vertraute, bekam keine Antwort. Er erlebte etwas, was es noch nie gegeben hatte und nie wieder geben wird: Der Gerechte wurde von Gott verlassen!
Er litt auch unter dem Hohn und der Verachtung der Menschen. Sie verspotteten sein Gottvertrauen, weil der Allmächtige nicht eingriff und Ihn vom Kreuzestod rettete. Trotzdem blieb Er seinem Gott treu, dem Er von Jugend an völlig vertraut hatte. Als alles gegen Ihn war und die Wellen des göttlichen Gerichts über Ihn hingingen, sagte Er mit tiefster Überzeugung: «Du bist mein Gott.»
Leiden von den Menschen
Was der Heiland am Kreuz vonseiten der Menschen erduldete, bringt Er prophetisch in den Versen 12-19 zum Ausdruck:
- Er vergleicht die jüdische Führungsschicht mit starken Stieren. Sie hatten ihre Macht und ihren Einfluss benutzt, um Ihn zum Tod zu bringen. Nun standen diese vornehmen Männer beim Kreuz und öffneten ihren Mund, um den Herrn Jesus zu verspotten (Matthäus 27,41-43).
- Der Heiland spricht auch über seine körperlichen Leiden. Seine Gebeine zertrennten sich, sein Herz war einer erheblichen Belastung ausgesetzt und starker Durst quälte Ihn. In all diesen Schmerzen wusste Er, dass Gott Ihn in den Staub des Todes legte. Er war bereit, am Kreuz zu sterben, weil es Gottes Wille war.
- Die grausamen römischen Soldaten nennt Er Hunde. Sie trieben die Nägel durch seine Hände und seine Füsse, um Ihn am Kreuz zu befestigen (Lukas 23,33). Sie nahmen Ihm auch die Kleider weg und verteilten sie unter sich (Johannes 19,23.24). Als Christus am Kreuz hing, war Er dem Blick der Schaulustigen ausgesetzt. Welche Schmach!
Der Heiland rief zu Gott um Hilfe. Doch Er wurde nicht erhört: Das Schwert Gottes wandte sich gegen Ihn und strafte Ihn für fremde Schuld. Satan begegnete Ihm mit seiner ganzen Macht wie ein brüllender Löwe.
Erst als die drei Stunden der Finsternis vorüber waren und der Herr Jesus im Begriff stand, sein Leben zu lassen, war die Gemeinschaft mit Gott wieder da. Nun konnte Er sagen: «Du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel.»
Segen aus den sühnenden Leiden
Auf die sühnenden Leiden des Herrn Jesus folgt der göttliche Segen für die Menschen. Sein Werk am Kreuz bringt herrliche Resultate hervor:
- Der erste Kreis von Glaubenden, die in den Genuss dieses Segens kommen, sind die Jünger, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind (Psalm 22,23-25). Sie werden auf der Erde in die Beziehung zu Gott, dem Vater, gebracht (Johannes 20,17). In ihrer Mitte stimmt Christus das Lob zur Ehre Gottes an. Alle, die in der Zeit der Gnade an den Heiland glauben, gehören auch zu dieser Gruppe.
- Der zweite Kreis von Menschen, die aufgrund des Erlösungswerks von Gott gesegnet werden, sind die Glaubenden aus dem Volk Israel in der Zukunft (Psalm 22,26-27). Sie bilden die grosse Versammlung, die sich um Christus, ihren König, vereinen wird. Auch sie öffnen ihren Mund zum Lob Gottes.
- Der dritte Kreis umfasst alle glaubenden Menschen aus den Nationen, die ins Tausendjährige Reich eingehen werden (Psalm 22,28-30). Auch für sie gilt das Erlösungswerk von Golgatha. Unter der Herrschaft des Herrn Jesus werden sie auf der Erde einen bis dahin nie gekannten Frieden geniessen.
- Der vierte Kreis betrifft die Menschen, die im Friedensreich geboren werden und an den Herrn Jesus glauben (Psalm 22,31.32). Sie gehören ebenfalls zur Frucht seiner Leiden.
Der Psalm endet mit den Worten: «Dass er es getan hat.» Das Werk, das der Heiland am Kreuz vollbracht hat, wird die Herzen der Glaubenden immer wieder neu berühren und der Grund ihrer ewigen Anbetung sein.
Die Fürsorge des Hirten
Psalm 23 knüpft an Psalm 22 an. Weil der gute Hirte am Kreuz gelitten hat und gestorben ist, kann jeder, der an Ihn glaubt, sagen: «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.» Wie wahr diese Aussage ist, zeigen die weiteren Verse. Sie beschreiben die unermüdliche und vielseitige Fürsorge des Hirten, die wir täglich erfahren.
- Er lagert uns auf grünen Auen, um uns in seiner Gemeinschaft Momente der Ruhe zu schenken.
- Er stillt den Durst der Seele, indem Er uns zeigt, wie gross und herrlich Er ist.
- Durch sein Wort schenkt Er uns innere Erfrischung. Wenn wir gesündigt haben, stellt Er uns wieder her.
- Er leitet uns auf einem Weg, der mit Gott und seinem Wort übereinstimmt.
- In Notsituationen ist Er uns ganz nahe. Weil Er uns beisteht, brauchen wir uns nicht zu fürchten.
- Mit dem Stecken schützt Er uns vor den Angriffen des Feindes und mit dem Stab bewahrt Er uns vor einem Fehltritt oder einem verkehrten Weg.
- Der Tisch, den der Hirte für uns bereit macht, spricht von der geistlichen Nahrung, die Er uns aus dem Wort Gottes zur Stärkung unseres Glaubens gibt.
- Die Salbung mit Öl weist auf den Segen des Heiligen Geistes hin, der in uns wohnt und uns eine Freude gibt, die den Becher überfliessen lässt.
- Jeden Tag können wir mit der Güte und Gnade des Herrn rechnen (Johannes 1,16).
- Vor uns liegt ein herrliches Ziel. Wir werden ewig im Haus des Vaters sein (Johannes 14,2.3).
Der König der Herrlichkeit
Wie David ist der Herr Jesus nicht nur Hirte (Psalm 23), sondern auch König (Psalm 24). Alles, was auf der Erde ist, gehört Ihm, weil Er der Schöpfer ist. Im Tausendjährigen Reich wird Er diesen Besitz- und Herrschaftsanspruch geltend machen.
Nun stellt sich die Frage: Wer wird bei seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit vor Ihm bestehen können? Es sind die Menschen, die an Gott glauben und sich deshalb so verhalten, wie es Ihn ehrt (Vers 4). Sie werden am göttlichen Segen im Reich des Herrn teilhaben, weil sie ihr Leben auf Gott ausrichten und das Wohl des Volkes Israel suchen (Vers 6). – Daraus können wir etwas für uns lernen: Wenn wir das tun, was dem Herrn Jesus gefällt, und uns für das Wohl unserer Mitchristen einsetzen, wird Gott uns segnen.
Der höchste Segen im Friedensreich wird darin bestehen, dass der Herr selbst durch die Tore Jerusalems eintreten wird. Es ist Christus, der Sohn Gottes, der dort als König der Herrlichkeit seine gerechte Regierung ausüben wird.
Vor ungefähr 2000 Jahren ist Er auf einem Esel reitend in die Stadt Jerusalem eingezogen. Doch die Menschen wollten Ihn nicht annehmen. Sie riefen einige Tage später Pilatus zu: «Kreuzige ihn!» In der Zukunft wird es anders sein. Ein gläubiger Überrest aus Israel wird die Tore Jerusalems bereitwillig für Christus öffnen und Ihn mit Freuden als König aufnehmen.
Seine Macht und Autorität wird so gross sein, dass Er alle seine Feinde schlagen wird. Jeder wird Ihn als Weltenherrscher anerkennen müssen.
Auf die Führung Gottes vertrauen
Dieser Psalm bringt die Empfindungen der Gläubigen aus Israel in der zukünftigen Drangsalszeit zum Ausdruck. Sie vertrauen auf Gott und möchten sich von Ihm leiten lassen. Das tiefe Bewusstsein ihrer Sünden bringt sie dazu, darüber Buße zu tun und sich ganz auf die göttliche Gnade zu stützen.
Wir finden in diesem Psalm auch manche Belehrung und Ermutigung für uns. Wenn wir in den Schwierigkeiten beim Herrn Hilfe suchen und das Vertrauen auf Ihn setzen, werden wir nie enttäuscht. Wir stehen dann in Verbindung mit dem grossen, allmächtigen Gott, der jedes Problem lösen und jedes Hindernis aus dem Weg räumen kann.
Auf das Gottvertrauen folgt der Wunsch, den Weg des Herrn zu wissen, damit wir im Glauben mit Ihm vorangehen können. Je genauer wir die Wahrheit im Wort Gottes kennen, desto besser können wir in Übereinstimmung mit unserem Herrn leben.
Für diesen Weg sind wir jeden Tag auf die Güte und das Erbarmen Gottes angewiesen. Wenn es auf uns ankäme, könnten wir keinen Schritt zur Ehre des Herrn gehen. Wie oft haben wir schon eigenwillige und verkehrte Wege eingeschlagen! Trotzdem hat Gott uns nicht aufgegeben. In seiner Gnade hat Er uns zur Umkehr und zum Bekenntnis unserer Sünden gebracht. Damit wir nun den richtigen Weg gehen können, unterweist Er uns in der Gerechtigkeit.
Das Handeln Gottes mit uns ist durch Güte und Wahrheit gekennzeichnet. Darum wollen wir sein Wort festhalten und dem Herrn von Herzen gehorchen.
Der HERR bewahrt den Gottesfürchtigen
Ehrfurcht vor Gott ist ein Merkmal, das zu jeder Zeit seine Anerkennung findet. Wer gottesfürchtig lebt, ist sich seiner Verantwortung gegenüber Gott bewusst. Darum möchte er nichts tun, was Ihm missfällt. Zwei Verheissungen werden ihm gegeben:
- Der Herr wird ihm einen Weg zeigen, auf dem er von der Welt bewahrt bleibt und zur Ehre Gottes leben kann (Vers 12).
- Der Herr teilt dem Gottesfürchtigen seine Gedanken und Pläne mit (Vers 14). Ein schönes Beispiel dafür ist Abraham (1. Mose 18,17).
Solange wir unsere Augen auf Gott richten und Ihm vertrauen, werden wir auf dem Glaubensweg trotz Gefahren sichere Schritte tun können (Vers 15).
Ab Vers 16 hören wir, wie die Glaubenden aus Israel in der Zukunft zum Herrn beten. Sie besitzen keine Heilssicherheit, hoffen aber auf die Gnade Gottes. Die Bedrängnis von aussen führt sie dazu, ihre Sünden zu erkennen und Gott um Vergebung anzurufen. Wir sehen hier deutlich, wie der Herr den Druck der Umstände dazu benutzt, um ein Werk der Wiederherstellung in ihren Herzen zu vollbringen.
Sie sind von vielen Feinden umgeben: Die ungläubigen Juden unter der Führung des Antichristen verfolgen sie. Die Nachbarvölker bedrängen sie und der König des Nordens bereitet eine Invasion gegen Israel vor. In dieser Situation, die menschlich aussichtslos ist, nehmen sie Zuflucht zu Gott. Mit offenen und ehrlichen Herzen rufen sie Ihn um Bewahrung und Rettung an.
Ein gutes Gewissen vor Gott
Das Thema dieses Psalms ist die Aufrichtigkeit des Glaubenden vor Gott. Er möchte ein gutes Gewissen vor dem Herrn haben und Ihm vertrauen. Die Beurteilung seiner Beweggründe überlässt er Gott, indem er sagt: «Läutere meine Nieren und mein Herz!»
Von David, der diesen Psalm gedichtet hat, konnte der Herr sagen, dass er aufrichtig und lauter war (Psalm 78,72; 1. Könige 9,4). Aber nur Jesus Christus war vollkommen aufrichtig. In seinem Inneren war nichts da, was Gott hätte verurteilen müssen (Psalm 17,3).
Die Verse 3-5 zeigen, warum der Glaubende sich von Gott prüfen lassen möchte:
- Er ist sich bewusst, dass der Herr ihn nach seiner Güte beurteilen wird.
- Er lebt nach der göttlichen Wahrheit, darum muss er sich nichts Verkehrtes vorwerfen.
- Er sondert sich von der gottlosen Welt ab und sieht das Böse so, wie Gott es beurteilt.
Nachdem der Gläubige sich selbst geprüft und – wenn nötig – gereinigt hat, kann er mit der richtigen Haltung in die Gegenwart Gottes treten (Vers 6). Dort umgeht er den Altar und betrachtet das Opfer von allen Seiten. Die Folge davon ist, dass er seinen Gott lobt. – So wird auch uns die Beschäftigung mit der Person und dem Werk des Herrn Jesus zur Anbetung führen.
Das Herz der gläubigen Israeliten schlägt für den Tempel, weil Gott seine Herrlichkeit dort offenbart. – Lieben wir den Ort, wo der Herr Jesus in der Mitte der Seinen ist und ihnen zeigt, wie herrlich Er ist?
Im Haus des HERRN wohnen
David zeigt uns hier, dass echtes Gottvertrauen die Furcht aus dem Herzen nimmt. Das Geheimnis seines unerschütterlichen Glaubens ist einfach: Er blickt zuerst auf seinen Gott und erst dann auf seine Lebenssituation.
Er weiss, dass der Herr sein Licht, seine Errettung und seine Kraft ist. Von seinem Gott kann er jede Hilfe und Unterstützung erwarten. Darum fürchtet er sich nicht vor feindlichen Menschen, die ihm etwas Böses antun wollen. Er glaubt, dass Gott stärker ist als die Macht der Welt und ihn zu bewahren vermag.
Mit diesem tiefen Gottvertrauen ist der sehnliche Wunsch verknüpft, in der Gegenwart des Herrn zu sein. Als Folge davon hat der Erlöste die Bitte und das Streben nach Gemeinschaft mit seinem Gott:
- Er möchte jeden Tag bei Gott wohnen, um ständig mit Ihm Gemeinschaft zu pflegen.
- Zudem hat er den Wunsch, in der Gegenwart Gottes die Herrlichkeit des Herrn Jesus zu betrachten, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist.
- Schliesslich strebt er danach, den Willen und die Gedanken Gottes zu erforschen.
Wenn wir die Gegenwart Gottes aufsuchen und Ihm vertrauen, macht Er drei Verheissungen wahr:
- Die «Hütte am Tag des Unglücks» spricht vom Schutz, den Gott uns bietet.
- Das «Verborgene seines Zeltes» weist auf den Frieden hin, den wir beim Herrn finden.
- Der «Fels» ist ein Symbol für die Sicherheit, die Gott uns mitten in den Lebensstürmen verleiht.
Auf den HERRN harren
David ruft in seiner Notsituation zum Herrn. Dabei stützt er sich auf die göttliche Aussage: «Sucht mein Angesicht!» Solche Aufforderungen zum Gebet finden wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament (Psalm 50,15; Philipper 4,6).
David weiss: Der heilige Gott, den er um Hilfe anruft, verurteilt das Böse. Aber er vertraut darauf, dass die Gnade des Herrn grösser ist als sein Versagen. Seitdem der Herr Jesus am Kreuz das Erlösungswerk vollbracht hat, besitzt der Glaubende Heilssicherheit. Er steht in der Gunst Gottes und weiss sich von Ihm angenommen (Römer 5,2; 8,31).
Die Bitten, die David hier äussert, zeugen von seinem Vertrauen auf Gott. Wenn er betet: «Lass mich nicht und verlass mich nicht», so ist er gleichzeitig überzeugt, dass der Herr treu ist und ihn nie im Stich lassen wird. Sogar im Fall, dass ihm kein Mensch mehr zur Seite stehen würde, rechnet er fest damit, von Gott aufgenommen zu werden.
In Vers 11 bittet David den Herrn um seine Führung, damit er in Übereinstimmung mit Ihm den rechten Weg gehen kann, so dass seine Feinde keinen berechtigten Anklagegrund gegen ihn finden können.
Die Hoffnung Davids bezieht sich auf ein gutes Leben unter dem göttlichen Segen im Land Israel. Wir Christen warten auf das Kommen des Herrn zur Entrückung, um ewig bei Ihm in der himmlischen Herrlichkeit zu sein. In der Wartezeit wollen wir wie David jeden Tag mit der Hilfe des Herrn rechnen. Er gibt uns Kraft und Mut für den Glaubensweg.
Gott hört auf den Hilferuf der Seinen
In der zukünftigen Gerichtszeit wird das Volk Israel von seinen Feinden stark bedrängt sein. Diese äussere Drangsal wird den gläubigen Überrest läutern und die gottlose Masse des Volkes ins Gericht bringen.
In unserem Psalm beten die Glaubenden, die sich in dieser unsagbaren Not befinden, zum Herrn. Sie sind sich bewusst: Wenn Er nicht eingreift, werden sie sterben. Darum flehen und rufen sie zu Ihm.
Sie bitten Gott, dass Er im Gericht einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten macht. Das wird tatsächlich so sein:
- Die Gläubigen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, werden durch die Drangsal für den Messias und das Reich Gottes bereit gemacht.
- Die Ungläubigen hingegen, die dem Antichristen folgen, werden in dieser Gerichtszeit ihre gerechte Strafe bekommen.
Das Gericht wird die Gottlosen aus zwei Gründen treffen: einerseits wegen ihrer Bosheit (Vers 4) und anderseits, weil sie das Werk Gottes zur Rettung seines Volkes missachten (Vers 5).
Ab Vers 6 dankt der gläubige Überrest seinem Gott für die Erhörung der Gebete. Sein Herz ist voll Vertrauen und Dankbarkeit. – Auch wir haben schon erfahren, wie der Herr uns in Notsituationen einen Ausweg aus der Schwierigkeit geschaffen hat. Haben wir Ihm von Herzen dafür gedankt?
In Vers 9 blicken die Treuen aus Israel in die Zukunft und erbitten vom Herrn einen ewigen Segen für das ganze Volk.
Die Stimme Gottes
Dieser Psalm beginnt mit einer Aufforderung an die Grossen und Mächtigen der Welt, die Autorität des Herrn anzuerkennen. Anstatt die eigene Ehre zu suchen, sollen sie den Herrn und seine Herrlichkeit bewundern.
Ab Vers 3 teilt uns der Psalmdichter mit, wie Gott seine Allmacht und Herrlichkeit zeigt.
In der Natur offenbart Er seine Macht durch Sturm, Regen und Gewitter. Wie verheerend kann ein Unwetter sein! Es entwurzelt Bäume, zerstört Häuser, überflutet ganze Landstriche. Auch Vulkanausbrüche oder Waldbrände bezeugen, wie mächtig Gott ist. Das Erschüttern der Wüste lässt uns an ein Erdbeben denken, das ebenfalls die Stärke des Herrn erkennen lässt.
Alle diese Naturgewalten stehen symbolisch für das Gericht Gottes in der Zukunft. Es wird wie eine Flut über die Erde hereinbrechen und wie ein Sturm alle Stolzen und Hochmütigen erniedrigen (Jesaja 2,12-17). Das prüfende Feuer Gottes wird die gottlose Welt richten. Alle Völker der Erde werden erschüttert werden (Haggai 2,6.7). Die Geburtswehen der Hirschkühe weisen darauf hin, dass in dieser Zeit ein gläubiger Überrest aus Israel gebildet wird (Jesaja 66,7-9).
Es gibt einen Ort, wo die Herrlichkeit des Herrn in besonderer Weise gesehen, verstanden und bewundert wird: in seinem Tempel! Heute ist die Versammlung der Wohnort Gottes auf der Erde. Dort offenbart Er sich in seinem Sohn, dort beten Ihn die Erlösten an.
Der Psalm endet mit einer Ermutigung: Der Herr, der über allem steht, wird sein Volk in den Segen des Tausendjährigen Reichs bringen.
Lob für Gottes Hilfe
Dieser Psalm spricht prophetisch von der zukünftigen Drangsalszeit. Er hat zwei Teile: In den Versen 1-6 loben die Glaubenden aus Israel den Herrn, weil sie seine Errettung erfahren haben. Die Verse 7-13 beschreiben ihre Erfahrungen in der Drangsalszeit.
Sie werden von ihren Feinden bedrängt und befinden sich in höchster Lebensgefahr. Doch der Herr rettet sie zur rechten Zeit vor dem Tod und bringt sie in Sicherheit. Darum preisen sie seinen Namen.
Im Rückblick auf die Rettung erkennen sie, dass ihre Bedrängnis, die sie an den Rand des Todes gebracht hat, eine Erziehungsmassnahme Gottes gewesen ist. Verglichen mit der tausendjährigen Segenszeit haben sie nur eine kurze Zeit gelitten und geweint. Mit dem Kommen des Herrn in Herrlichkeit bricht für sie ein Morgen ohne Wolken an (2. Samuel 23,3.4).
Die Erfahrung in den Versen 7-9 haben wir bestimmt auch schon gemacht: Wir befanden uns in einer guten Lebenssituation und meinten deshalb, wir seien stark im Glauben. Als Gott es jedoch zuliess, dass sich die Umstände verschlechterten, verschwand unsere Zuversicht. Wir waren bestürzt, bis wir zum Herrn flehten und unser Vertrauen ganz auf Ihn setzten.
Der zukünftige Überrest aus Israel besitzt eine irdische Hoffnung. Darum fragt er, als er sich in Lebensgefahr befindet: Was nützt es, wenn ich sterbe? Wie kann ein Toter den Herrn loben und von Ihm zeugen?
In seiner Not ruft er zu Gott und erfährt seine Rettung. So verwandelt sich seine Wehklage in Jubel und Freude. Seinen Gott will er ewig preisen.
Gott ist unsere Zuflucht
Der Anfang dieses Psalms enthält allgemeine Grundsätze, die für die Glaubenden zu allen Zeiten wahr sind. In den Schwierigkeiten und Nöten, die sie erleben, nehmen sie im Gebet Zuflucht zu Gott. Er ist für sie wie ein unerschütterlicher Felsen mitten in der Brandung des Zeitgeschehens. Bei Ihm finden sie Schutz und Geborgenheit.
Die Erlösten haben auch mit Feinden zu tun, die sie zu Fall bringen möchten. Der Teufel möchte sie zur Sünde verleiten, die Welt versucht sie vom Herrn abzuziehen. Aber Gott kann sie bewahren. Darum legt der Gläubige, der auf Ihn vertraut, sein Leben bewusst in die Hand Gottes.
Vers 6 lässt uns auch an den Herrn Jesus denken, der am Kreuz betete: «Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist!» (Lukas 23,46). In tiefem Vertrauen und innerem Frieden legte Er sein Leben in die Hände des Vaters.
Die Glaubenden freuen sich über die Güte Gottes, die sich in ihrem Leben in zweifacher Hinsicht zeigt:
- In seiner Gnade nimmt Gott Kenntnis von der Not, in der sich die Seinen befinden. Er weiss genau, welche Schwierigkeiten sie durchmachen müssen (Vers 8).
- In seiner Gnade rettet der Herr die Seinen von ihren Feinden und verschafft ihnen Freiraum, so dass sie ihren Glauben leben können (Vers 9).
Die Verse 10-14 beschreiben eine äusserst notvolle Situation. Einzelne Aussagen treffen auch auf den Herrn Jesus zu: Die Menschen verhöhnten und ignorierten Ihn. Seine Feinde überlegten, wie sie Ihn töten könnten.
Mit Gottvertrauen beten
Der Gottesfürchtige befindet sich in grosser Not und wird von den Menschen im Stich gelassen. Da setzt er sein ganzes Vertrauen auf den Herrn, zu dem er eine persönliche Beziehung hat. Dieses starke Gottvertrauen beruht auf der Überzeugung, dass die Zeiten und Geschicke des Erlösten in der Hand Gottes liegen. In seinem Leben geschieht nichts, was der Herr nicht zulässt.
Nie beschämt Gott das Vertrauen derer, die zu Ihm rufen (Vers 18; Psalm 34,16.18). Er erhört zwar ihre Gebete nicht immer so, wie sie es denken, aber Er hilft und rettet zur rechten Zeit.
Ab Vers 20 bewundert David die Güte des Herrn, die er in den Schwierigkeiten erfahren hat:
- Gottesfurcht im Leben und Gottvertrauen im Gebet sind Voraussetzungen, damit wir in den Genuss dieser Güte kommen.
- Die Gnade Gottes zeigt sich darin, dass Er uns bei sich vor dem Widerstand und den Verleumdungen gottloser Menschen bewahrt.
- Obwohl unser Glaube manchmal ins Wanken gerät, bleibt Gottes Güte bestehen. Er lässt uns nicht im Stich und hört auch unser kleingläubiges Rufen.
Aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Herrn empfiehlt uns David, auf Gott zu vertrauen und auf seine Rettung zu warten. Er weiss, dass der Herr unsere Gottesfurcht und unsere Treue zu seinem Wort belohnt. Darum spornt er uns an, in den Schwierigkeiten auszuharren. Auch wenn sich die Situation nicht so schnell ändert, sollen wir stark im Glauben sein und immer wieder neuen Mut fassen.
Die Vergebung Gottes
Dieser Psalm spricht von der Vergebung, die wir als Gläubige, die gesündigt haben, auf das Bekenntnis unserer Sünden hin erfahren. Er beginnt mit dem Segen, der für uns daraus hervorkommt: Wenn Gott uns die Sünden vergibt, kommt Er nie mehr darauf zurück. Seine Vergebung bewirkt in uns echte Wahrheitsliebe, so dass wir unsere Sünden nicht entschuldigen, sondern ehrlich zu ihnen stehen.
Die Verse 3-5 beschreiben den Zustand zwischen dem Fehltritt und dem Bekenntnis. Oft versuchen wir wie David, die begangene Sünde zu verschweigen. Aber solange wir kein aufrichtiges Bekenntnis vor Gott und – wenn nötig – vor Menschen ablegen, finden wir keine innere Ruhe. Der Herr muss sich gegen uns stellen, bis wir unsere Übertretung aufdecken und bekennen.
Die Gnade, die Gott uns durch seine Vergebung schenkt, bringt uns innerlich näher zu Ihm. Wir suchen seine Gemeinschaft und möchten in Abhängigkeit von Ihm leben. Darum beten wir zu Ihm und suchen in den Stürmen des Lebens Hilfe und Schutz bei Ihm. – In Vers 8 gibt Gott uns ein Versprechen: Er will uns den Weg zeigen, auf dem wir in einer gefahrvollen Welt vor Fehltritten bewahrt werden. Um dieses Ziel mit uns zu erreichen, unterweist Er uns durch sein Wort und leitet uns mit seinen Augen, d.h. in einer lebendigen Glaubensbeziehung zu Ihm. Wenn wir nicht mit Ihm leben, leitet Er uns durch die Umstände (Vers 9). – Der Glaubende, der seine Sünden bekennt und sich von Gott führen lässt, erfährt die Güte des Herrn. Aber der Gottlose, der keine Vergebung besitzt, hat eine schreckliche Zukunft vor sich (Vers 10).
Die Allmacht des Schöpfers
Dieser Psalm beschreibt, was der Herr ist und was der Herr tut – in der Schöpfung, in seiner Regierung über die Welt und in seinem Handeln mit den Glaubenden.
Die Erlösten haben allen Grund, sich in Gott zu freuen und Ihm ein Loblied zu singen, weil sie die Vergebung der Sünden besitzen (Psalm 32) und die Rettung des Herrn erfahren (Psalm 33). In der Zukunft singen die Erlösten sowohl im Himmel als auch auf der Erde ein neues Lied zur Ehre Gottes (Offenbarung 5,9; 14,3).
Das Wort des Herrn ist zuverlässig und gerecht, wir können uns vertrauensvoll darauf stützen. Sein Werk geschieht in Gerechtigkeit und Güte, das macht uns innerlich ruhig.
- Die Verse 6-9 zeigen die Macht des Wortes Gottes in der Erschaffung von Himmel und Erde. Ein Hauch seines Mundes genügte, um die vielen für uns unzählbaren Sterne ins Dasein zu rufen. In seiner Allmacht setzte Er dem Meer eine Schranke (1. Mose 1,9.10). Durch sein Wort entstand die Schöpfung. Wenn wir durch Glauben verstehen, dass der allmächtige Gott alles erschaffen hat (Hebräer 11,3), stehen wir in tiefer Ehrfurcht vor Ihm still und anerkennen seine Autorität über uns.
- Der Herr regiert die Welt (Psalm 33,10-12). Er tritt den Plänen der Menschen entgegen und bringt seinen Vorsatz zur Ausführung. In der zukünftigen Gerichtszeit wird dies für alle sichtbar werden. Christus wird öffentlich erscheinen, um die Gottlosen zu bestrafen und das erwählte Volk Israel zu segnen.
Der HERR hat den Überblick
Gott überblickt das ganze Weltgeschehen. Er sieht alle Menschen und weiss, was jeder tut, spricht und denkt. In seiner Vorsehung lenkt Er die Geschicke auf der Erde, indem Er die Pläne in den Herzen der Menschen benutzt, um seinen eigenen Vorsatz auszuführen. Dennoch bleibt die menschliche Verantwortung bestehen. Gott achtet «auf alle ihre Werke» und wird sie dafür einmal zur Rechenschaft ziehen (Prediger 12,14).
Die Menschen, die ohne Gott leben, stützen sich auf ihre eigene Kraft und auf ihre eigenen Möglichkeiten. Doch das ist trügerisch. Wie schnell kann in der Welt Macht, Ansehen und Reichtum verloren gehen. Das wird in der Zukunft besonders deutlich sichtbar werden: Wenn der Herr zur Rettung seines geliebten Volkes mit Gericht eingreifen wird, wird keine Armee vor Ihm bestehen können.
Darum ist es für uns viel besser, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Er hat ein besonderes Interesse an allen, die Ehrfurcht vor Ihm haben und auf seine Hilfe warten. Er wird sie bewahren und am Leben erhalten. Ein schönes Beispiel dafür ist die Frau von Sunem (2. Könige 8,1).
Die Beweise seiner Allmacht und Güte stärken unseren Glauben an Gott. Dann erwarten wir in notvollen Situationen alle Hilfe von Ihm. Bis Er eingreift, wissen wir, dass Er uns beisteht und bewahrt. Wenn der Herr zur Entrückung wiederkommt, wird die göttliche Errettung für uns zum Abschluss kommen. Im Rückblick wird eine tiefe Freude unser Herz erfüllen, weil Gott uns geholfen und unser Vertrauen belohnt hat.
Lobt den HERRN für seine Rettung!
Es ist nicht schwer, Gott zu loben, wenn in unserem Leben alles nach Wunsch verläuft. Doch der Glaube macht uns fähig, auch in schwierigen Situationen an seiner Güte festzuhalten und Ihm ein Loblied zu singen. Vergessen wir nicht: Durch eine beständige Dankbarkeit gegenüber Gott werden andere ermutigt, ebenfalls den Herrn zu loben. Als Folge davon können wir unseren Gott gemeinsam erheben.
Vers 5 spornt uns an, den Herrn zu suchen, um bei Ihm Hilfe für unsere Notsituation zu finden. Gott möchte uns die Angst wegnehmen und unser Vertrauen auf Ihn stärken. Aufgrund dieser Erfahrung richten wir unseren Blick auf den Herrn und erkennen, wer Er ist. Weil wir nun unsere widrigen Umstände im Licht der göttlichen Herrlichkeit sehen, fassen wir Mut und gehen mit neuer Zuversicht auf dem Glaubensweg weiter.
In Vers 7 geht es um die Rettung aus aller Not und Bedrängnis. Für uns Christen wird diese Verheissung mit der Entrückung wahr werden. Die Glaubenden aus dem Volk Israel werden diese vollständige Befreiung in der Zukunft erfahren, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit erscheint.
Solange die endgültige Errettung noch aussteht, können wir täglich die göttliche Bewahrung für uns in Anspruch nehmen. Die Erfahrungen, die wir dabei mit dem Herrn machen, veranlassen uns, andere zu ermutigen, ebenfalls auf seine Güte zu vertrauen und bei Ihm Zuflucht zu suchen (Vers 9). Junge Löwen können trotz ihrer Kraft Hunger haben, aber die Gläubigen, die mit Gott leben, bekommen von Ihm alles, was sie brauchen.
Unterweisung in Gottesfurcht
Dieser Abschnitt legt das gerechte Handeln Gottes mit den Menschen in ihrem Leben auf der Erde dar. Man kann es wie folgt zusammenfassen: Wer gottesfürchtig und gerecht lebt, indem er z.B. ein Familienleben nach Gottes Gedanken führt, erfährt den göttlichen Segen in seiner Familie. Wer jedoch Böses tut, hat Gott gegen sich. Dieser doppelte Grundsatz ist für jeden Menschen zu allen Zeiten wahr. Dabei gilt es jedoch zu bedenken, dass der Gottesfürchtige manchmal wegen seines gerechten Verhaltens zu leiden hat, weil die Welt von Menschen regiert wird, die nicht nach Gott fragen.
Ein gottesfürchtiges und gerechtes Leben weist folgende Merkmale auf:
- Wir hüten uns davor, etwas Böses zu sagen oder andere mit Worten zu täuschen.
- Wir meiden das Böse und möchten das tun, was Gott gutheisst und den Menschen nützlich ist.
- Wir versuchen mit allen Menschen in Frieden zu leben und sind bereit, uns dafür einzusetzen.
Vers 19 enthält eine Verheissung, die über den Segen in der Regierung Gottes hinausgeht: Wenn wir uns über unser persönliches Versagen und über den Niedergang im Volk Gottes demütigen, ist der Herr uns nahe und hilft uns.
Weil der Herr seine Regierung noch nicht öffentlich ausübt, erfahren die Gerechten manche Widerwärtigkeiten. Aber es gibt keine Schwierigkeit, in der Gott nicht über ihnen wacht und sie bewahrt.
Der Psalm schliesst mit dem Blick in die Zukunft: Das göttliche Gericht wird nur die Ungläubigen treffen, die Erlösten sind von der Strafe freigesprochen.
Notschrei und Bitte um Rache
In diesem Psalm hören wir, wie die bedrängten Glaubenden aus Israel in der Zukunft zu Gott rufen. Sie bitten Ihn, dass Er ihre Feinde bestrafe, weil sie dadurch aus ihrer Not befreit werden. In der zukünftigen Drangsalszeit wird diese Bitte um eine gerechte Vergeltung der Bedränger Gott gemäss sein.
Der Herr Jesus rief nie für sich selbst das Gericht über seine Feinde herbei, obwohl Er ihrem Druck und ihrer Bosheit ausgesetzt war. Stattdessen bat Er um Gnade für die, die Ihn ans Kreuz schlugen (Lukas 23,34). Genauso sollen auch wir Christen in der Zeit der Gnade denken und handeln.
Vers 7 lässt sich auf Jesus Christus anwenden. Die Pharisäer versuchten Ihn in der Rede zu fangen und hofften, dass Er in ihre Falle tappen würde. Für diese Feindseligkeit gab es keine berechtigte Ursache.
Ab Vers 11 wird das Verhalten der Bedränger der Handlungsweise der Gläubigen gegenübergestellt:
- Die Feinde des treuen Überrests aus Israel treten in den Gerichtsverhandlungen ungerecht gegen ihn auf. Sie vergelten ihm Böses für Gutes und freuen sich über seine Not. Sie verspotten und schmähen ihn. – Jesus Christus hat das Gleiche von der feindlichen Führungsschicht der Juden erfahren (Markus 14,55-59; Psalm 109,5; Matthäus 27,39-44).
- Der Überrest hingegen trauert über die Not seiner Feinde und betet für sie. Ihre missliche Lage tut ihm aufrichtig leid. – Der Herr Jesus fordert auch uns zu diesem Verhalten gegenüber feindlichen Menschen auf (Matthäus 5,44; Römer 12,20).
Ruf um Rettung und Bestrafung
Im Glauben werden die Treuen aus Israel in der zukünftigen Drangsalszeit zu Gott rufen: «Wie lange willst du zusehen?» Sie wissen, dass durch sein Eingreifen die göttlichen Pläne in Erfüllung gehen werden und ihre Befreiung kommen wird. Als Folge davon werden sie den Herrn für ihre Rettung loben.
Ab Vers 19 beschreibt der gläubige Überrest mit eindrucksvollen Worten die Bosheit seiner Feinde:
- Sie zwinkern mit den Augen, weil sie etwas Böses gegen die Glaubenden im Sinn haben.
- Sie wollen keinen Frieden, darum greifen sie die Friedfertigen an.
- Lauthals rufen sie: «Haha!», und freuen sich über das Unglück der Treuen in Israel.
Auf diese Weise hat auch der Herr Jesus den Hass seiner Feinde erfahren.
Der Überrest weiss, dass Gott das böse Verhalten seiner Feinde sieht. Darum bittet er, dass der Herr zu dieser Bosheit nicht schweige, sondern im Gericht eingreife. Weil Gott gnädig ist und nicht den Tod des Sünders will, schweigt Er lange zum Bösen in der Welt und zur Unterdrückung der Gerechten. Aber in der zukünftigen Gerichtszeit wird Er sein Schweigen brechen und die Gottlosen bestrafen. Sein Gericht wird alle treffen, die sich gegen die gläubigen Juden und gegen Christus stellen werden.
Aber alle, die dem jüdischen Überrest wohlwollend gegenüber stehen und Christus anerkennen werden, werden sich über die Befreiung Israels freuen. Sie werden den Herrn loben, der alles zum Guten wenden wird.
Gott ist gütig, der Mensch ist böse
Dieser Psalm beginnt mit der Beschreibung von gottlosen Menschen. Weil in ihren Herzen gar keine Gottesfurcht vorhanden ist, schrecken sie vor nichts zurück. Sie lieben es, Böses zu tun und andere mit Worten zu betrügen. Sie schmieden niederträchtige Pläne und führen sie skrupellos aus. – Lassen wir uns vor solchen Menschen warnen! Von ihnen können wir nichts Gutes erwarten!
Gott wohnt im Himmel und steht über all dem Bösen in der Welt. Niemand kann seine Pläne vereiteln oder sein Handeln mit den Menschen verhindern. Seine Eigenschaften sind völlig verschieden von den Merkmalen der Gottlosen:
- Der Herr handelt in Güte mit den Menschen. Die Glaubenden wissen: Er meint es immer gut mit ihnen.
- Er bleibt sich selbst und seinem Wort treu. Niemals verändert Er sich. Was Er gesagt hat, führt Er auch aus.
- Seine Gerechtigkeit steht so fest wie ein Berg. Mit den Menschen handelt Er immer gerecht, auch wenn wir es nicht verstehen können.
Zu diesem Gott können wir mitten in einer bösen Welt Zuflucht nehmen. In seiner Gegenwart erfahren wir einen Segen, der unseren Glauben stärkt und uns echt glücklich macht. Er ist der Ursprung des Lebens und des Lichts. Darum kann Er denen, die an Ihn glauben, neues Leben schenken und ihnen mitten in den Schwierigkeiten Licht für ihren Weg schenken. In seiner Güte und Gerechtigkeit wird Gott die Seinen ans Ziel bringen. Daran kann Ihn niemand hindern.
Auf Gott warten
Solange der Herr nicht öffentlich auf der Erde regiert, machen die Gläubigen die Erfahrung, dass es den Ungläubigen äusserlich oft besser geht als ihnen. Das kann in ihren Herzen Zorn und Neid hervorrufen. Weil wir auch in dieser Gefahr stehen, wollen wir die Ermahnung im ersten Vers zu Herzen nehmen. Denken wir an das Ende derer, die ohne Gott leben. Wie furchtbar wird das Gericht sein, das sie treffen wird!
Anstatt auf die Ungläubigen neidisch zu sein, sollen wir in den Schwierigkeiten unser Vertrauen auf den Herrn setzen und weiter das Gute tun, das seine Anerkennung findet. Wenn wir Gott und seinem Wort treu bleiben, die Gemeinschaft mit Ihm pflegen und uns an Ihm freuen, befinden wir uns in einem guten geistlichen Zustand. Unsere Bitten entsprechen dann dem Willen Gottes, so dass Er sie erhören kann.
Was für eine Hilfsquelle besitzen wir doch im Gebet! Alles, was uns begegnet, können wir unserem Gott anbefehlen. Wenn wir vertrauensvoll auf seine Antwort warten, wird Er unseren Glauben belohnen und zu unseren Gunsten eingreifen.
Ab Vers 7 werden wir nochmals davor gewarnt, über gottlose Menschen, die Erfolg haben, zornig zu werden. Wenn wir diesen Zorn in uns nähren, anstatt ihn zu verurteilen, wird er uns zu weiteren Sünden verleiten (Jakobus 1,19.20). Die Zeit, in der die Gottlosen Gelingen haben und die Gottesfürchtigen leiden müssen, ist kurz. Aber das zukünftige Reich, in das nur Glaubende eingehen werden, wird 1000 Jahre dauern!
Der Gottlose widersteht dem Gläubigen
Die Verse 12-15 beschreiben den Widerstand der Gottlosen gegen die Gläubigen. Warum gibt es diese Feindschaft seit Beginn der Menschheitsgeschichte, als Kain seinen Bruder Abel erschlug? Weil die Bosheit der Ungläubigen durch das gerechte Verhalten der Glaubenden verurteilt wird. Das ruft ihren Hass hervor.
Das Urteil von Vers 16 wollen wir uns zu Herzen nehmen: Es ist besser, wenig mit Gott zu besitzen, als ohne Gott reich zu sein (Lukas 12,16-21).
Wenn wir in einer bösen Welt gerecht leben, müssen wir manchmal Nachteile in Kauf nehmen. Aber wir besitzen die Zustimmung des Herrn, der uns in notvollen Situationen zu Hilfe kommt. Er wird unser Vertrauen auf Ihn nie beschämen.
Im Gegensatz zu den Gottlosen, die die Güte ihrer Mitmenschen zu ihrem Vorteil ausnutzen, sollen wir gnädig sein und den Not leidenden Menschen helfen (Vers 21). Gott wird uns und unsere Familie dafür segnen (Vers 26).
Ab Vers 23 finden wir, wie Gott uns hilft, wenn wir mit Ihm leben und sein Wort befolgen möchten:
- Er führt uns durch die gefahrvolle Welt einen Weg, auf dem wir mit festem Schritt dem Ziel entgegengehen können.
- Wenn wir in eine Prüfung fallen (Jakobus 1,2), wird der Herr unseren Glauben stützen, so dass wir nicht aufgeben (2. Korinther 4,9).
- Er lässt uns nie im Stich. Wenn wir Ihm gefallen und gerecht leben möchten, wird Er seine segnende Hand nicht zurückziehen.
Vom Bösen weichen und auf Gott harren
In Vers 27 gibt Gott den Seinen einen wichtigen Rat: «Weiche vom Bösen und tu Gutes!» Menschen, die gottlos leben und Böses tun, mögen kurzfristig Erfolg haben. Aber ihr Ende ist Gericht. Dem Gottesfürchtigen hingegen steht eine herrliche Zukunft bevor. Er mag in der Welt wegen seines gerechten Verhaltens Nachteile haben, aber der Herr wird ihn für sein Reich bewahren.
Wenn wir das Wort Gottes im Herzen bewahren, wird es sich auf unser Leben auswirken. Es hilft uns, bei Fragen eine weise Antwort zu geben und im Glauben sichere Schritte zu tun.
In Vers 34 bekommen wir einen weiteren Ratschlag: «Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg.» Wenn wir von der Welt bedrängt werden, sollen wir beharrlich auf Gott warten und gleichzeitig entschieden auf dem rechten Weg weitergehen.
Die Verse 35 und 36 beschreiben den Gottlosen, wie er äusserlich und für eine Zeit Erfolg hat. Er gleicht einer Pflanze, die wächst und zu einem grossen Baum wird. Doch das göttliche Gericht wird ihn treffen, so dass er plötzlich nicht mehr da ist. Darin kann man den Antichristen sehen, der die Gottlosigkeit in Person sein wird.
Die Verse 37-40 enthalten zwei Ermutigungen für jeden Glaubenden, der in einer gottlosen Welt dem Herrn gefallen möchte:
- Für den, der ehrlich ist und den Frieden sucht, gibt es eine Zukunft.
- Der Herr hilft dem Gerechten. Er gibt ihm Kraft zum Ausharren und rettet ihn aus seiner Not.
Die erziehende Hand Gottes
Dieser Psalm schildert die Empfindungen der Glaubenden aus Israel in der Zukunft. Sie erleiden Drangsale und erkennen darin die erziehende Hand Gottes. Es ist ihnen bewusst, dass ihre Sünden die Ursache dafür sind. Darum beugen sie sich unter das Schwere, das sie trifft, und rechtfertigen das Handeln Gottes mit ihnen. Gleichzeitig setzen sie ihr Vertrauen auf Ihn und rufen Ihn um Erbarmen an.
Obwohl sie sich von Gott angenommen wissen, kennen sie doch die vollen Auswirkungen des Erlösungswerks nicht. Darum sprechen sie hier von einer Strafe für ihre Sünden. Erst wenn sie auf Christus blicken und die Wundmale des Kreuzes an Ihm erkennen, erfassen sie im Glauben, dass die Strafe zu ihrem Frieden auf Ihm lag (Jesaja 53,5).
Wir können aus diesem Psalm auch eine praktische Belehrung für uns nehmen: Wenn wir als Gläubige sündigen oder einen verkehrten Weg gehen, möchte Gott uns durch erziehende Massnahmen wieder zurechtbringen. Es kann sein, dass Er uns deswegen in eine körperliche oder seelische Not bringt, wie es die Verse 6-9 beschreiben, um uns zur Buße und zum Bekenntnis unserer Sünden zu bringen. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass nicht jede Krankheit die direkte Folge einer Sünde ist.
In Vers 11 erkennen wir bildlich die geistlichen Folgen eines Fehltritts: Das Herz ist unruhig und das Gewissen klagt uns an, weil wir gesündigt haben. Zudem verlieren wir unsere Glaubenskraft und das geistliche Unterscheidungsvermögen.
In der Anfechtung zu Gott rufen
Die Verse 12-15 beschreiben, was der treue Überrest aus Israel in der Zukunft von seinen ungläubigen Verwandten und seinen Feinden erfahren wird. Sie werden ihn in seiner Bedrängnis im Stich lassen. Einige werden ihm sogar nach dem Leben trachten. Wie verhält sich der gläubige Überrest in dieser Situation?
- Er verschliesst seine Ohren vor den Worten seiner Feinde, die ihn verleumden.
- Er schweigt zu den verkehrten Anschuldigungen und überlässt die Sache Gott.
So hat sich auch der Herr Jesus verhalten, als Er vor seinen Anklägern stand. Damit hat Er uns ein Beispiel hinterlassen (1. Petrus 2,21-23).
In seiner Not harrt der Überrest auf den Herrn und weiss, dass er von Ihm eine Antwort bekommen wird. Er erwartet von Gott die rechtzeitige Hilfe, damit er nicht fällt und die Feinde sich nicht über ihn freuen können.
In Vers 19 bekennt er Gott seine Sünden und bereut seine Fehltritte zutiefst. Gerade die Bedrängnis durch seine Feinde bewirkt diese Buße in seinem Herzen. Im Gegensatz zum Überrest sind die ungläubigen Juden unbekümmert über ihre eigenen Sünden. Sie zeigen sich stark und überlegen. Sie hassen die Glaubenden ohne Grund und vergelten ihnen Böses für Gutes. So sind sie schon mit Jesus Christus umgegangen (Johannes 15,25).
Dem treuen Überrest bleibt in dieser notvollen Situation nur eins: der Hilferuf zu Gott! Wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird, wird die Drangsal als göttliche Erziehungsmassnahme zu Ende und die Schuld abgetragen sein (Jesaja 40,2).
Das Leben auf der Erde ist kurz
Die Verse 2-4 enthalten manche Hinweise für unser Verhalten in der Welt:
- Geben wir acht auf den Weg, den wir gehen, damit wir vor einem Fehltritt bewahrt werden.
- Richten wir ein besonderes Augenmerk auf unsere Worte! Wie schnell sündigen wir doch mit der Zunge und geben den Ungläubigen einen berechtigten Anlass, uns zu verurteilen!
- Schweigen wir zum Bösen, das in der Welt geschieht! Manchmal ist es besser, das Gute nicht zu sagen, weil die Welt es nur mit Füssen treten würde.
Aber das Gebet bleibt uns immer. Zu unserem Gott können wir jederzeit reden und Ihm alles sagen.
In den Versen 5-8 geht es um die Kürze und Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. Der Ungläubige verbringt diese kurze Zeit voll Unruhe und im Streben nach Geld und Besitz. Was tut der Gläubige? Er setzt seine Hoffnung auf Gott, der ihm echten Lebenssinn, tiefen Frieden und ewigen Segen geben kann.
Ab Vers 9 hören wir den gläubigen Überrest aus Israel, wie er seine Ungerechtigkeit erkennt und den Herrn bittet, ihn aus der Bedrängnis zu retten. Er hat den Eindruck, dass die Hand Gottes so stark auf ihm lastet, dass er die Drangsal nicht überlebt. Aber der Herr wird auch in der zukünftigen Gerichtszeit die Glaubenden nicht über Vermögen prüfen, sondern die Tage verkürzen, damit sie gerettet werden (Matthäus 24,22).
Die Glaubenden aus Israel besitzen eine irdische Hoffnung. Sie bitten den Herrn, dass Er sie am Leben erhält, damit sie ins Reich eingehen können (Vers 14).
Christus gehorcht seinem Gott
In diesem Psalm hören wir den Herrn Jesus reden. Das wird besonders aus den Versen 7-9 deutlich, die in Hebräer 10,5-7 zitiert werden.
Weil Jesus Christus in seinem Leben auf Gott geharrt und im Garten Gethsemane zu Ihm gerufen hatte, wurde Er durch die Auferweckung aus der Grube des Verderbens heraufgeführt. Als Folge dieser Rettung singt Er ein neues Lied. Es ist ein Lobgesang unserem Gott, denn Er ist der Gott aller Glaubenden, die wie Christus ihr Vertrauen auf Ihn setzen und seine Hilfe erfahren. So verbindet sich der Herr Jesus mit den Erlösten, um gemeinsam mit ihnen die Wundertaten Gottes zu rühmen.
Die Opfer, die in Vers 7 genannt werden, hatte Gott eingesetzt. Aber sie wurden von sündigen Menschen dargebracht. Darum konnten sie nicht die Grundlage zur Erfüllung der Pläne Gottes sein. Es brauchte dazu ein anderes Opfer.
So war der Sohn Gottes bereit, Mensch zu werden und als Mensch die Stellung eines Knechtes einzunehmen. Er liess sich von Gott Ohren bereiten, um zu hören und zu gehorchen. Der Herr Jesus kam freiwillig in die Welt, um den Willen Gottes zu tun. Es war sein oberstes Ziel, Gott zu gefallen und alles zu tun, was sich der Vater in seinem Herzen vorgenommen hatte. Zu seinen Jüngern sagte Er: «Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe» (Johannes 4,34). Das Wort Gottes hatte im Herzen des Herrn Jesus einen festen Platz, so dass es seine Gedanken, Worte und Handlungen prägte.
Christus verkündigt die Gerechtigkeit
In den Versen 10 und 11 beschreibt der Herr Jesus den Auftrag, den Er in seinem Leben zur Ehre Gottes ausführte. In einer ungerechten Welt verkündigte Er die Gerechtigkeit Gottes. Er machte auch seine Güte und seine Wahrheit bekannt. Dadurch zeigte Er den Menschen, wer Gott ist. Das rief den Widerstand der religiösen Leute hervor, die sich zwar äusserlich zu Gott bekannten, aber innerlich weit weg von Ihm waren. Trotzdem hielt Christus seine Botschaft nicht zurück. Er blieb der treue Zeuge bis in den Tod am Kreuz.
Der Heiland wusste im Voraus, dass Er am Kreuz die Ungerechtigkeiten der Glaubenden auf sich nehmen und die Strafe dafür tragen würde (Vers 13). Er litt schon im Garten Gethsemane, als Er daran dachte, wie Gott in den Stunden der Finsternis die Last der zahlreichen Sünden, die wir getan haben, auf Ihn legen würde. Aber zu diesem Zeitpunkt war Er noch nicht von Gott verlassen. Darum konnte Er Ihn um Hilfe anrufen.
In den Versen 15-17 äussert der Herr Jesus zwei Bitten, die dem Charakter der Psalmen entsprechen:
- Er fleht um die Bestrafung seiner Feinde, die sich am Kreuz über Ihn lustig gemacht haben (Markus 15,29).
- Er bittet um Freude für die Glaubenden, die Gott suchen und nach seinem Willen fragen.
Jesus Christus war in seinem Leben elend und arm. Er litt in einer bösen Welt als gehorsamer Knecht, als treuer Zeuge und schliesslich als Sündenträger. Doch Er harrte bei Gott aus, weil Er wusste, dass Er Ihn nicht im Stich lassen und durch die Auferweckung aus den Toten retten würde.
Gott bewahrt den Armen
Der Arme ist der Gläubige, der sich in schwierigen Umständen befindet, aber vom Herrn gestützt wird. Die Welt beachtet ihn kaum, aber für Gott ist er wertvoll. Prophetisch trifft das auf den Überrest aus Israel zu. Gott wird ihn in der Drangsalszeit bewahren und ihn nicht der Gier seiner Feinde preisgeben. – Er kann auch uns auf dem Weg des Glaubens bewahren (Judas 24).
Die Feinde des gläubigen Überrests wünschen ihm Böses und hoffen, dass er umkommen wird. Sie schmeicheln ihm, aber in Wirklichkeit suchen sie sein Unglück. Sogar solche, die ihm nahe stehen und sein Vertrauen besitzen, stellen sich gegen ihn. Diese «Freunde» erweisen sich plötzlich als Feinde. Der Herr Jesus hat Ähnliches durchgemacht:
- Seine Volksgenossen wollten Ihn töten. Vor Pilatus schrien sie: «Hinweg, hinweg! Kreuzige ihn!» (Johannes 19,15).
- Judas, einer der zwölf Jünger, verriet Ihn an seine Feinde. Wie schmerzlich war es für den Herrn, dass gerade einer aus seiner nächsten Nähe gegen Ihn aufstand.
In seinem Elend stützt sich der Überrest auf die Gnade Gottes. Er weiss, dass er gesündigt hat und die Folgen davon tragen muss. Aber er rechnet damit, dass der Herr ihn retten wird. Im Gegensatz zu seinen Feinden, die falsch und hinterlistig sind, ist der Überrest aufrichtig vor Gott. Er weiss, dass der Allmächtige ihn in der Bedrängnis aufrecht hält und schliesslich in den Segen des Reichs einführt. Dann werden die Erlösten den Herrn für seine Rettung ewig preisen.
Zum Markus-Evangelium
Das Evangelium nach Markus ist das kürzeste. Die Berichterstattung erfolgt in sehr knapper Form.
Weder der Stammbaum noch die Geburt Jesu werden erwähnt. Schon im ersten Kapitel berichtet Markus über den Dienst des Herrn. Viel häufiger als in den anderen Evangelien zieht sich der Herr Jesus in die Stille zurück. Oft wird auch seine Bescheidenheit erwähnt: Er wollte nicht, dass seine Taten bekannt wurden. Kein einziges Mal nennen Ihn die Jünger «Herr». Nur siebenmal wird Er «Christus» genannt.
Alle diese Eigenarten weisen auf das Thema dieses Evangeliums hin: Markus stellt uns Jesus Christus als Knecht Gottes vor, wie Ihn schon die Propheten angekündigt haben (Jesaja 42,1-9; Jesaja 49,1-6; Jesaja 52,13-15; Sacharja 3,8). Er sagt selbst von sich: «Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele» (Markus 10,45).
Zudem zeigt uns Markus den Herrn Jesus als den Propheten Gottes, der das «Evangelium» verkündet. Dieses Wort kommt bei Markus achtmal vor – deutlich mehr als bei den anderen Evangelisten. Wiederholt lesen wir auch, dass der Herr Jesus die Menschen lehrte. Er selbst umschreibt seinen Dienst als Prophet wie folgt: «Lasst uns woandershin gehen in die nächsten Ortschaften, damit ich auch dort predige; denn dazu bin ich ausgegangen» (Markus 1,38).
Jesus Christus ist auch der leidende Knecht und der verworfene Prophet. Darum nimmt der Bericht über sein Leiden und Sterben in diesem Evangelium einen verhältnismässig grossen Raum ein.
Der Vorläufer des Herrn Jesus
Der Evangelist Markus stellt uns den Herrn Jesus als den vollkommenen Diener und wahren Propheten Gottes vor. Aus diesem Grund finden wir hier keinen Hinweis auf seine Geburt und seine Abstammung als Mensch. Aber der Heilige Geist macht von Anfang an klar, dass dieser demütige Diener eine göttliche Person ist. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Dies wird durch die beiden Zitate in den Versen 2 und 3 unterstrichen. In den Worten aus Maleachi 3,1 ist die Rede von «deinem» Weg. Jesaja 40,3 zeigt aber, dass damit der Weg «des Herrn» gemeint ist. Der Kommende war der Herr (Jahwe) des Alten Testaments.
Die «Stimme des Rufenden in der Wüste» ist das Zeugnis von Johannes dem Täufer. Er war der Vorläufer Dessen, der die gute Botschaft der Gnade bringen würde. Aber die Herzen der Menschen mussten für den Kommenden zubereitet werden. Deshalb verkündete Johannes die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Viele wurden in Herz und Gewissen angesprochen und aufgerüttelt, so dass sie ihre Sünden bekannten und sich taufen liessen.
Der Täufer wies in seiner Predigt auf Jesus Christus hin, der nach ihm kommen sollte, aber unendlich weit über ihm stand. Er würde mit Heiligem Geist taufen. So etwas konnte nur Gott selbst tun – ein weiterer Hinweis auf die Gottheit des Herrn Jesus. Im Gegensatz zu Matthäus 3,11 wird hier die Taufe mit Feuer, die von Gericht spricht, nicht erwähnt. Warum? Weil im Markus-Evangelium der Schwerpunkt auf dem Dienst der Gnade liegt, den der Herr damals auf der Erde ausübte.
Vom Jordan in die Wüste
Nun erschien der Angekündigte selbst – es war Jesus von Nazareth – und liess sich von Johannes taufen. Hatte der Herr Jesus Buße und Vergebung der Sünden nötig? Nein, absolut nicht! Aber mit der Taufe nahm Er vor Gott den Platz seines Volkes ein und stellte sich neben jene aus Israel, die sich in Buße vor Gott beugten.
Um aber jedem Missverständnis vorzubeugen, ertönte die Stimme Gottes, des Vaters, aus den Himmeln: «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.» Zugleich fuhr der Heilige Geist wie eine Taube auf Ihn, den reinen, sündlosen Menschen.
Bei dieser Gelegenheit sehen wir zum ersten Mal, wie sich die Dreieinheit Gottes offenbarte: Der Sohn Gottes stand als Mensch am Jordan, der Heilige Geist kam wie eine Taube auf Ihn und Gott, der Vater, bezeugte sein Wohlgefallen am geliebten Sohn.
In Vers 10 wurde der Sohn Gottes als Mensch mit dem Heiligen Geist versiegelt (Johannes 1,33.34; 6,27). Ab Vers 12 sehen wir, wie Er in der Kraft dieses Geistes seinen öffentlichen Dienst begann. Doch dem ersten öffentlichen Auftreten des Herrn ging die Versuchung in der Wüste durch Satan voraus. Markus erwähnt keine Einzelheiten. Wir sehen einfach, wie es dem Teufel nicht gelang, den reinen, sündlosen Diener zum Sündigen zu verleiten.
Mit dem Abtreten von Johannes dem Täufer fing der Dienst des Herrn Jesus an. Als Prophet predigte Er in Galiläa das Evangelium des Reichs Gottes. In seiner Person war dieses Reich nahe gekommen. Nun sollten die Menschen Buße tun und Ihn im Glauben annehmen.
Der Herr ruft in die Nachfolge
Als der Herr Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, rief Er zwei Brüderpaare in seine Nachfolge: Simon Petrus und Andreas sowie Jakobus und Johannes. Mit dieser Berufung verband Er sie mit sich selbst im Dienst. Dabei wollte Er sie in seiner Schule ausbilden und zu Menschenfischern machen. Aus der Bemerkung des Herrn Jesus in Vers 17 wollen wir den wichtigen Grundsatz festhalten: Die Nachfolge geht dem Dienst für Ihn voraus. Ein Leben in praktischer Gemeinschaft mit dem Herrn, indem man seinen Fussstapfen nachfolgt, ist die Voraussetzung für jede Arbeit in seinem Werk.
Simon und Andreas warfen ihre Netze aus, als der Herr sie rief. Am Anfang der Apostelgeschichte sehen wir, wie Petrus als Menschenfischer durch seine Ansprachen «das Netz» auswarf. Dabei kamen Tausende zum rettenden Glauben an Christus. Jakobus und Johannes besserten die Netze aus, als sie den Ruf des Herrn hörten. Im hohen Alter erkannte der Apostel Johannes, wie «die Netze des Christentums» zu reissen begannen, als Irrlehrer verkehrte Dinge verbreiteten. Mit seinen Briefen, die er durch den Heiligen Geist inspiriert niederschrieb, trat er diesen Irrlehrern und Irrtümern entgegen.
In Vers 15 hatten wir den Glauben an das Evangelium, in den Versen 17 und 20 die Nachfolge. Welch eine Gnade, dass es auch heute Menschen gibt, die bekennen, an den Herrn Jesus zu glauben. Doch es fragt sich, ob sie alle bereit sind, dem verachteten Jesus von Nazareth auf dem Weg des Glaubens nachzufolgen und seine Schmach mit Ihm zu teilen.
In der Synagoge von Kapernaum
In den Synagogen, den jüdischen Versammlungsstätten, wurde das Alte Testament gelesen und gelehrt. Auch der Herr Jesus suchte diese Orte auf, um als der vollkommene Diener und Prophet das Volk zu lehren.
Die Zuhörer stellten schnell einen Unterschied zwischen Ihm und den Schriftgelehrten fest. Im Gegensatz zu den jüdischen Gelehrten, die ihre Ansichten weitergaben und ihre Meinungen vertraten, lehrte der Herr Jesus mit göttlicher Autorität und verkündete die Wahrheit.
In der Synagoge zeigte sich nicht nur die Vollmacht seiner Worte. Durch die Anwesenheit seiner Person wurden auch die Dämonen beunruhigt. Angstvoll rief der Mann, der von einem unreinen Geist beherrscht wurde: «Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener?» Die Dämonen wissen, wer der Herr Jesus ist, und zittern vor seiner Strafe (Jakobus 2,19). Doch im Augenblick war der Heiland nicht da, um die Dämonen zu richten, sondern den gebundenen Menschen zu befreien. Mit göttlicher Vollmacht trieb Er den unreinen Geist aus.
So etwas hatten die in der Synagoge anwesenden Menschen noch nie erlebt. Sie entsetzten sich und befragten sich untereinander: «Was ist dies für eine neue Lehre?» Ja, das Evangelium verändert Menschen (Römer 1,16). Doch diese gute Botschaft muss geglaubt werden, damit sie etwas bewirkt. Gerade dieser Glaube fehlte hier. Die «Kunde von ihm» wurde zwar zum Gesprächsthema in Galiläa, aber es gab keine Anzeichen von echtem Herzensglauben (Matthäus 11,23).
Der aktive und abhängige Diener
Nach der Synagoge kam der Herr Jesus mit seinen Nachfolgern in das Haus von Simon und Andreas. Simon Petrus war verheiratet. Die Mutter seiner Frau war an Fieber erkrankt. Nun taten die Angehörigen das einzig Richtige: Sie erzählten dem Herrn von der Not. Als der grosse göttliche Arzt griff Er in diesem Fall sofort ein und heilte die Kranke. Dabei beschäftigte Er sich ganz persönlich mit ihr: Er ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Wie schön ist die Reaktion der gesund gewordenen Frau: «Sie diente ihnen.» Es war ein Dienst für den Herrn an den Seinen.
Sobald der Sabbat abends um 6 Uhr zu Ende gegangen war, versammelte sich die ganze Stadt an der Tür des Hauses, worin sich der Heiland befand. Wie viel äussere und vermutlich auch innere Not kam da zusammen! Viele wurden von ihren Krankheiten geheilt und von ihren dämonischen Bindungen befreit. Diese Heilungen waren nicht einfach Beweise seiner Macht, sondern sie zeigten seine Güte, die in göttlicher Kraft wirkte.
Für seinen anstrengenden Dienst brauchte unser Herr als Mensch auch Zeiten der Stille, um im Gebet allein mit Gott zu sein (Jesaja 50,4).
Den Grund, warum Simon Petrus und die anderen Ihm nachliefen, gaben sie mit einem kurzen Satz an: «Alle suchen dich.» Doch es ging dem vollkommenen Diener nicht um die Anzahl Zuhörer oder um persönliche Berühmtheit. Nicht die Bedürfnisse der Menschen waren für Ihn ausschlaggebend, sondern der Wille Gottes. Seine Absicht war, dass alle in Galiläa die gute Botschaft hörten (Matthäus 4,15-17).
Der Herr heilt einen Aussätzigen
Der Aussätzige war von der Macht des Herrn überzeugt. Doch er war unsicher, ob die Gnade und Liebe des Heilands auch für ihn in göttlicher Kraft tätig würde. Welch eine wunderbare Erfahrung durfte dieser bedauernswerte Mann machen! Innerlich bewegt streckte der Heiland seine Hand aus, rührte den Kranken an, ohne angesteckt zu werden. Dann sagte Er: «Ich will; werde gereinigt.» Da wurde er auf der Stelle gesund.
Der Geheilte sollte das Erlebte nicht weitererzählen, denn der demütige Diener Gottes wollte nicht berühmt werden. Stattdessen bekam er den Auftrag, sich dem Priester zu zeigen und die Opfer zu bringen, die in 3. Mose 14 für die Reinigung vom Aussatz vorgeschrieben waren. Der Herr fügte hinzu: «Ihnen zum Zeugnis.» Der Priester musste stutzig werden, wenn ein gereinigter Aussätziger zu ihm kam. Wer ausser Gott konnte jemand vom Aussatz heilen? Daraus hätte der Priester erkennen müssen, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus mitten unter seinem Volk war (Matthäus 1,23). Doch die Bibel gibt uns keinerlei Anzeichen für eine solche Reaktion. Vielmehr wurden der Hohepriester und die übrigen Führer des Volkes zu den erbittertsten Feinden des Herrn Jesus.
Weil der geheilte Aussätzige nicht gehorchte und seine Heilung überall bekannt machte, wurde der Dienst des Herrn Jesus zu einer Sensation, so dass Er sich zurückziehen musste. Er suchte keine Publizität, sondern wollte seinem Gott gehorchen und den Dienst erfüllen, den Dieser Ihm aufgetragen hatte. Es ging Ihm um die Herzen und Gewissen der Zuhörer.
Ein Gelähmter kann gehen
Nachdem sich die Situation von Markus 1,45 etwas beruhigt hatte, ging der Herr Jesus wieder nach Kapernaum hinein. Doch es dauerte nicht lang, da strömten Unzählige in das Haus, wo Er sich aufhielt. «Er redete zu ihnen das Wort.» Die Verkündigung war das Wichtigste in seinem Dienst.
Dann kamen vier Männer, die einen Gelähmten zum Herrn Jesus bringen wollten. Doch es war unmöglich, ins Haus zu gelangen. Überall versperrten die Menschen den Zugang zu Ihm. Sollten sie ihr Vorhaben aufgeben und wieder umkehren? Nein. Sie liessen sich nicht entmutigen. Ihr Freund brauchte Hilfe, und sie hatten ein tiefes Vertrauen zum Herrn, dass Er in seiner Liebe und Macht helfen würde. Deshalb stiegen sie aufs Dach, deckten es ab und liessen den Gelähmten auf seinem Bett direkt vor den Herrn Jesus hinab.
«Als Jesus ihren Glauben sah», liess Er die fünf Männer nicht ohne Antwort. Er zeigte ihnen, dass Psalm 103,3 durch Ihn in Erfüllung ging: «Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten.» Zuerst sprach Er den Kranken von Schuld und Strafe frei. Dann sagte Er zu ihm: «Steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus.» Vergebung und Heilung gingen hier Hand in Hand. Die körperliche Wiederherstellung bestätigte, dass Gott vergeben hatte.
Die anwesenden Kritiker wollten nicht wahrhaben, dass hier Gott selbst vor ihnen stand. Aber durch die Heilung des Gelähmten bewies der Herr Jesus allen Anwesenden, dass Er der Sohn des Menschen ist, der die Vollmacht besitzt, auf der Erde Sünden zu vergeben.
Jesus im Kontakt mit Zöllnern
In der Nähe des Sees Genezareth rief der Herr Jesus einen weiteren Jünger in seine Nachfolge. Es war der Zöllner Levi oder Matthäus (Matthäus 9,9). Dieser stand nicht nur auf, um Ihm nachzufolgen, sondern lud den Herrn mit seinen Jüngern zu einem Essen in sein Haus ein. Levi hatte noch viele weitere Gäste eingeladen: Zöllner und Sünder. Dadurch bekamen sie alle eine Gelegenheit, mit Jesus Christus in Kontakt zu kommen.
Wie bereits im ersten Abschnitt des Kapitels erhoben die Schriftgelehrten und Pharisäer wieder ihre kritischen Stimmen. Die Tatsache, dass die Juden den Römern Zoll entrichten mussten, war demütigend. Sie bewies, dass sie unter der Herrschaft der Nationen standen. Darum wurden die Leute, die für die Römer arbeiteten, verachtet und als Sünder betrachtet. Doch der Herr war in seiner Gnade nicht für die Selbstgerechten auf die Erde gekommen, sondern für alle, die wussten, dass sie einen Retter brauchten.
Die Fastenfrage beantwortete der Herr Jesus wie folgt: Die Zeit seiner Anwesenheit war kein Grund für Trauer und Fasten. Im Gegenteil! Später, wenn Er nicht mehr hier sein und der Widerstand gegen die Seinen zunehmen würde, dann konnten sie fasten.
In den Versen 21 und 22 spricht Er vom religiösen System, zu dem das Fasten damals gehörte. Diese alte Ordnung war völlig unvereinbar mit der Gnade, die Er brachte. Der neue Wein ist ein Bild der Wahrheit und der geistlichen Kraft der christlichen Zeitperiode. Beides ist unvereinbar mit den gesetzlichen Formen des Judentums. Gesetz und Gnade können nicht zusammengehen.
Die Sabbatfrage
Den Juden bedeutete der Sabbat sehr viel. Einerseits war er das Zeichen für die Ruhe Gottes in der ersten Schöpfung (2. Mose 20,11). Anderseits gehörte er zu den Merkmalen des Bundes des Herrn mit Israel. Doch der Mensch hatte völlig versagt und konnte als Sünder nicht an der Ruhe Gottes teilhaben.
Diesen Punkt übersahen die Juden. Trotzdem wollten sie den Sabbat besonders heilighalten. In der Umsetzung gingen sie jedoch weiter als die Anordnungen Gottes und klagten deshalb die Jünger als Übertreter der Sabbatgebote an. In seiner Antwort nahm Jesus Bezug auf David und zog eine Parallele zur aktuellen Situation. Damals war David, der rechtmässige König, verworfen und verfolgt. Was nützte es, die Anweisungen über die Schaubrote festzuhalten, wenn der von Gott bestimmte König abgelehnt wurde? Genauso wollten die Juden das Sabbatgebot peinlich genau einhalten und gleichzeitig Christus, den Gesetzgeber und Herrn des Sabbats, ablehnen. Das konnte Gott nicht gutheissen.
Auch in den Anfangsversen von Markus 3 geht es um den Sabbat. Der Herr wusste, dass die jüdischen Führer Ihn belauerten. Darum fragte Er sie, bevor Er handelte, ob es erlaubt sei, am Sabbat Gutes oder Böses zu tun. Nun waren ihre Gewissen ins Licht Gottes gestellt. Leider verhärteten sie sich und schwiegen. Und der Herr? Unwillig über ihre verstockten Herzen heilte Er den Mann mit der verdorrten Hand. Ihre böse Gesinnung konnte seine Gnade nicht zurückhalten. Wie traurig war die Reaktion: Zwei verfeindete Parteien verbanden sich und suchten gemeinsam, den Herrn Jesus zu töten!
Der Herr beruft zwölf Jünger
Die Menschenmengen, die von überall her zum Herrn Jesus strömten, machen deutlich, wie gross die Wirkungen seines Dienstes waren. So viele drängten sich in seine Nähe, dass sie ein Boot für Ihn bereithalten mussten. Nun konnte Er vom Schiff aus zu den Menschen am Ufer reden (vergleiche Matthäus 13,2; Lukas 5,3).
Die Menschen, die von unreinen Geistern besessen waren, standen völlig unter ihrer Kontrolle. Das macht die Formulierung in Vers 11 klar. Obwohl diese Dämonen wussten, dass sie es mit dem Sohn Gottes zu tun hatten, wollte Er kein Zeugnis von ihnen annehmen. Er gebot ihnen, Ihn nicht offenbar zu machen.
Wir haben bereits früher gesehen, wie der Herr Jesus als Mensch in seinem Dienst Zeiten der Stille brauchte. In Vers 13 verlässt Er die Volksmenge für eine Weile und steigt auf den Berg. Dann beruft Er seine zwölf Apostel und erweitert damit seinen Dienst. Aber beachten wir die Reihenfolge. Zuerst sollen sie bei Ihm sein und von ihrem Meister lernen. Das Aussenden, um zu predigen und den Menschen zu dienen, folgt später (vergleiche Markus 6,7).
Bei der Aufzählung der Namen seiner Apostel fällt auf, wie Er drei von ihnen zusätzliche Namen gibt. Simon bekommt den Beinamen Petrus (= Stein). Schon bei seiner ersten Begegnung nannte ihn der Herr Jesus so (Johannes 1,42). Johannes und Jakobus werden Söhne des Donners genannt. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus veränderte sich Johannes zum «Jünger, den Jesus liebte» (Johannes 13,23).
Der Herr ist stärker als Satan
Der Dienst des Herrn Jesus wurde nicht von allen geschätzt und verstanden. Als Er von den vielen Leuten so sehr in Beschlag genommen wurde, dass Er mit seinen Jüngern nicht einmal Zeit zum Essen fand, meinten seine Angehörigen, nun übertreibe Er. Ihr Urteil lautete: «Er ist ausser sich.»
Seine Feinde aber zogen einen viel schrecklicheren Schluss: Sie schrieben sein wunderbares Handeln der Macht Satans zu. Wie schlimm, wenn der Mensch in der gütigen Tätigkeit des Sohnes Gottes nur Überspanntheit oder sogar das Werk des Teufels sieht!
Nun versuchte der Herr Jesus seinen Gegnern mit einem Gleichnis den Unsinn ihrer Worte aufzuzeigen. Satan kämpft doch nicht gegen sich selbst! In Vers 27 weist Er auf sich hin: Er ist stärker als der Teufel. Durch sein Erlösungswerk am Kreuz würde Er den Starken besiegen und ihm die Beute entreissen (Hebräer 2,14.15).
Die Verse 28 bis 30 beziehen sich vor allem auf das Volk der Juden. Zu ihnen war der verheissene Messias gekommen. Doch sie lehnten Ihn ab, indem sie behaupteten: «Dieser Mensch hält den Sabbat nicht» (Johannes 9,16). Eine solche Sünde hätte vergeben werden können. Aber sie gingen weiter und schrieben das Wirken des Herrn in der Kraft des Heiligen Geistes dem Teufel zu. Sie nannten also den Heiligen Geist einen Dämon. Damit war die Hoffnung für Israel im Blick auf die Verantwortung des Volkes zu Ende. Hier gab es keine Vergebung mehr. Eine Wiederherstellung Israels wird es in der Zukunft nur auf dem Boden der bedingungslosen Gnade geben.
Der Sämen sät das Wort
Weil die Juden den Heiligen Geist, durch den der Herr wirkte, einen Dämon nannten, brach der Heiland die Beziehung zu Israel als verantwortlichem Volk ab. Das wird aus seiner Antwort an seine Mutter und seine Brüder deutlich, die gekommen waren und Ihn zu sich gerufen hatten. Mit einem Blick in die Runde fragte Er: «Wer ist meine Mutter und meine Brüder?» Sein Volk hatte Ihn verworfen. Doch Er bekannte sich zu den Einzelnen, die bereit waren, den Willen Gottes zu tun. Es waren die, die an Ihn glaubten. Sie bildeten jetzt seine Familie. – Trotz diesem Bruch mit seinem Volk fuhr der Herr in seiner Langmut bis zum letzten Passah fort, den Menschen Gottes Güte zu erweisen.
Der Herr fand keine Frucht für Gott im Weinberg Israel. Der verantwortliche Mensch hatte völlig versagt. Auf dem Weg der Erfüllung der Forderungen Gottes, kann der Mensch Gott niemals gefallen.
Nun begab sich der Herr an den See und belehrte die Volksmenge von einem Schiff aus. Das erste Gleichnis, das Er den Zuhörern vorstellte, war das vom Sämann. Er selbst ist der Sämann, der das Wort in die Herzen der Menschen sät, damit es Frucht für Gott hervorbringe. Doch das Gleichnis macht klar, dass längst nicht jedes Menschenherz, in das der Same des Wort Gottes fällt, Frucht bringt.
Der Same kann an vier verschiedene Orte fallen, was vier unterschiedlichen Herzenszuständen entspricht. Aber nur im Herzen, das mit der guten Erde verglichen wird, wächst der Same und bringt dreissig-, sechzig-, ja, sogar hundertfache Frucht.
Hören und Frucht bringen
Die Verse 11 und 12 machen nochmals das Gerichtsurteil deutlich, unter dem das jüdische Volk als Ganzes stand, weil es Christus verworfen hatte. Doch seinen Aposteln und den Einzelnen, die echtes Interesse am Wort Gottes hatten, wollte der Herr Jesus das Gleichnis in Gnade erklären.
Der Weg illustriert ein hartes Herz. Wenn so jemand das Wort hört, bleibt es an der Oberfläche. Es dringt nicht ins Herz. Da ist der Satan sofort zur Stelle und nimmt das Wort weg. Das Gehörte wird schnell wieder vergessen und es entsteht keine Frucht.
Im zweiten Fall wird das Wort mit Freuden aufgenommen. Der Hörer freut sich über das Wort der Gnade. Aber weil sein Gewissen nicht erreicht und überführt wird, gibt er das Gehörte wieder auf, sobald Schwierigkeiten auftreten.
Das unter die Dornen gesäte Wort wird von allem, was sonst noch das Herz bewegt, erstickt und bringt auch keine Frucht. Es können die Sorgen, der Einfluss des Geldes und das Verlangen nach Vergnügen sein, die sich im Innern breitmachen und das Wort verdrängen.
Die gute Erde ist das Bild eines zubereiteten Herzens. Solche Menschen hören das Wort nicht nur, sondern nehmen es auch auf, so dass es das Gewissen erreicht und zur Buße und zum Glauben führt. Das Resultat ist dreissig-, sechzig- oder sogar hundertfache Frucht. Wie sie zustande kommt, wird nicht näher gesagt. Es wird nur von der sichtbaren Auswirkung gesprochen. Zweifellos wird die Gnade tätig, so dass das gehörte Wort Gottes wächst und Frucht bringt.
Das Licht und die Wirkung des Wortes
Wer das Wort Gottes geglaubt und ins Herz aufgenommen hat, ist in der Lage, die Botschaft auch anderen weiterzugeben. Gott möchte nicht, dass das Licht des Evangeliums, das Er uns geschenkt hat, verborgen bleibt. Die Lampe gehört auf den Lampenständer. Doch das Licht, das wir in der Welt verbreiten sollen, kann durch «den Scheffel» (ein Hohlmass) oder «das Bett» gedämpft werden. Wenn uns die Beschäftigungen des Lebens (Scheffel) zu stark in Beschlag nehmen, oder wenn wir uns der Bequemlichkeit hingeben (Bett), wird unser Zeugnis in der Welt beeinträchtigt.
In Vers 22 spricht der Herr über das verborgene Wirken Gottes im Herzen von Menschen. Wenn sich jemand wirklich bekehrt, kann dies vor den anderen nicht verborgen bleiben. Sie werden eine Veränderung in seinem Leben feststellen. Die Verse 24 und 25 reden vom Wachstum bzw. von der Stagnation des geistlichen Lebens eines Glaubenden. Wir können nur an Erkenntnis und an Gnade zunehmen, wenn wir auf das Wort Gottes hören. Je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, umso mehr «wird uns gegeben werden».
Im nächsten Gleichnis spricht der Herr Jesus von seinem eigenen Wirken. Er ist der Sämann, der den Samen auf das Land geworfen hat. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung ist Er in den Himmel zurückgekehrt und lässt den ausgestreuten Samen wachsen. Zur Zeit der Ernte wird Er wiederkommen, um die Garben in seine Scheune zu sammeln. In der Zwischenzeit aber wirkt Er in seiner Gnade im Verborgenen, damit das ausgestreute Wort zur Frucht heranreift.
Mit Jesus Christus im Sturm
In den Versen 30 bis 34 unterweist der Herr Jesus seine Zuhörer durch ein weiteres Gleichnis über das Reich Gottes. Es zeigt die äussere Entwicklung des Reichs. Am Anfang glich das Christentum einem unscheinbaren Senfkorn. Die Botschaft vom Heiland der Welt, der am Kreuz für sündige Menschen gestorben ist, wurde von den Menschen verachtet (1. Korinther 1,18.23).
Doch es blieb nicht so. Unter der menschlichen Verantwortung wurde die christliche Lehre den Vorstellungen der Menschen angepasst und das Christentum in der Welt salonfähig gemacht. Die Folge davon war, dass es sich zu einer grossen Macht auf der Erde entwickelte. Hinter den Vögeln des Himmels müssen wir den Einfluss Satans sehen (Markus 4,4.15). Er sorgt dafür, dass alle Ideen der sündigen Menschen unter dem Deckmantel des Christentums geduldet und verbreitet werden.
Die Überfahrt in den Schlussversen des Kapitels illustriert die heutige Zeit und die Umstände, in denen wir leben. Manchmal scheint es, als kümmere sich der Herr Jesus nicht um uns. Aber denken wir daran, dass die Jünger den Willen des Herrn befolgten, als sie ans jenseitige Ufer übersetzten. Das gilt auch für uns. Wenn wir seinen Willen tun möchten, ist Er mit uns in unserem Lebensboot. Vielleicht lässt Er einen Sturm zu, um unseren Glauben zu testen. Dann lasst uns nie vergessen: Ein Schiff, in dem Er sich befindet, kann nicht untergehen! Wir sind mit Ihm unterwegs. Darum brauchen wir uns nicht zu fürchten. Seine Sicherheit ist auch die unsere.
Ein Bessesener wird befreit
Der Herr Jesus hat nicht nur Macht über die Schöpfung, so dass Wind und Wellen Ihm gehorchen müssen. Ihm haben auch die bösen Geister zu gehorchen. Das sehen wir bei der Heilung des besessenen Gadareners.
Dieser bedauernswerte Mann zeigt uns das Bild eines unbekehrten Menschen. Wir begegnen ihnen tagtäglich. Viele denken zwar, sie seien frei und könnten tun und lassen, was ihnen gefällt. Doch sie täuschen sich. Es stimmt nicht. Natürlich stehen die meisten nicht so direkt unter dem satanischen Einfluss. Aber alle Menschen befinden sich in ihrem natürlichen Zustand unter der Macht der Finsternis und sind Sklaven der Sünde (Hebräer 2,14.15; Römer 6,17-21).
Dieser Mann war mit allen menschlichen Mitteln nicht zu bändigen. So schlagen alle Versuche fehl, den Menschen zu kultivieren und zu verbessern. Die jahrtausendealte Menschheits-Geschichte liefert den besten Beweis dafür.
Hier aber kam Einer, der stärker als der Teufel ist. Die Dämonen wussten genau, mit wem sie es zu tun hatten: mit Jesus, dem Sohn Gottes, des Höchsten. Als Er ihnen befahl, aus dem Menschen auszufahren, baten die unreinen Geister Jesus, Er möge sie nicht aus der Gegend vertreiben. Offensichtlich war man in diesem Landstrich besonders empfänglich für okkulte Einflüsse. So erlaubte der Herr ihnen, in die Herde Schweine zu fahren. Da zeigten sie ihren Hang zur Zerstörung und Vernichtung. Die Schweine stürzten sich in den See, wo sie ertranken.
Die Gadarener schicken Jesus fort
Man kann sich den Schrecken der Schweinehirten vorstellen, als sie zusehen mussten, wie die ganze Herde von einer unsichtbaren Macht getrieben ins Verderben stürzte. Sie flohen in die Stadt und berichteten, was vorgefallen war. Nun kamen die Bewohner, um Den zu sehen, der solches bewirken und zulassen konnte.
Was sahen sie beim Herrn Jesus? Einen völlig befreiten Mann. Er, der einst unter der Macht Satans gestanden hatte, sass nun ruhig, bekleidet und vernünftig bei seinem Erlöser. Welch ein Zeugnis von der Macht und Gnade des Sohnes Gottes!
Wie traurig ist da die Reaktion jener Leute! Mit der Anwesenheit Satans in Form dämonischer Mächte konnten sie leben. Aber die Gegenwart Gottes in der Person seines Sohnes als demütiger Diener war für sie unerträglich. Fürchteten sie vielleicht, dass Er auch in ihrem Leben Ungereimtheiten aufdecken würde? Jedenfalls baten sie den Herrn Jesus, ihre Gegend zu verlassen. Später stiessen die Menschen Christus aus der Welt hinaus. Sie schlugen Ihn ans Kreuz und sagten damit: Kehre dorthin zurück, woher Du gekommen bist.
Der Geheilte wäre gern mit dem Heiland gegangen. Doch der Herr schickte ihn als Zeuge von dem, was er erlebt hatte, zu seiner Familie zurück. Wie schön ist der Gehorsam dieses Mannes! Nicht nur seinen nächsten Angehörigen, sondern in jener ganzen Gegend erzählte er, «wie viel Jesus an ihm getan hatte». In Markus 7,31-37 finden wir eine Frucht dieses Zeugnisses in der Dekapolis.
Die Frau mit dem Blutfluss
Sobald der Herr Jesus aus dem Land der Gadarener zurückkam, versammelten sich wieder viele Menschen um Ihn. Da kam ein Synagogenvorsteher mit einer grossen familiären Not zum Heiland. Seine zwölfjährige Tochter lag im Sterben. Er bat Ihn: «Komm doch und lege ihr die Hände auf.» Sofort machte sich der Herr auf den Weg.
So wie dieser Mann mit seiner Not zum Herrn Jesus kam, können heute alle gläubigen Eltern ihre Sorgen im Blick auf die Errettung ihrer noch unbekehrten Kinder im Gebet vor den Herrn bringen. Es ist sein Wille, dass sie gerettet werden.
In der Volksmenge, die dem Herrn Jesus wegen der Wunder, die Er tat, aus reiner Neugier nachfolgte, befand sich eine kranke Frau, die wirklich glaubte. Sie war überzeugt, dass das Anrühren seiner Kleider genügte, um geheilt zu werden. So kam sie von hinten, rührte mit Glaubensüberzeugung sein Gewand an und wurde auf der Stelle gesund.
Dann drehte sich der Heiland um und wollte wissen, wer Ihn angerührt und wer die heilende Kraft, die von Ihm ausgegangen war, erfahren hatte. Seine Augen suchten die Person, die Ihn im Glauben angefasst hatte. Doch Er wollte sie nicht einfach blossstellen, sondern sie in eine persönliche Beziehung zu sich bringen. Dazu war nötig, dass sie Ihm die ganze Wahrheit bekannte. Sie tat es, wenn auch mit Furcht und Zittern. Dann durfte sie jedoch die Bestätigung aus seinem Mund hören: «Dein Glaube hat dich geheilt; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage.» Sein Wort gab ihr die Gewissheit, dass sie gesund geworden war.
Die Tochter von Jairus wird auferweckt
Wie ging es Jairus in der Zwischenzeit? Der Heiland wollte doch mit ihm nach Hause zu seiner todkranken Tochter gehen! Unterdessen bekam der Synagogenvorsteher die traurige Nachricht: «Deine Tochter ist gestorben.» Nun war es zu spät! Was nützte es noch, dass der Herr Jesus zu ihm kam?
In dieser hoffnungslosen Situation sagte der Heiland zu ihm: «Fürchte dich nicht; glaube nur.» Zudem ging der Herr mit Petrus, Jakobus und Johannes einfach den Weg weiter, bis Er beim Haus von Jairus ankam.
Dort zeigte sich die ganze Hoffnungslosigkeit der Menschen angesichts des Todes: Sie weinten und jammerten laut. Welch ein Lärm! Nun betrat der Sohn Gottes das Trauerhaus. Für Ihn, den Allmächtigen, war das Mädchen nicht gestorben. Es schlief nur. Doch die ungläubigen Menschen verlachten Ihn, so dass Er alle hinausschicken musste.
Allein mit den Eltern des Kindes und den drei Jüngern trat Er in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Dort offenbarte Er sich als der Sohn Gottes, der das Leben ist und es wiedergeben kann. Mit den Worten «Mädchen, ich sage dir, steh auf!» rief Er es ins Leben zurück. Welch ein Wunder durften diese geprüften Eltern erleben!
Die Aufforderung des Retters in Vers 43, man möge ihr zu essen geben, gilt auch im übertragenen Sinn. Wenn ein Mensch durch den Glauben an den Herrn Jesus neues, göttliches Leben empfängt, braucht er geistliche Nahrung aus der Bibel. Nur so kann sich sein Glaubensleben gesund entwickeln.
Der Herr sendet die zwölf Apostel aus
Auf dem Weg seines Dienstes kam der Herr auch nach Nazareth. Am Sabbat lehrte Er in der Synagoge, wo Ihn alle kannten. Was die Bewohner seiner Vaterstadt zu hören bekamen, passte überhaupt nicht ins Bild, das sie bis dahin von Jesus Christus hatten. Für sie war Er der Sohn der Maria. Erstaunt fragten sie sich: «Woher hat dieser das alles, und was ist das für eine Weisheit, die diesem gegeben ist?» Um in diesem demütigen Menschen nicht nur den Sohn der Maria, sondern den Christus und den Sohn Gottes zu erkennen, wäre Glauben nötig gewesen. Doch dieser fehlte jenen Menschen. Sie sahen in Ihm nur den Zimmermann. Durch ihren Unglauben behinderten sie das Wirken der Macht Gottes. «Er konnte dort kein Wunderwerk tun.»
Vor einiger Zeit hatte der Herr die Apostel zu sich gerufen, «damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende» (Markus 3,13.14). Nun war der Zeitpunkt gekommen, wo Er sie zu zwei und zwei aussandte. Für ihren Dienst rüstete Er sie mit besonderer Vollmacht aus. Darin zeigte sich einmal mehr, dass Jesus Christus Gott war, denn kein Mensch kann einem anderen solche Kraft verleihen. Wie ihr Meister übten auch seine Gesandten diese göttliche Macht in Güte aus.
Noch war ihr Lehrer bei ihnen. Sie brauchten nichts mitzunehmen. Er würde für sie sorgen (Lukas 22,35). Ihre Botschaft richtete sich ans Volk Israel. Da, wo man sie nicht aufnehmen wollte, sollten sie den Staub abschütteln als ein Zeugnis gegen jene Stadt. Wer die Boten des Herrn ablehnte, verwarf Ihn selbst.
Herodes und Johannes der Täufer
In jener Zeit hörte auch König Herodes, zu dessen Herrschaftsbereich Galiläa gehörte, von Jesus Christus. Nun regte sich sein Gewissen, denn er hatte Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen und ihn schliesslich enthauptet. Als er nun vom Wirken Jesu hörte, dachte er, Johannes sei auferstanden.
Ab Vers 17 folgt der ausführliche Bericht vom Zeugnis des Johannes gegenüber König Herodes, von seiner Gefangennahme und den Begleitumständen seines gewaltsamen Todes. Weshalb wird diese Geschichte an dieser Stelle im Markus-Evangelium erwähnt? Weil mit dem Tod des Vorläufers des Herrn die Berichterstattung beginnt, den Widerstand des menschlichen Herzens gegen das Zeugnis Gottes aufzuzeigen. Die Feindschaft gegen die Wahrheit und das Licht erreichte mit der Kreuzigung des Herrn Jesus ihren Höhepunkt.
Aus dem Verhalten von König Herodes lernen wir zudem einiges, was allgemein gültig und wichtig ist. Herodes wusste, dass Johannes ein gerechter und heiliger Mann war. Er hatte manche Unterredung mit ihm und es schien, als habe das Zeugnis von Johannes einen guten Einfluss auf den König (Vers 20). Doch es waren nur natürliche Regungen. Diese genügen nicht, um die gefallene Natur des Menschen in Schach zu halten. Eine wirkliche Veränderung gibt es nur bei einem Menschen, der im Gewissen getroffen wird, Buße tut und Gott seine Sünden bekennt. Ihm wird vergeben und er empfängt ein neues Leben. Bei Herodes ging es nicht so tief. Er blieb ein Sklave seiner Begierden.
Die Speisung der Fünftausend
Wir können uns vorstellen, wie die Apostel zum Herrn Jesus zurückkamen. Sie waren ganz erfüllt von dem, was sie erlebt und gewirkt hatten. Alles erzählten sie Ihm. Doch der Heiland sagte kein Wort dazu. Er forderte sie vielmehr auf: «Kommt ihr selbst her an einen öden Ort für euch allein und ruht ein wenig aus.» Wie nötig ist es für jeden Arbeiter des Herrn, sich nach einem Dienst in die Gegenwart Gottes zurückzuziehen. Beim Herrn Jesus in der Stille werden wir nicht überheblich. Im Gegenteil! Dort lernen wir, was wir in Wahrheit sind. In seiner Gegenwart geniessen wir seine Liebe. Wir sind mit Ihm und nicht mit uns beschäftigt.
Die Ruhepause war kurz, denn die Liebe Gottes findet in dieser Welt keinen Ruheort. Am Ziel ihrer Überfahrt trafen sie eine grosse Volksmenge, die bereits auf den Herrn Jesus wartete. Und Er? Er wurde nicht ärgerlich über die gestörte Ruhe. Er dachte nicht an sich, sondern wurde innerlich bewegt, als Er die geistlichen Bedürfnisse dieser Menschen sah. «Er fing an, sie vieles zu lehren.»
In dieser Menschenmenge waren auch körperliche Bedürfnisse vorhanden. Der Heiland übersah sie nicht. Als die Jünger die Leute wegschicken wollten, sagte Er zu ihnen: «Gebt ihr ihnen zu essen.» Doch der Kleinglaube seiner Nachfolger rechnete menschlich. Der Herr aber nahm das Wenige, das vorhanden war, dankte für das Essen und verteilte es unter alle. Keiner kam zu kurz. Jeder bekam genug. Es blieben sogar zwölf Handkörbe voll Brocken übrig. Welch eine Gnade!
Der Herr Jesus wandelt auf dem See
Die Beschreibung der Umstände bei der Überfahrt ab Vers 45 gibt uns manche Hinweise auf die Zeit, in der wir leben. Der Herr Jesus ist abwesend, aber Er ist im Himmel als Hoherpriester für uns tätig. Obwohl die Jünger sich gehorsam auf den Weg machten, den der Meister sie angewiesen hatte, litten sie bald unter starkem Gegenwind. So lässt der Herr auch auf unserem Glaubensweg Stürme zu. Aber Er sieht alles und hat alles in seiner Hand. Lasst uns dies nicht vergessen!
In der Überfahrt sehen wir auch ein prophetisches Bild. Die Volksmenge wird entlassen. So wurde Israel nach der Verwerfung des Messias als Volk auf die Seite gestellt. Die Jünger im Schiff stellen den gläubigen Überrest der Juden am Ende der Zeit dar. Sie werden durch die schwere Drangsalszeit gehen müssen. Doch der Herr vergisst sie nicht. Zu seiner Zeit erscheint Er und tröstet sie mit den Worten: «Fürchtet euch nicht.» Er gibt sich als ihr Erretter zu erkennen und befreit sie aus ihrer Not.
Die Verse 53 bis 56 runden das soeben beschriebene prophetische Bild ab. Ähnlich wie der Herr Jesus in seiner Schöpfermacht zu den Jüngern kam, wird Er in Macht für den treuen Überrest erscheinen und das Tausendjährige Reich einführen. Dann wird es so sein, wie es hier bildlich gezeigt wird. Nicht nur Israel wird gesegnet sein. Auch die Völker werden den Segen geniessen, den der Herr Jesus auf der Erde geben wird. Diese Verse illustrieren, wie alles von Christus ausgehen wird. Dann wird Er da angenommen werden, wo Er einst abgelehnt wurde.
Der Herr tadelt menschliche Vorschriften
Im Judentum gab es viele Überlieferungen der Ältesten. Diese Vorschriften regelten das Verhalten der Menschen. Eine Religion, die auf äusseres Benehmen Wert legt, wird im Allgemeinen geschätzt. Es ist einfach, solche Vorschriften zu befolgen. Dazu braucht man kein reines Herz vor Gott. Zudem kann man sich durch ein besonders genaues Einhalten von Vorschriften vor den anderen in ein gutes Licht stellen. Man erscheint frömmer als sie.
Um dieses Thema geht es in den ersten Versen dieses Kapitels. Es störte die Pharisäer, dass die Jünger des Herrn Jesus ihre Waschvorschriften nicht befolgten. Die Antwort des Meisters könnte nicht deutlicher sein. Mit einem Wort aus dem Propheten Jesaja deckte Er ihre Heuchelei auf. Die äussere Frömmigkeit brachte sie nicht in die Gegenwart Gottes. Nein, ihr Herz war weit von Gott entfernt.
Aber noch schlimmer war, dass die Pharisäer ihre Überlieferungen über das ewige Wort Gottes stellten und damit die Aussagen der Bibel ungültig machten. Der Herr Jesus führte dazu ein Beispiel an: Gott verlangt in der Bibel, dass wir die Eltern ehren. Die frommen Führer aber wandten ein: Wenn du das, was du zur Unterstützung deiner Eltern brauchen würdest, als Opfer Gott gibst, befreit dich das vom Halten des fünften Gebots.
Auch heute lieben viele Menschen eine Religion äusserer Werke. Sie sind froh, dass keine echte innere Heiligkeit von ihnen gefordert wird. Aber Gott verabscheut eine solche oberflächliche Frömmigkeit. Er sieht auf das Herz und erkennt, wie der Mensch zu Ihm steht.
Innere und äussere Verunreinigung
Die Pharisäer legten grossen Wert auf äussere Reinheit. Doch der Herr macht in den Versen 14 bis 16 allen Zuhörern klar, dass der Mensch durch das, was er durch den Mund aufnimmt, vor Gott nicht verunreinigt wird. Was ihn verunreinigt, ist das, was aus dem Innern des Menschen hervorkommt und in seinem Verhalten sichtbar wird.
Die Jünger verstanden die Worte des Herrn nicht. Ihr natürliches Verständnis war durch die Traditionen der Ältesten getrübt. Auch heute gibt es ernsthafte Menschen, die meinen, sie würden sich vor Gott verunreinigen, wenn sie diese oder jene christliche Tradition nicht mehr befolgten.
Nun ist der Herr Jesus in seinen Ausführungen ganz deutlich: Das Böse, das den Menschen vor Gott schuldig macht, kommt aus seinem eigenen Herzen. Dort liegt die Quelle der schlechten Gedanken, die oft zu bösen Taten führen. Die Aufzählung all der schlimmen Dinge, die dem menschlichen Herzen entspringen, zeigt, dass Gott unser Herz nicht nur erforscht, sondern es auch durch und durch kennt.
Glücklicherweise gibt es eine Lösung für dieses Problem. Wenn wir an den Herrn Jesus glauben, werden wir von neuem geboren. Wir empfangen neues, göttliches Leben. Oder anders ausgedrückt: Wir erfahren eine Ganzwaschung und werden rein für Gott (Johannes 13,10). Da wir aber nach der Bekehrung neben dem neuen Leben auch die alte, sündige Natur noch haben, gilt es, ständig wachsam zu sein. «Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens» (Sprüche 4,23).
Zwei Heilungen
Von Galiläa zog der Herr Jesus weiter nördlich in das angrenzende Gebiet von Tyrus und Sidon. Er suchte etwas Ruhe. Aber Güte gepaart mit göttlicher Macht ist in der Welt so etwas Unbekanntes, dass es auffällt. Es kann nicht verborgen bleiben.
Eine heidnische Frau aus jener Gegend, deren Tochter unter der Gewalt eines unreinen Geistes stand, fiel zu den Füssen des Herrn Jesus nieder und bat Ihn, den Dämon auszutreiben. Weil die Frau nicht zu Israel gehörte, hatte sie kein Anrecht auf den Segen, den der Messias seinem Volk brachte. Darauf machte der Herr sie in Vers 27 aufmerksam. Doch die Not in ihrer Familie und das Vertrauen in die Güte und Macht des Herrn bewog sie, nicht aufzugeben. Sie anerkannte die Rechte des Volkes Israel und gab zu, dass sie nur ein Hund war. Aber sie stützte sich auf die Gnade Gottes, von der sie dachte, dass sie auch für Rechtlose genüge. Sie wurde nicht enttäuscht.
Zurück in Galiläa zog der Herr Jesus durch das Gebiet der Dekapolis. Hier brachten sie einen tauben Menschen zu Ihm, der auch schwer redete. Der Heiland nahm ihn auf die Seite und kümmerte sich persönlich um ihn. Warum seufzte Er, als Er zum Himmel aufblickte und sagte: «Werde aufgetan!»? Dieser Mann war ein Abbild seines irdischen Volkes. Die Menschen aus Israel waren taub gegenüber der Stimme des guten Hirten. Die schwere Zunge zeigt, dass es auch am Lob Gottes fehlte. Das alles beschwerte den Herrn. Dennoch half Er dem Tauben in seiner Gnade und Macht, so dass die Menschen erstaunt sagten: «Er hat alles wohlgemacht.»
Die Speisung der Viertausend
Der Herr Jesus fährt fort, in Güte zu handeln. Viele Menschen waren von Ihm angezogen worden. Nun weilten sie bereits drei Tage bei Ihm. Ans Essen hatte niemand mehr gedacht. Aber jetzt sehen wir den Heiland innerlich bewegt über die Menschen, die Hunger hatten. In diesem Zustand wollte Er sie nicht nach Hause schicken.
Der Meister hätte seine Empfindungen gern mit den Jüngern geteilt. Doch sie sahen nur die menschliche Unmöglichkeit, diesen vielen Leuten in der Einöde zu essen zu geben. Sie waren weder innerlich bewegt wie der Herr, noch zeigten sie Vertrauen in Gott und seine Allmacht. Ja, sie hatten in der Schule des Meisters noch manches zu lernen!
Nun begann Er selbst zu handeln. Wieder wurden die Vielen mit dem Wenigen, das vorhanden war, mehr als gesättigt. Es blieben sieben Körbe voll Reste übrig.
Aufs Neue überquerte der Herr mit den Jüngern den See Genezareth. Im Gebiet von Dalmanuta griffen Ihn die Pharisäer wieder an. Sie forderten von Ihm ein Zeichen vom Himmel. Waren all die Wunder und Zeichen, die sie bisher von Ihm gesehen hatten, nicht vom Himmel? Doch! Er war vom Himmel herabgekommen, um den Menschen die Werke seines Vaters zu zeigen (Johannes 6,38; 10,32). Aber der Unglaube ist nie zufrieden. Das zu erleben, war für den Herrn Jesus eine grosse Not, so dass Er in seinem Geist tief seufzte. Ja, für die ungläubigen Pharisäer war die Zeit abgelaufen. So liess der Herr sie einfach stehen. Wenn das Herz nicht glauben will, nützen alle Zeichen nichts.
Warnung vor den Pharisäern
Die Jünger des Herrn waren nicht ungläubig wie die Pharisäer, aber sie waren geistlich blind. Als der Herr sie mit dem Bild des Sauerteigs vor der Heuchelei und der Weltförmigkeit der Führungsschicht in Israel warnte, dachten sie an materielle Brote. Sie hatten keine mitgenommen und sorgten sich nun. Da musste der Herr Jesus ernst mit ihnen reden. Hatten sie wirklich all das, was kurz vorher geschehen war, vergessen? Waren die Speisung der 5000 und die der 4000 mit den wenigen vorhandenen Broten und Fischen ohne Eindruck auf sie geblieben? – Wie steht es um uns? Muss der Herr nicht auch uns manchmal vorwurfsvoll fragen: «Begreift ihr noch nicht?» Haben wir noch nicht gemerkt, was für einen wunderbaren Herrn wir haben?
Die Heilung in zwei Schritten, wie sie der Blinde erfuhr, der in Bethsaida zum Herrn Jesus gebracht wurde, enthält eine geistliche Belehrung. Wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, erfolgt das geistliche Sehen oft auch in zwei Schritten. Zuerst erkennt man die Vergebung seiner Sünden und empfängt neues, göttliches Leben. Aber oft fehlt eine wirkliche Heilsgewissheit. Erst wenn der Erlöste den Umfang und den Inhalt der Errettung gemäss den Belehrungen der Bibel erkennt, verschwinden die Zweifel. Dann bekommt er einen festen inneren Frieden.
Wie viel Mühe gab sich der Herr Jesus, um diesen Blinden ganz zu heilen! So bemüht Er sich auch heute um die, die an Ihn glauben. Er möchte ihnen das ganze Ausmass des göttlichen Heilsplans verständlich machen.
Einem verworfenen Herrn nachfolgen
Auf die Frage des Herrn Jesus an die Jünger: «Wer sagen die Menschen, dass ich sei?», gab es ganz verschiedene Antworten. Das Entscheidende aber war, dass die Jünger selbst überzeugt waren, dass Er der Messias war: «Du bist der Christus.» Sie sollten es jedoch niemand weitersagen, weil sein Zeugnis unter dem Volk bereits zu Ende war. Die Mehrheit hatte Ihn abgelehnt.
Die Jünger erkannten den Herrn Jesus wohl als den Christus, aber sie verbanden Ihn nur mit der Herrlichkeit seines Reichs. Darum musste Er von seiner Verwerfung und seinem Tod reden. Wenn Er ihnen das Kreuz vorstellte, redete Er immer auch von seiner Auferstehung. Als der Heiland so offen mit den Jüngern sprach, meinte Petrus, er müsse Ihm widersprechen. Da machte der Herr ihm klar, dass seine Worte von Satan kamen und keineswegs dem Willen Gottes entsprachen.
Es ist nicht so einfach, dem Herrn Jesus in einer Welt nachzufolgen, die Ihn verworfen hat. Das zeigen uns die Verse 34 bis 38. Wirklich sein Jünger zu sein, bedeutet Selbstverleugnung. Weiter sagt der Herr: «Er nehme sein Kreuz auf.» Wenn damals einer ein Kreuz trug, war er auf dem Weg zur Richtstätte. Ein solcher hatte mit der Welt abgeschlossen und die Welt mit ihm. Genau dies sollen wir als Nachfolger des Herrn verwirklichen und keine unnötige Verbindung zur Welt um uns her unterhalten. Wenn uns ein solcher Weg Mühe macht, dann lasst uns daran denken, dass dieser Weg zur Herrlichkeit führt. Wir gehören dem Sohn des Menschen an, der in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen heiligen Engeln kommen wird.
Die Herrlichkeit auf dem Berg
In Markus 8 hatte der Herr Jesus zu den Jüngern von seiner Verwerfung als Messias und von seinem Tod gesprochen. Wenn sie Ihm wirklich nachfolgen wollten (Markus 8,34), mussten sie bereit sein, in der Welt auf der Seite eines verworfenen Herrn zu stehen. Im Hinblick auf diese veränderte Situation wollte Er den Glauben der Jünger stärken.
Dazu nahm Er drei von ihnen mit auf einen hohen Berg und zeigte ihnen etwas von seiner persönlichen Herrlichkeit. Die Eindrücke, die der Apostel Petrus dabei empfing, vergass er nicht mehr. In seinem zweiten Brief beschreibt er dieses Erlebnis auf dem heiligen Berg (2. Petrus 1,16-18).
Dem verwandelten Herrn erschienen zwei grosse Glaubensmänner aus dem Alten Testament: Mose und Elia. Sie stellen im Bild die verherrlichten Gläubigen dar, die in der himmlischen Herrlichkeit des zukünftigen Reichs mit dem Herrn Jesus vereint sein werden.
Als Petrus durch seine Aussage den Herrn auf die gleiche Stufe mit Mose und Elia stellte, griff Gott, der Vater, ein und unterstrich die Einzigartigkeit seines geliebten Sohnes. Auf Ihn sollten sie hören. Gleichzeitig verschwanden Mose und Elia.
Die Auferstehung des Sohnes des Menschen aus den Toten ist die Voraussetzung für die Erfüllung der angedeuteten Herrlichkeit auf dem Berg. Darum sollten die drei Jünger erst nach seiner Auferstehung über das Erlebte berichten. Die Frage über den kommenden Elia (Maleachi 3,23) veranlasste den Herrn, von seinen bevorstehenden Leiden und seinem Tod zu sprechen.
Der Junge mit dem stummen Geist
Als der Herr Jesus mit den drei Jüngern vom Berg herabkam, begegnete Er dem Unglauben der Welt, einem Mangel an Glauben bei den Seinen und der Schwachheit des Glaubens bei dem, der in Not war. Die Macht des Feindes schien stärker als alles zu sein. Warum waren die Jünger nicht in der Lage, den stummen Geist auszutreiben, obwohl sie früher solche Wunder in der Kraft des Herrn getan hatten (Markus 6,13)? Ihnen fehlte der Glaube. Darum konnten sie die Kraftquelle, die im Herrn vorhanden war, nicht gebrauchen.
Als dem Heiland die ganze Situation geschildert wurde, sehen wir, wie Er trotz des Versagens der Jünger in Geduld und Güte handelte. Er konnte ihnen zwar einen Tadel nicht ersparen. Doch im gleichen Atemzug sagte Er: «Bringt ihn zu mir!»
Der Vater des okkult belasteten Jungen war ganz verzweifelt. Gab es überhaupt noch Hoffnung für ihn und sein krankes Kind? Traurig bat er den Heiland: «Wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!»
Auf der Seite des Herrn gibt es jedoch kein Wenn. Es geht immer um den Glauben auf unserer Seite. Der arme Vater verstand die Antwort des Herrn und rief: «Ich glaube; hilf meinem Unglauben!» Diese aufrichtigen Worte aus einem schwer geprüften Herzen blieben nicht ohne Antwort vonseiten des Heilands. Mit göttlicher Autorität gebot Er dem unreinen Geist, für immer von dem Knaben auszufahren. Noch einmal zeigte sich die schreckliche Macht Satans. Aber dann musste sich der Dämon dem Befehl des Herrn beugen.
Unterweisungen an die Jünger
Weil der Herr Jesus als der verheissene Messias abgelehnt wurde, sprach Er von sich als dem Sohn des Menschen, der sterben, aber nach vollbrachtem Erlösungswerk auferstehen würde. Doch die Herzen der Jünger waren von ganz anderen Gedanken erfüllt. Deshalb verstanden sie seine Ankündigung nicht. Sie dachten an das Reich in Herrlichkeit und fragten sich, wer von ihnen darin den höchsten Platz einnehmen würde.
Wie gross sind die Langmut und die Güte des Herrn! Er setzte sich hin, um sich Zeit für seine Jünger zu nehmen (Vers 35). Er zeigte ihnen, dass sich ein Nachfolger des verworfenen Christus durch Demut auszeichnen soll. Da fragen wir uns: Offenbaren wir als Jünger des Herrn Jesus seine demütige Gesinnung?
Johannes betrachtete sich und die anderen Apostel immer noch als eine besondere Gruppe, denn er sprach von einem, «der uns nicht nachfolgt», und fügte hinzu: «Wir wehrten ihm.» Durch seine Antwort machte der Herr klar, wie vollständig seine Verwerfung war. Die ganze Welt war gegen Ihn. Sie ist es heute noch.
In den Versen 43 bis 48 geht es nicht um Körperteile, sondern um die bösen Neigungen unserer alten Natur. Wir dürfen ihnen keinen Spielraum lassen, sondern müssen konsequent gegen sie vorgehen. Obwohl ein Gläubiger seine ewige Errettung nicht mehr verlieren kann, heisst es doch in Römer 8,13: «Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben.»
Durch das Salz in den Schlussversen werden wir zu einer klaren Absonderung vom Bösen und zu einem Leben für Gott ermahnt (vergleiche dazu Römer 12,1-2).
Die Ehe und die Kinder
Immer wieder versuchten die Pharisäer dem Herrn Jesus mit verfänglichen Fragen eine Falle zu stellen. Doch der demütige Diener, der vor ihnen stand, ist der ewige Sohn Gottes, der jedem Menschen unendlich weit überlegen ist. Er wusste, was sie letztlich beabsichtigten. Deshalb stellte Er ihnen die Frage nach dem, was Mose geboten hatte. Als Antwort erwähnten sie die Möglichkeit eines Scheidebriefs.
Nun rückte der Herr Jesus alles ins göttliche Licht: Gott hatte den Scheidebrief nur zugelassen, weil Er wusste, wie hart die Herzen der Menschen sein können und wie wenig sie zum Vergeben bereit sind. Aber dies entsprach nicht dem, was im Herzen Gottes war. Er hatte am Anfang der Schöpfung die Ehe als unlösbare Verbindung zwischen einem Mann und seiner Ehefrau eingesetzt. Solange die Erde, d.h. die erste Schöpfung, besteht, bleibt die Ehe so, wie Gott sie eingesetzt hat. «Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.» Wer die Ehe trotzdem scheidet und eine neue Verbindung mit einem anderen Partner (oder einer anderen Partnerin) eingeht, begeht vor Gott die Sünde des Ehebruchs.
Als die Jünger diejenigen zurückwiesen, die Kinder zum Heiland bringen wollten, wurde Er unwillig. Seine Ermunterung «Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht» hat schon manchen Christen im Dienst an den Kindern bestärkt. Bringen wir die Kinder zum Herrn Jesus, indem wir ihnen aus der Bibel von Ihm erzählen und für sie beten! Er liebt sie und will sie segnen, wie Er es damals getan hat.
Der reiche junge Mann
Der Mann, der vor dem Herrn Jesus auf die Knie fiel, hätte gern gewusst, wie er ewiges Leben bekommen konnte. Weil er nicht nach der Errettung fragte, sondern etwas tun wollte, verwies ihn der Herr auf das Gesetz. Nun meinte er, dies alles befolgt zu haben. Auf diese kühne Behauptung ging der Heiland nicht ein. Er blickte ihn jedoch an, liebte das Liebenswürdige an seinem Charakter und enthüllte den wahren Zustand des Herzens: Hier regierte das Geld! Weil er es dem Herrn Jesus vorzog, ging er betrübt weg.
Die Jünger betrachteten materielles Vermögen als eine Gunst Gottes. Doch sie mussten lernen, dass man den Segen des Reichs Gottes nicht mit Geld erwerben kann. Reichtum kann sogar ein grosses Hindernis für die Errettung sein. Der wohlhabende Mensch vertraut auf sein Vermögen, anstatt sich ganz auf die Gnade zu stützen. Wer kann dann errettet werden? Niemand, der denkt, er könne etwas zu seiner Errettung beitragen. «Durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es» (Epheser 2,8).
Nun bemerkte Petrus gegenüber dem Herrn, dass er und die anderen Apostel den Weg der Nachfolge, den Er dem reichen Mann vorgestellt hatte, beschritten hatten. Was sollte aus ihnen werden? Wie ermutigend ist die Antwort des Herrn! Wer alles verlässt und Ihm nachfolgt, kommt nicht zu kurz. Er ist ein Kind Gottes, das die Fürsorge des himmlischen Vaters erfährt. Doch die wirkliche Belohnung für ein Leben der entschiedenen Nachfolge empfängt man erst im kommenden Zeitalter.
Hochmut und Neid
Nachdem der Herr Jesus bereits in Markus 8,31 und Markus 9,31 von seinen bevorstehenden Leiden und seinem Tod gesprochen hatte, kommt Er in den Versen 32-34 zum dritten Mal auf dieses Thema zu sprechen. Nun redet Er ausführlicher von seinen Leiden. Warum entsetzten sich die Zwölf darüber? Warum fürchteten sie sich, während sie ihrem Meister auf dem Weg nach Jerusalem folgten? Sie scheuten sich vor den Leiden und der Verachtung, die sie als Jünger des Herrn Jesus treffen konnte.
Die weiteren Verse beweisen, dass sie von anderen Gedanken erfüllt waren. Sie erwarteten immer noch das Reich in Herrlichkeit und hofften, darin einen bevorzugten Platz zu bekommen. Sie waren noch nicht bereit, die völlige Ablehnung des Messias durch ihre Landsleute anzuerkennen. Dann hätten sie sich zu einem verworfenen Herrn bekennen müssen.
Der egoistische Wunsch von Jakobus und Johannes rief den Unwillen der anderen Apostel hervor. Eifersüchtig stellten sie fest, dass diese beiden etwas vom Herrn erbaten, was sie selbst gern gehabt hätten. Doch der Herr ertrug seine Jünger mit grosser Geduld und versuchte ihnen zu zeigen, dass sie als Glaubende nicht nach Grösse und Einfluss streben sollten. «Wer irgend unter euch der Erste sein will, soll der Knecht aller sein.» Das war genau das Gegenteil von dem, was sie wollten! Der Heiland ermahnte die Jünger nicht nur. Er war auch ihr grosses Vorbild. Als Sohn des Menschen war Er gekommen, um zu dienen und schliesslich sein Leben als Lösegeld für die zu geben, die an Ihn glauben würden.
Bartimäus
Jericho war der Ausgangspunkt der letzten Reise des Herrn Jesus nach Jerusalem. Eine zahlreiche Volksmenge folgte Ihm. Wussten diese Leute, wer Er wirklich war? Nein! Für sie war Er Jesus, der Nazarener. Mehr nicht.
Doch der blinde Bartimäus, der bettelnd am Wegrand sass, war da anderer Meinung. Sobald er hörte, wer vorbeikam, rief er den Herrn Jesus mit aller Kraft als Sohn Davids um Erbarmen an. Er wusste: Dieser ist der verheissene Messias, der auch Blinden das Augenlicht geben kann (Jesaja 35,5). Als die Menschen aus der Menge ihn anfuhren und zum Schweigen bringen wollten, schrie er umso lauter. Auf diesen Glauben antwortete der Heiland. Er blieb stehen und rief Bartimäus zu sich.
Nun änderte sich die Stimmung in der Masse. Die Leute, die sich vorher durch das Schreien des Blinden gestört fühlten, sagten nun zu ihm: «Sei guten Mutes; steh auf, er ruft dich!» Doch auf die Meinung der Volksmenge konnte man und kann man sich nicht verlassen. Kurze Zeit später riefen sie: «Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!», und einige Tage nachher: «Kreuzige ihn!» (Markus 11,9; 15,13.14).
Bartimäus warf sein Oberkleid ab, um noch schneller zum Heiland zu kommen. Bei Ihm wurde der grösste Wunsch des Bettlers erfüllt. Er durfte die Worte des Herrn vernehmen: «Geh hin; dein Glaube hat dich geheilt!» Auf der Stelle wurde er gesund und konnte wieder sehen. Wohin ging er nun? Er folgte seinem Heiland auf dem Weg in Richtung Jerusalem nach.
Jesus reitet in Jerusalem ein
Wenn der Herr Jesus zu seinen Jüngern redete, nannte Er sich immer wieder Sohn des Menschen. Dieser Titel ist sehr umfassend. Als Sohn des Menschen steht Er in Beziehung zu allen Menschen. Der Titel Sohn Davids hingegen beschränkt sich auf das Volk Israel. Als Nachkomme von König David ist Er der Erfüller aller Verheissungen Gottes an sein irdisches Volk und der wahre König Israels.
In unserem Abschnitt zeigte sich der Herr seinem Volk noch einmal als Sohn Davids, der die Voraussage aus Sacharja 9,9 erfüllte. Zwei seiner Jünger sollten aus dem gegenüberliegenden Dorf ein Eselsfohlen holen und herbeibringen. Die Worte, die Er ihnen mitgab, drücken königliche Autorität aus, so dass die Besitzer des Fohlens die Jünger gewähren liessen.
Sobald sie das Tier brachten, setzte sich der Herr darauf und zog als demütiger König in Jerusalem ein. Die Menschen, die Ihn begleiteten, jubelten Ihm mit den Worten aus Psalm 118,25.26 zu. Damit anerkannten sie Ihn als königlichen Messias. Hinter allem aber sehen wir das Wirken Gottes. Er sorgte dafür, dass seinem Sohn, der von den Menschen verworfen war, für kurze Zeit dieses Zeugnis gegeben wurde.
Nachdem der Herr als Sohn Davids in Jerusalem eingezogen war, warf Er einen prüfenden Blick in den Tempel. Vieles, was Er da sah, stimmte nicht und passte nicht zu dem, was der Tempel sein sollte: das Haus Gottes. Hier konnte Er nicht bleiben. Er verliess die Stadt wieder und zog nach Bethanien hinaus, wo Herzen waren, die in Liebe für Ihn schlugen.
Der Herr reinigt den Tempel
Am nächsten Tag kam der Herr Jesus von Bethanien nach Jerusalem zurück. Er ging an einem Feigenbaum vorbei, von dem Er hoffte, Früchte an ihm zu finden. Doch er fand nur Blätter. Mit ernsten Worten verfluchte Er ihn.
Dieser fruchtlose Baum, an dem es nichts als Blätter gab, ist zunächst ein Bild des Volkes Israel unter dem Gesetz. Wie sehr hat Gott sich um sein Volk bemüht, um bei ihm Frucht zu seiner Freude zu finden! Aber alle Bemühungen blieben erfolglos (Lukas 13,6-9). Doch Israel unter dem Gesetz steht nicht für sich allein da. Es illustriert eigentlich jeden Menschen in seinem natürlichen Zustand vor Gott. Die Menschheitsgeschichte von Adam bis zum Kreuz hat zur Genüge bewiesen, dass der Mensch unfähig ist, Frucht für Gott zu bringen. Die Worte des Herrn in Vers 14 sind also das göttliche Urteil über den natürlichen Menschen.
In den Versen 15 bis 19 sehen wir, wie der Messias, der Sohn Davids, mit Unwillen gegen alles vorging, was die Menschen in das Haus Gottes hineingebracht hatten. Anstatt den Tempel als ein Bethaus für alle Menschen offen zu halten, hatten die Juden daraus einen Ort gemacht, wo es Geld zu verdienen gab. Die geistlichen Führer – bekannt für ihre Habsucht – spielten bei diesen gierigen und betrügerischen Geschäften eine wesentliche Rolle. Sie hätten den Herrn Jesus, der dagegen intervenierte, am liebsten umgebracht. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Am Abend verliess Er diese Stadt wieder, die äusserlich so fromm erschien, aber innerlich ganz verdorben war.
Der Glaube an Gott
Am nächsten Morgen ging der Herr Jesus wieder nach Jerusalem. Er beantwortete den Hinweis von Petrus auf den verdorrten Feigenbaum mit den Worten: «Habt Glauben an Gott.» Das ist ein ganz wichtiges Wort für unseren Weg und Dienst als Christen.
So wie Gott damals dem Herrn Jesus geantwortet hat, möchte Er auch unsere vertrauensvollen Bitten erhören und die Hindernisse (Berg) auf dem Weg beseitigen. Damit Er aber auf unsere Gebete antworten kann, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die erste Bedingung ist der vorbehaltlose Glaube an Gott. Ein solches Vertrauen kommt aber nur da zustande, wo der Glaubende eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott geniesst. Diese lebendige Gemeinschaft geht Hand in Hand mit dem Vertrauen zu Ihm.
- Die zweite Voraussetzung hängt mit der Natur Gottes zusammen. Gott ist Liebe. Er hat uns aufgrund des vollbrachten Erlösungswerks unendlich viel vergeben. Wenn wir nun im Vertrauen von Ihm etwas erbitten, muss dieses Gebet in einer Herzenshaltung erfolgen, die dem Gott der Liebe entspricht. Sollte uns jemand Unrecht getan haben, so müssen wir ihm in einer vergebenden Haltung begegnen. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wird Gott unsere Bitten nicht erhören. Stattdessen werden wir seine gerechten Regierungswege mit uns zu spüren bekommen. Das bedeutet, dass wir ernten müssen, was wir gesät haben: Gott wird seine Vergebung im Blick auf die Ewigkeit nicht rückgängig machen, aber Er wird seine väterliche Vergebung zurückhalten.
Die Frage über das Recht des Herrn
Wieder ging der Herr Jesus in den Tempel. Nun kamen die religiösen Führer des Volkes auf Ihn zu. Sie traten als solche auf, die für das Gotteshaus verantwortlich waren, und fragten Ihn, wer Ihm die Vollmacht gebe, so im Tempel aufzutreten, wie Er es am Tag zuvor getan hatte (Markus 11,15-19). Dabei ging es ihnen nicht um die Heiligkeit des Hauses Gottes, sondern um ihre eigene Vorherrschaft.
Als Herzenskenner sah der Herr Jesus die Überlegungen, die hinter ihrer Frage standen. Anstatt ihnen einen sichtbaren Beweis für seine Autorität zu liefern, stellte Er eine Gegenfrage: «Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen?»
Damit traf Er ihre Herzen. Weil sie nicht Buße tun und nicht zu Gott umkehren wollten, hatten sie den Vorläufer des Messias und seinen Aufruf zur Buße abgelehnt. Das Volk aber war der Überzeugung, dass Johannes ein Prophet Gottes war. Nun kamen sie in Verlegenheit. Ihre Überlegungen zeigen, dass sie nicht an einer aufrichtigen Antwort interessiert waren. Um sich aus der Affäre zu ziehen, schoben sie Unwissenheit vor, was aber nichts anderes als eine Lüge war.
Sie waren also nicht in der Lage zu beurteilen, ob Johannes – der von sich sagte, dass er mit einem Auftrag von Gott gekommen war (Johannes 1,23) – die Wahrheit sagte oder nicht. Wie konnten sie sich da anmassen, vom Sohn Gottes, der als Diener und Prophet vor ihnen stand, zu verlangen, sich für sein Tun zu legitimieren? Aus diesem Grund gab der Herr ihnen keine weitere Auskunft.
Das Gleichnis der Weingärtner
Der Herr war bereit zu leiden und zu sterben. Doch den Juden musste Er klar vor die Blicke stellen, wie sie im Begriff standen, das Mass ihrer Ungerechtigkeit vollzumachen. Er tat es mit dem Gleichnis von den Weingärtnern. In dieser Geschichte ist Er selbst der eine geliebte Sohn des Weinbergbesitzers.
Im ersten Vers wird angedeutet, wie Gott für sein Volk – diesen Weinberg – alles getan hat, was Er konnte. Israel genoss vonseiten des Herrn alle erdenklichen Vorzüge. Durch die Knechte, d.h. die Propheten, die Gott zu ihnen sandte, suchte Er Frucht bei seinem Volk. Aber anstatt Frucht für Gott zu bringen, behandelten die Menschen in Israel die Propheten Gottes aufs Schlimmste. Sie verschlossen sich ihrer Botschaft und misshandelten sie. Einige töteten sie sogar (2. Chronika 36,15.16; Nehemia 9,26; Apostelgeschichte 7,52). Schliesslich kam der Augenblick, wo Gott seinen geliebten Sohn als Letzten zu ihnen sandte (Hebräer 1,2). Aber anstatt Ihn als den Gesandten Gottes anzuerkennen und entsprechend zu ehren, brachten sie Ihn um.
Die Schlussverse des Gleichnisses zeigen die Konsequenzen auf: Der jüdischen Nation wurden die Vorrechte als Volk Gottes weggenommen. Gott stellte es für eine Zeit beiseite. Der Stein aber, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Die ungläubigen Führer des Volkes Israel haben den von Gott gesandten Messias verworfen und gekreuzigt. Doch Gott hat Ihn auferweckt und Ihn dadurch als die zentrale und massgebende Person bestätigt.
Die Steuerfrage
Die führenden Leute in Israel verstanden den Inhalt des Gleichnisses und erkannten, dass sie die Weingärtner waren. Am liebsten hätten sie den Herrn Jesus beseitigt. Doch sie fürchteten die Volksmenge, die noch sehr unter dem Einfluss seiner Worte und Werke stand.
Zwei Gruppen, die sonst ganz unterschiedliche Interessen vertraten, schlossen sich zusammen, um dem Herrn eine raffinierte Fangfrage zu stellen. Aber die schönen und schmeichelhaften Worte nützten nichts. Der Sohn Gottes durchschaute ihre Heuchelei und erkannte ihre Überlegungen. Hätte Er ihre Frage «Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben, oder nicht?» mit Ja beantwortet, dann konnte Er nicht der Messias sein, der sie vom Joch der Römer befreien würde. Hätte Er mit Nein geantwortet, dann hätten Ihn die Herodianer bei den Römern als Aufrührer angeklagt.
Die göttlich weise Antwort des Heilands brachte beide Gruppen zur Verwunderung und zum Schweigen. Seine Aussage ist klar: Einerseits hätten sich die Juden demütig unter das Joch beugen sollen, das Gott ihnen durch die Römer auferlegt hatte. Die Zeit der Befreiung und der Wiederherstellung wird kommen, und zwar durch den von Gott gesandten Erretter (Römer 11,26.27). Anderseits sollten sie bis zu dieser Erfüllung in aller Demut Gott das geben, was Ihm gebührt, und die demütigende Unterjochung aus seiner Hand annehmen. Das ungläubige Volk versagte in beiden Punkten. Die Menschen rebellierten gegen die politische Macht, unter der sie standen, und im Blick auf die Ansprüche Gottes zeichneten sie sich durch Heuchelei aus.
Gibt es eine Auferstehung?
Die Sadduzäer waren eine jüdische Sekte. Sie glaubten weder an eine unsichtbare Welt noch an Engel noch an die Auferstehung (Apostelgeschichte 23,8). Sie meinten einfach, Gott habe seinem Volk das Gesetz gegeben. Das sei alles.
Nun kamen diese Leute zu Jesus. Mit einer gestellten Geschichte und einer Frage versuchten sie die Auferstehung anzugreifen und lächerlich zu machen. In seiner Antwort verwies der Herr die Fragesteller auf den Irrtum, der ihren Worten zugrunde lag. Sie meinten, die Beziehungen und Zustände, in denen die Menschen in dieser Welt leben, würden im Jenseits weiter bestehen. Sie vermischten ihre Gedanken mit den Gedanken Gottes. Da sie beides nicht zusammenbrachten, verwarfen sie das, was sie nicht verstanden.
In seiner Weisheit brachte der Herr Jesus seine Widersacher nicht nur zum Schweigen. Er enthüllte gleichzeitig die Wahrheit der leiblichen Auferstehung, die bereits im Alten Testament in verborgener Form gelehrt wurde (z.B. Hiob 19,25.26; Psalm 16,10). Das Bemerkenswerte dabei ist, dass der Herr nur von der Auferstehung der Gläubigen spricht, obwohl auch die Ungläubigen zum Gericht auferstehen werden. Aber nur die Glaubenden werden «aus den Toten auferstehen», wie Er in Vers 25 sagt. Sie werden wie Engel sein, die geschlechtslos sind und nicht sterben.
Obwohl Abraham, Isaak und Jakob – diese Glaubensmänner – längst gestorben waren, als Mose vor dem brennenden Dornbusch stand, nannte sich Gott ihr Gott. Er ist der Gott der Lebenden.
Welches ist das wichtigste Gebot?
Die Schriftgelehrten bildeten eine weitere Gruppe unter den Juden. Nach den Pharisäern, Herodianern und Sadduzäern kam auch einer von ihnen mit einer Frage zu Jesus Christus. Er hatte gehört, wie der Heiland den anderen mit göttlicher Weisheit geantwortet hatte. Da die Schriftgelehrten der Ansicht waren, dass einzelne Gebote bedeutungsvoller seien als andere, hätte der Mann gern gewusst, welches das wichtigste und wertvollste von allen war.
In seiner Antwort ging der Herr nicht auf die zehn Gebote ein, sondern zeigte die grossen Grundsätze des Gesetzes auf. Zuerst wies Er auf die Einzigartigkeit Gottes hin. Es gibt nur einen Gott. Er allein ist es, dem der Name Herr (Jahwe) zukommt. Dann fasste der Herr Jesus das Gesetz zusammen und wies auf die Verantwortung des Menschen hin, die daraus resultierte. Er sollte Gott mit aufrichtigem Herzen lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Jesus Christus hatte dies Tag für Tag vollkommen ausgelebt.
Die Reaktion des Fragestellers zeigt, dass sein Herz und sein Gewissen berührt worden waren. Er erkannte, dass es auf das Herz ankam und nicht auf das formale Halten irgendwelcher Anordnungen. Er war nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Doch die Herrlichkeit des Herrn, der ihm so weise geantwortet hatte, erkannte er nicht. Ebenso wenig sah er die Gnade, die dieser demütige Knecht Gottes offenbarte. Um ins Reich Gottes einzugehen, hätte er sein Versagen im Halten des Gesetzes einsehen und die Gnade des Heilands in Anspruch nehmen müssen.
Der Herr und die Witwe
Als niemand mehr wagte, den Herrn Jesus zu befragen, stellte Er selbst eine Frage. Sie betraf seine eigene Person. Wie konnte Er sowohl der Sohn als auch der Herr Davids sein? Die Antwort war klar: Dieser demütige Knecht und Prophet Gottes, der als Mensch der verheissene Sohn Davids war, ist gleichzeitig Gott, der Sohn – also der Herr des Alten Testaments.
Die Schriftgelehrten hätten das Wort Gottes erklären und selbst nach seinen Anweisungen leben sollen. Doch sie hatten nur eine äussere religiöse Form. Sie suchten ihre eigene Ehre und bereicherten sich auf Kosten der Witwen. Ihr Gericht vonseiten Gottes wird besonders schwer ausfallen.
Mitten in all dieser religiösen Heuchelei entgingen dem göttlichen Auge des Herrn die Glaubenden nicht. Er sah die arme Witwe, die zwei Scherflein in den Schatzkasten des Tempels legte. Die reichen Leute spendeten hohe Beträge. Doch sie gaben von ihrem Überfluss und hatten immer noch viel für sich übrig. Darum legte diese Witwe in den Augen des Herrn mehr ein als sie alle. Sie gab von ihrem Mangel, und zwar alles, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Sie opferte eigentlich sich selbst als ein lebendiges Schlachtopfer (Römer 12,1). Gott sah ihre Herzenshaltung.
Von den Christen in Mazedonien konnte der Apostel Paulus den Korinthern etwas Ähnliches schreiben: Ihre tiefe Armut war in den Reichtum ihrer Freigebigkeit übergeströmt. Dabei «gaben sie sich selbst zuerst dem Herrn» (2. Korinther 8,2-5).
Der Anfang der Wehen
Einer der Jünger machte den Herrn Jesus auf die äussere Herrlichkeit des Tempels aufmerksam. Das gab dem Meister die Gelegenheit, ihn auf die völlige Zerstörung des Tempels hinzuweisen: Infolge des Gerichts, das Gott über sein schuldiges Volk bringen wird, wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden.
Nun fragten Ihn Petrus und drei weitere Apostel, wann dies geschehen werde. In seiner Antwort nannte der Herr keinen Zeitpunkt. Vielmehr beschrieb Er den Zustand seines Volkes im Blick auf den Dienst der Apostel bis zu seinem Kommen in Herrlichkeit.
In diesem Abschnitt geht es nicht um das Evangelium der Gnade für alle Menschen, sondern um den Dienst der Jünger im jüdischen Volk. Sie taten ihn damals als Apostel des Herrn. Ausserdem wird dieser Dienst am Ende der Zeit durch jüdische Boten des treuen Überrests ausgeführt werden. Die Zeit der Gnade, in der wir leben, wird hier ausgeblendet.
Der Herr Jesus kündigte ihnen die Verführung an, die von solchen ausgehen wird, die sich als Christus ausgeben werden. Er sprach aber auch von der Verfolgung um seines Namens willen. Das erlebten die Apostel zu Beginn der Apostelgeschichte. Das werden auch jene erfahren, die am Ende der Zeit das Evangelium des Reichs allen Nationen predigen werden. Vers 13 zeigt die tiefe Ursache des Hasses gegen die Boten des Herrn: Es ist die Offenbarung Gottes in der Person von Jesus Christus. Gott als solchen tolerieren viele. Sobald aber der Name Jesus verkündigt wird, regt sich Widerstand und Hass.
Der Gräuel der Verwüstung
Diese Verse sprechen ausschliesslich von der heute noch zukünftigen Zeit des Endes, die dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit unmittelbar vorausgeht.
Der «Gräuel der Verwüstung» ist ein Götzenbild, das der Antichrist im Tempel aufstellen wird. Eine Andeutung darauf finden wir bereits in Daniel 12,11. Von dem Gegenchristus hatte der Herr in Johannes 5,43 gesagt: «Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.» Unter dem Einfluss dieser Person werden die Juden sich wieder dem Götzendienst zuwenden (Matthäus 12,43-45).
Dann wird das göttliche Gericht über das Volk und die Stadt Jerusalem kommen: eine noch nie dagewesene Drangsal. Sie wird 3 ½ Jahre dauern. Auch wenn der Herr Jesus über so ernste Zeiten reden muss, bleibt seine Güte bestehen. In den Versen 17 und 18 denkt Er an die Schwangeren und Stillenden in jenen furchtbaren Tagen und fordert die Jünger auf, dafür zu beten, dass die Flucht nicht im Winter stattfinde.
Am Ende der Drangsalszeit wird jede bestehende Ordnung umgestürzt werden. Schliesslich werden die Menschen Den kommen sehen, der die Erde nicht nur erschaffen hat, sondern durch seinen Tod als Sohn des Menschen auch ein Anrecht an sie erworben hat.
Die Auserwählten in den Versen 20 und 22 sind die gottesfürchtigen Juden, die den Antichristen nicht anerkennen werden. Der Herr Jesus wird sie am Ende der Drangsalszeit durch sein Erscheinen befreien. Sie werden zusammen mit den von den Engeln Gesammelten in den Segen des Tausendjährigen Reichs eingehen.
Wacht und betet!
Der Feigenbaum ist ein Bild des Volkes Israel. Die weichen Zweige und das Hervortreiben der Blätter deuten die Rückkehr der Juden in das Land Israel und das Erscheinen des treuen Überrests in der Zeit der Drangsal an. Dann weiss man, dass der Sommer, d.h. die Zeit des Tausendjährigen Reichs, nahe ist. Mit dem Ausdruck «dieses Geschlecht» sind die ungläubigen Juden gemeint, die es bis ans Ende geben wird.
Wie tröstlich sind die Worte des Herrn in Vers 31! Sie gelten zunächst für das, was Er über die Zukunft gesagt hat. Alles wird in Erfüllung gehen. Dieser Vers ist aber auch eine Ermunterung für jeden Bibelleser. Was in diesem Buch steht, ist absolut verlässlich, weil Gott es gesagt hat.
Am Schluss des Kapitels werden wir ermahnt, zu wachen und zu beten. Der Herr Jesus ist dieser Mensch, der ausser Landes reiste. Wir, die Gläubigen, sind seine Knechte. Jedem von uns hat Er einen Auftrag erteilt. Nun sollen wir wachen – man könnte auch sagen: an der Arbeit sein –, damit Er uns bei seinem Kommen nicht als Schlafende, sondern als Wachende vorfindet.
In Vers 35 werden die vier Nachtwachen aufgezählt, in die man damals die Nacht einteilte. Vom Tag wird nichts gesagt. Daraus lernen wir, dass die Abwesenheit des Herrn Jesus die Situation auf der Erde zu einer geistlichen Nacht macht (Römer 13,11-14). In dieser Nacht sollen wir wachen. Woher nehmen wir die Kraft, um wach zu bleiben und nicht einzuschlafen? Sie liegt im Gebet. Darum heisst es: «Wacht und betet.»
Eine Frau salbt den Herrn Jesus
Die Führer des Volkes Israel suchten eine Möglichkeit, Jesus von Nazareth, der ihnen so verhasst war, zu töten. Da sie einen Aufruhr des Volkes befürchteten, sagten sie: «Nicht an dem Fest.» Das war ihre Meinung. Gott aber sagte: An dem Fest! Sein Sohn sollte nämlich das wahre Passahlamm werden, das für uns sterben musste. Als Erfüllung aller Passahlämmer, die im Lauf der Zeit geschlachtet worden waren, sollte Er am Tag des Passah sterben.
Gerade in der Zeit, als der Hass gegen den Herrn Jesus wuchs und sein Tod näher rückte, erfuhr Er in Bethanien ein besonderes Zeichen der Liebe und Hingabe. Aus dem Johannes-Evangelium wissen wir, dass die Frau, die Ihn salbte, Maria von Bethanien war. Sie hatte früher zu seinen Füssen gesessen und seinem Wort zugehört (Lukas 10,39). Ihr Herz schlug hingebungsvoll für Ihn, und sein Wort hatte bei ihr geistliches Verständnis hervorgerufen. Nun wollte sie Ihm ihre Wertschätzung bezeugen und seinen Körper im Voraus zum Begräbnis salben.
Die anwesenden Jünger hatten kein Empfinden dafür und betrachteten das Ausgiessen des Salböls als Verschwendung. Der Herr Jesus aber nahm die Frau in Schutz und sagte: «Sie hat ein gutes Werk an mir getan», und: «Sie hat getan, was sie vermochte.» Der Herr vergisst nichts von dem, was wir in Hingabe an Ihn getan haben, und sei es noch so gering und unbedeutend in den Augen der Menschen. Die Tat von Maria sollte zu einem Denkmal von Hingabe und Liebe zu Christus werden (Vers 9).
Der Ort für die Passahfeier
Judas, der jahrelang in der Nähe des Heilands gewesen war, der seine Worte und Werke erlebt hatte, wurde vom Teufel getrieben und von der Habsucht überwältigt. Weil er sein Herz dem Herrn Jesus nie geöffnet hatte, war er jetzt soweit, seinen Meister gegen Geld an seine Feinde zu verraten. Er suchte nur noch eine geeignete Gelegenheit, um seine böse Tat umzusetzen.
Es war das letzte Passah, das der Herr Jesus mit seinen Jüngern feiern wollte. In der Stadt gab es bereits ein durch die Gnade zubereitetes Herz, das dem Herrn Jesus dafür sein Gastzimmer zur Verfügung stellte. Obwohl Er als demütiger Knecht vor uns steht, ist Er doch Der, dem alle Rechte gehören.
Nach seinem Kreuzestod trat das Mahl des Herrn an die Stelle der Passahfeier. Mit diesem Gedächtnismahl denken wir jeden Sonntag an seinen Tod. Darum können wir in diesem Abschnitt eine schöne Illustration des Zusammenkommens der Gläubigen zu seinem Namen hin erkennen (Matthäus 18,20). Wir versammeln uns in der Welt (Stadt). Der Mensch mit dem Wasserkrug ist ein Bild des Heiligen Geistes, der uns durch das Wort Gottes unterweist. Das Gastzimmer deutet an, dass wir als Glaubende nur vorübergehend auf der Erde sind. Unsere Heimat ist das Vaterhaus droben. Das mit Polstern belegte Obergemach stellt das Zusammenkommen als Versammlung als einen Ort der Ruhe und des Friedens dar. Die Gemeinschaft mit unserem Herrn, zu dem wir versammelt sind, erhebt uns über die Umstände. Da geniessen wir gemeinsam die Gemeinschaft mit unserem geliebten Herrn und atmen Himmelsluft.
Das Passah und das Gedächtnismahl
Am Abend kam der Heiland, um mit den Zwölfen das Passah in Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten zu feiern. Doch Er stand im Begriff, eine grössere und bessere Erlösung zu vollbringen. Aber dazu musste Er sterben.
Es bedrückte Ihn jedoch, dass einer, der mit Ihm zu Tisch lag, Ihn an seine Feinde verraten würde. Diese traurige Sache stellte Er nun allen vor. Wie reagierten die Jünger? Sie glaubten dem Wort des Herrn. Sie hatten volles Vertrauen in Ihn, aber sie misstrauten sich selbst und fragten ängstlich: «Doch nicht ich?» In diesem Evangelium wird nichts über die Entlarvung von Judas gesagt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Tatsache, dass der Verräter einer der Zwölf war und ein schreckliches Gericht über ihn kommen wird.
Ab Vers 22 war Judas nicht mehr dabei. Nun setzte der Herr Jesus sein Gedächtnismahl ein. Diese Zeichen – das Brot und der Kelch – erinnern uns jeden Sonntag, wenn wir sein Mahl halten, an seine Liebe zu uns und an seinen Tod für uns. Das vergossene Blut weist auf den Tod hin, der eintreten musste, damit die Sünden vergeben und wir erlöst werden konnten. Seitdem unser Heiland gestorben, aber auch auferstanden ist, wissen wir, dass Gott sein Werk angenommen hat und wir für ewig in Sicherheit sind. Die Vergebung unserer Sünden ist vollständig, vollkommen und ewig (Hebräer 10,10-14).
Bei der Ankündigung in Vers 25 geht es um seine Beziehung zum irdischen Volk Israel. Durch seinen Tod wurde sie unterbrochen. In der Zeit von seinem Tod bis zur Errichtung des Reichs in Herrlichkeit empfindet Er keine Freude mehr an Israel.
Eine Warnung an Petrus
Nachdem der Herr mit den Elfen ein Loblied gesungen hatte, verliessen sie den Obersaal und machten sich auf den Weg zum Ölberg. Unterwegs sprach der Herr Jesus von dem, was sich in den nächsten Stunden ereignen würde. Er, der Hirte, der bis dahin für seine Schafe gesorgt hatte, musste sterben. Keiner seiner Jünger konnte Ihn dabei begleiten. Er musste das Werk der Erlösung ganz allein vollbringen. Die verängstigten Jünger würden wie Schafe zerstreut werden – aber nicht für immer.
Wie bei früheren Gelegenheiten sprach der Herr auch jetzt nicht nur von seinem Tod am Kreuz, sondern auch von seiner Auferstehung. Nach seiner Auferweckung würde Er ihnen voraus nach Galiläa gehen. Dort, wo sein Hauptarbeitsgebiet gewesen war, sollten sie Ihn wiedersehen (Matthäus 28,10).
Voller Selbstvertrauen widersprach Petrus seinem Meister. Er meinte es aufrichtig und ernst. Aber das genügte nicht. Der Herr wusste, dass die eigene Kraft eines Menschen nicht ausreicht, um es mit den Angriffen und Listen Satans aufnehmen zu können. Es wird immer zu einer Niederlage führen.
Petrus vertraute hier so sehr auf sich selbst, dass er dem Herrn sogar ein zweites Mal widersprach und beteuerte, dass er Ihn nicht verleugnen würde. Auch die anderen Jünger versuchten zu zeigen, wie sehr sie sich für ihren geliebten Meister einsetzen wollten. Jetzt schwieg der Herr. Die bitteren Erfahrungen mussten sie nun selbst machen. Es wäre aber nicht nötig gewesen, wenn sie auf sein Wort gehört hätten.
Im Garthen Gethsemane
Der Herr Jesus liess acht Jünger am Eingang des Gartens Gethsemane zurück und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Sie sollten wachen, während Er zu seinem Vater betete.
Weshalb war seine Seele bis zum Tod betrübt? Weil hier der Tod als Lohn der Sünde vor Ihm stand. Er sah den ganzen Umfang des Erlösungswerks, das Er im Begriff stand zu vollbringen. Dabei würde Er – der Heilige, Reine und Sündlose – unsere Sünden an seinem Leib auf dem Kreuz tragen und dafür von Gott bestraft werden. Niemals konnte Er wünschen, zur Sünde und zum Fluch gemacht zu werden. Deshalb betete Er, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an Ihm vorübergehe. «Abba, Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir weg!» Aber wenn wir der ewigen Strafe für unsere Sünden entgehen sollten, musste Er für uns ins Gericht gehen. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. So beugte Er sich unter den Willen seines Vaters und erklärte: «Nicht, was ich will, sondern was du willst!» Anbetungswürdiger Herr! Nie werden wir Dir dafür genug danken können!
Während unser Heiland in ernstem Gebet war, schlief Petrus, der behauptet hatte, mit Ihm sterben zu wollen. Und der Meister? Auch in der grössten Seelennot nahm Er sich Zeit für seine Jünger. Er dachte in Liebe an die Seinen, die in Gefahr standen, durch Satan zu Fall zu kommen. Darum forderte der Herr sie auf, zu wachen und zu beten. «Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach.» An dieser Schwachstelle würde der Feind angreifen.
Jesus wird festgenommen
Unterdessen war auch der Verräter mit einer Schar bewaffneter Leute nach Gethsemane gekommen. Der Herr Jesus ging ihm entgegen, denn Er war bereit, zu leiden und zu sterben. Bei Judas Iskariot sehen wir, wie weit es mit einem Menschen kommen kann, der sich der Gnade des Heilands verschliesst und dann von Satan verhärtet wird. Mit einem Kuss, dem Ausdruck von Zuneigung, verriet er seinen Meister an die Feinde.
Oftmals war Jesus seinen Widersachern entgangen. Doch jetzt liess Er sich gefangen nehmen. Ihre Stunde und die Gewalt der Finsternis war gekommen (Lukas 22,53). Nun hatte der Herr noch ein Wort an seine Häscher, denn Er wollte vor allem der Autorität der Schriften Zeugnis geben. Täglich lehrte Er öffentlich im Tempel. Warum hatten sie Ihn da nicht festgenommen? Weshalb jetzt in der Nacht, als ob Er ein Räuber wäre? «Aber damit die Schriften erfüllt würden.» Weil sie seinen Tod ankündigten, war Er gewillt zu sterben.
Die Schriften offenbaren die Ratschlüsse und Vorsätze Gottes sowie alle seine Gedanken. Deshalb nahm Jesus Christus als Mensch auf der Erde das geschriebene Wort Gottes zur Richtschnur seines Lebens und zum Beweggrund seines Handelns. Während Er in ungetrübter Gemeinschaft mit seinem Vater lebte, hielt Er sich unentwegt ans Wort Gottes.
Alle Jünger verliessen Ihn und flohen. Der Herr Jesus hingegen unterwarf sich in völliger Ruhe seiner Verhaftung. Er war im Gebet mit seinem Vater durch alles hindurchgegangen. Nun wollte Er dessen Willen bis zum Letzten erfüllen.
Jesus wird verhört
Im Garten Gethsemane hatte Petrus versucht, sich mit dem Schwert für den Herrn zu wehren. Weil er es im Eigenwillen getan hatte, war es schief gegangen, so dass der Heiland helfend eingreifen musste (Johannes 18,10; Lukas 22,51). Dann war Petrus mit den anderen Jüngern geflohen. In Vers 54 sehen wir, wie er von weitem nachfolgte und sich mit den Feinden seines Herrn an ihrem Kohlenfeuer wärmte.
Unterdessen begann das Synedrium, Jesus zu verhören. Seine Verurteilung stand jedoch bereits fest. Die Führer des Volkes versuchten nur der Sache einen gerechten Anstrich zu geben. Sie suchten Zeugen, die ihr Urteil stützten. Doch alle gaben falsche Zeugnisse, die nicht einmal übereinstimmend waren. Gegen den einzigen Gerechten gab es keinen einzigen Anklagegrund.
Als das Synedrium auf diesem Weg nicht zum gewünschten Ziel kam, stand der Hohepriester auf und sprach Jesus Christus direkt an. Doch Dieser erwies sich als das Lamm, das stumm ist vor seinen Scherern. Er schwieg zu allen Anklagen. Als der Hohepriester aber fragte: «Bist du der Christus, der Sohn des Gepriesenen?», bezeugte Er die Wahrheit. Sie wurde Ihm jedoch als Lästerung ausgelegt und diente dazu, Ihn zum Tod zu verurteilen.
Der Herr war der Messias und der Sohn Gottes nach Psalm 2. Weil Er als solcher verworfen wurde, nahm Er nun seine Stellung als Sohn des Menschen gemäss Psalm 8 ein. In dieser herrlichen Position werden sie Ihn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes sitzen, aber auch als Richter kommen sehen.
Petrus verleugnet seinen Herrn
Der Herr hätte zwölf Legionen Engel rufen können, um sich gegen die grausame und niederträchtige Behandlung durch die Menschen zu wehren. Er tat es nicht, sondern erduldete alles, was diese bösen Menschen Ihm antaten. Doch schmerzlicher als dies war, dass Er von einem seiner Jünger verleugnet wurde.
Gott hat uns den tiefen Fall von Petrus in seinem ewigen Wort festgehalten, damit uns diese Geschichte zur Warnung dient. Was lernen wir daraus?
- Wenn wir im Selbstvertrauen einen eigenwilligen Weg einschlagen, werden wir keine Kraft haben, der Versuchung zu widerstehen. Die Worte der Magd trafen Petrus unvermittelt und warfen ihn aus der Bahn.
- Wir werden auch keine Kraft haben, um uns von der Welt abzusondern. Nach der ersten Aussage der Magd hätte Petrus den Hof des hohenpriesterlichen Hauses so schnell wie möglich verlassen müssen. Aber er scheint für die Warnungen taub gewesen zu sein.
- Ausserdem werden wir die Kraft zum Zeugnis verlieren. Zweimal wurde Petrus gesagt, dass er einer von den Jüngern des Herrn Jesus sei. Anstatt es zu bejahen, verleugnete er den Herrn und seine Mitjünger.
Glücklicherweise sorgte Gott dafür, dass sich Petrus nach dem zweiten Hahnenschrei an das Wort seines Meisters erinnerte. In Lukas 22,61 heisst es sogar, dass der Herr sich umwandte und seinen Jünger anblickte. Da wurde ihm bewusst, was er getan hatte. Weinend verliess er den gefährlichen Ort. Weil der Herr für ihn gebetet hatte, musste er trotz tiefer Beschämung nicht verzweifeln (Lukas 22,32).
Jesus wird zum Tod verurteilt
In Markus 14,64 wurde das Todesurteil über den Heiland ausgesprochen. Nun führten Ihn die Juden zum römischen Statthalter Pilatus. Er war die oberste richterliche Instanz, die das Todesurteil rechtskräftig machen und auch ausführen konnte. Noch einmal bezeugte der Herr die Wahrheit. Als Pilatus Ihn fragte: «Bist du der König der Juden?», bejahte Er es. Doch zu all den falschen Anschuldigungen schwieg Er. Er übergab sich Dem, der gerecht richtet (1. Petrus 2,23).
In seiner Berichterstattung hebt Markus besonders die Schuld der jüdischen Führerschaft hervor. Doch der römische Richter versagte ebenfalls. Statt der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen, versuchte er den unbequemen Gefangenen auf andere Weise loszuwerden. Die Römer hatten die Gewohnheit, den Juden zum Passahfest einen Gefangenen freizulassen. Nun liess der gewissenlose Richter das Volk wählen: «Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse?» Nein! Aufgewiegelt durch die Führer zogen sie dem Herrn Jesus den Räuber und Mörder Barabbas vor.
«Was wollt ihr denn, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt?» – «Kreuzige ihn!» Das war ihre übermässig laute Forderung. Weil der römische Richter den Juden einen Gefallen tun wollte, ging er darauf ein und verurteilte Jesus zum Kreuzestod. Dadurch hatte der Wille des jüdischen Volkes und nicht die Herrschaft Roms und das römische Recht die Oberhand. Sowohl die Juden als auch der römische Statthalter müssen sich einst vor dem göttlichen Richter dafür verantworten.
Spott und Schläge
Die römischen Legionäre wussten, dass der Herr Jesus bezeugt hatte, Er sei der König der Juden. Sobald der Heiland nach dem Urteilsspruch von Pilatus ihren Händen übergeben war, nahmen sie diesen Titel zum Anlass, um den bereits gegeisselten Gefangenen zu verspotten. Der Purpurmantel deutete die Farbe der Könige an (Richter 8,26). Anstelle einer Königskrone flochten sie eine Krone aus Dornen und drückten sie auf sein Haupt. Dann trieben sie ihren grausamen Spott mit Ihm, indem sie Ihn als König begrüssten, ihre Knie vor Ihm beugten und Ihm huldigten. Gleichzeitig schlugen sie mit einem Rohrstab auf sein dornengekröntes Haupt und spien Ihn an. Was wird es sein, wenn diese Menschen einmal vor Ihm als dem Weltenrichter stehen werden und erkennen müssen, dass Der, den sie so misshandelt hatten, wirklich die höchste Autorität ist?
Nachdem sie ihre Brutalität an Ihm ausgelassen und Ihn als König der Juden gedemütigt hatten, führten sie Ihn zur Kreuzigung hinaus. So wurde Er die Erfüllung all der Sündopfer im Alten Testament, die ausserhalb des Lagers verbrannt wurden (3. Mose 4,12.21; Hebräer 13,12).
Auf dem Weg zur Richtstätte zwangen die römischen Soldaten einen unbeteiligten Mann, der vom Feld kam, das Kreuz des Herrn Jesus zu tragen. Über den Eindruck, den dieser Zwischenfall auf Simon von Kyrene machte, lesen wir nichts. Aber Gott hat diesen Dienst an seinem Sohn im ewigen Wort festgehalten. Die Söhne von Simon scheinen zur Zeit der Niederschrift dieses Evangeliums unter den Christen gut bekannt gewesen zu sein.
Die Kreuzigung
Unser Heiland wurde um die dritte Stunde, also um 9 Uhr morgens, gekreuzigt. In den ersten drei Stunden litt Er unter dem Spott, der Schmähung und Verachtung vonseiten der Menschen. Die Soldaten nahmen Ihm seine Kleider weg und verteilten sie durch das Los untereinander. Es erfüllte sich eine Prophezeiung aus dem Alten Testament: «Sie schauen und sehen mich an; sie teilen meine Kleider unter sich, und über mein Gewand werfen sie das Los» (Psalm 22,18.19).
Auch die Aufschrift mit seiner Beschuldigung, die auf das Kreuz gesetzt wurde, war als Spott gedacht: «Der König der Juden.» In der Zukunft, wenn die Juden auf Ihn blicken werden, den sie durchbohrt haben, werden sie zur Einsicht kommen, dass sie damals ihren Messias gekreuzigt haben (Sacharja 12,10).
In den Versen 29 bis 32 werden drei Gruppen von Menschen aufgezählt, die alle den Gekreuzigten verspotteten. Die Vorübergehenden nahmen seine Aussage aus Johannes 2,19 zum Anlass, Ihn zu lästern. Die religiösen Führer mussten in ihrem Spott bekennen, dass Er andere gerettet hatte. Sich selbst konnte Er tatsächlich nicht retten, wenn Er sein Leben als Lösegeld für viele geben wollte (Markus 10,45). Wäre Er vom Kreuz herabgestiegen, hätte kein Sünder errettet werden können. Schliesslich lesen wir von den beiden mitgekreuzigten Räubern, dass sie Ihn schmähten. Das Lukas-Evangelium berichtet, dass einer von ihnen seine Meinung noch geändert und den Heiland um Gnade angefleht hatte. Er wurde gerettet und ging am gleichen Tag mit dem Erlöser ins Paradies.
Jesus lässt sein Leben
Die Liebe des Heilands war stärker als der Hass der Menschen. Er blieb am Kreuz – für dich und für mich! Ab Vers 33 geht es um unendlich viel mehr als um die Leiden vonseiten der Menschen, obwohl diese überaus schlimm waren. Aber welch ein Unterschied zwischen dem, was die Menschen Ihm antaten und der Strafe, die Gott für unsere Sünden und für die Sünde an Ihm vollzog!
Von der sechsten bis zur neunten Stunde wurde es finster. Da war Christus allein mit Gott, verborgen vor den Augen der Menschen. In diesen drei Stunden bezahlte Er unsere Schuld vor Gott, denn die Strafe zu unserem Frieden lag auf Ihm. Da wurde Er, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht.
In Psalm 22,12 lesen wir, wie Er prophetisch zu Gott sagt: «Sei nicht fern von mir!» Doch Er war von Ihm verlassen. Ja, Gott musste sein Angesicht von Dem abwenden, der für uns zur Sünde gemacht wurde. Es musste sein – sowohl zur Herrlichkeit und Majestät Gottes als auch zu unserer Errettung. Aber wer kann die Tiefen der Leiden ermessen, durch die der Heiland in jenen Stunden ging? Kein Mensch!
Nach den drei Stunden der Finsternis war das gewaltig grosse Erlösungswerk vollbracht. «Jesus aber gab einen lauten Schrei von sich und verschied.» Er opferte sich ohne Flecken Gott, und Gott legte die Sünden vieler auf Ihn. Er musste sterben. Aber niemand nahm Ihm sein Leben. Er gab es freiwillig in den Tod, ohne irgendein Anzeichen von Schwäche. Nun konnte Gott den Scheidevorhang des Tempels zerreissen. Der Zugang zu Ihm war offen.
Die Grablegung
Der laute Schrei, mit dem Jesus seinen Geist in die Hände des Vaters übergab, traf das Gewissen des römischen Hauptmanns. So hatte er noch keinen Gekreuzigten sterben sehen. Er musste laut sagen, was er dachte: «Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!»
Gottesfürchtige Frauen, die dem Heiland von Galiläa aus nachgefolgt und mit Ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren, hatten von weitem das Geschehen auf Golgatha verfolgt. Sie hatten alles gesehen und gehört: den Spott, die Verachtung, die Misshandlung vonseiten der Feinde, die Finsternis, die Worte des Herrn und schliesslich den Tod ihres Erlösers. Nun war Er gestorben! Was nun?
Gott selbst sorgte dafür, dass nichts Ungeziemendes mit dem toten Leib seines Sohnes geschah. Die ungläubigen Menschen hatten sein Grab bei Gottlosen vorgesehen, «aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod» (Jesaja 53,9). Dieser reiche Mann war Joseph von Arimathia, der bis dahin ein verborgener Jünger Jesu war. Kühn ging er zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Die Bosheit der Menschen, die am Kreuz einen traurigen Höhepunkt erreichte, forderte den Glauben Josephs heraus, so dass er mutig an die Öffentlichkeit trat.
Als er den Leib des Heilands vom Statthalter geschenkt bekommen hatte, nahm er ihn vom Kreuz herab und beerdigte ihn auf würdige Weise in einer Felsengruft. Johannes berichtet noch von einem anderen zaghaften Jünger des Herrn, der Joseph bei der Grablegung unterstützte: Nikodemus (Johannes 19,39).
Der Herr ist auferstanden!
Sobald der Sabbat vorbei war, wollten die Frauen, die dem Herrn Jesus nachgefolgt waren und wussten, wo Er beerdigt war, Ihm die letzte Ehre erweisen. Mit den gekauften Gewürzsalben hatten sie im Sinn, seinen Leib zu salben. Doch sie kamen zu spät. Als sie am ersten Wochentag nach Sonnenaufgang zur Gruft kamen, war Er bereits auferstanden. Kein noch so schwerer Stein, der die Öffnung der Gruft verschloss, konnte den auferstandenen Herrn daran hindern, das Grab zu verlassen. Ein Engel kam aus dem Himmel herab, um den Stein wegzuwälzen, damit jeder sehen konnte, dass das Grab leer war (Matthäus 28,2).
Hier bei Markus lesen wir von den Sorgen dieser Frauen, die sich jedoch als unbegründet erwiesen. Sobald sie aufblickten, sahen sie, dass der grosse Stein bereits weggewälzt war. Der Jüngling, der dort sass – es war ein Engel –, erklärte ihnen, dass der von ihnen Gesuchte auferstanden sei. Sie sollten seinen Jüngern und Petrus sagen, dass Er ihnen nach Galiläa vorausgehen werde. Dort würden sie Ihn wiedersehen.
Wer aber den Auferstandenen als Erste gesehen hatte, war Maria Magdalene. Sie durfte den Jüngern die herrliche Botschaft des Herrn überbringen: «Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott» (Johannes 20,17). Alle Glaubenden gehören seither zur Familie Gottes. Sie sind Kinder Gottes, die Ihn ihren Vater nennen dürfen. In welch eine herrliche Nähe zu Gott sind wir durch das Werk des Herrn Jesus gebracht worden! Aber damals hatten die Jünger Mühe, die Tatsache der Auferstehung zu glauben.
Predigt das Evangelium!
Die Berichterstattung von Markus ist bis ins letzte Kapitel kurz gehalten. Was über Maria Magdalene in den Versen 9 bis 11 erwähnt wird, finden wir in Johannes 20,11-18 ausführlich beschrieben. Die Begebenheit von den zweien, die aufs Land gingen, wird hier mit zwei Versen erwähnt, in Lukas 24,13-35 aber detailliert erzählt.
Nachdem in den Versen 11 und 13 der Unglaube der elf Apostel unterstrichen wird, offenbarte sich der Herr selbst seinen Jüngern. Er musste sie wegen ihres Unglaubens und ihrer Herzenshärte ernst ermahnen. Doch dann sandte Er gerade diese Männer, die wirklich keine Glaubenshelden waren, mit dem Auftrag in die ganze Welt: «Predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium.» Welch eine Gnade des Herrn, dass Er solche unvollkommenen Werkzeuge gebrauchen wollte!
Die Zeichen in den Versen 17 und 18 sollten ihre Verkündigung begleiten. Sie bestätigten, dass die neue Botschaft – das Evangelium der Gnade und der Errettung für alle Menschen – von Gott selbst kam. Durch die Zeichen wurde den Hörern jeder Vorwand für Zweifel und Unglaube genommen (Vers 20b).
Nachdem der vollkommene Knecht seinen Dienst hier beendet hatte, kehrte Er in den Himmel zurück. Weil Er gleichzeitig der Sohn Gottes ist, konnte Er sich selbst zur Rechten Gottes setzen. Doch bis heute hört Er nicht auf, die Seinen in ihrem Dienst der Verkündigung zu unterstützen. Auch wenn Er dies heute nicht mehr mit Zeichen tut, weil wir das ganze abgeschlossene Wort Gottes besitzen, so wirkt Er doch immer noch mit, wenn das Evangelium gepredigt wird.

Einleitung
Die Psalmen 73 – 89 weisen prophetisch auf das Volk Israel in der Zukunft hin. Ein gläubiger Überrest wird zu Gott umkehren und seine Güte erfahren.
Viele Aussagen können wir auf unser Glaubensleben als Christen übertragen. Sie machen uns Mut, in Schwierigkeiten bei Gott auszuharren. Seine Hilfe kommt rechtzeitig.
Neid auf die Ungerechten
Die Psalmen haben vorwiegend prophetischen Charakter. Sie beschreiben die Erfahrungen und Gebete des treuen Überrests aus dem Volk Israel in der Zukunft. Gott hat damals gläubige Männer und ihre persönlichen Erfahrungen benutzt, um diese inspirierten Texte in sein Wort aufzunehmen. Es sind Erfahrungen, die gläubige Menschen zu allen Zeiten machen. Darum haben die Psalmen auch einen persönlichen Nutzen für uns.
Als Asaph, ein Leiter des Gesangs unter König David (1. Chronika 25,1.6), diesen Psalm dichtete, war sein Glaube ins Wanken geraten. Er wusste zwar, dass Gott sich zu denen bekennt, die aufrichtig in Gottesfurcht leben möchten. Und doch wäre er beinahe vom rechten Weg abgekommen. Der Grund dafür war das Wohlergehen der ungläubigen Menschen im Gegensatz zu seinen täglichen Übungen und Prüfungen.
Den Gottlosen ging es offensichtlich gut. Sie konnten leben, wie sie wollten, hatten Erfolg, wurden reich und dachten sogar: «Wie wüsste es Gott, und wie sollte der Höchste davon Kenntnis haben?» Sie meinten, wenn sie Gott-los lebten, würde Er auch keine Notiz von ihnen und ihrem Tun nehmen.
Nun stiegen Gedanken in Asaphs Innerem auf, die wir vielleicht auch schon gehabt haben: «Was nützt es, ein gottesfürchtiges Leben zu führen und jede aufkommende Sünde im Selbstgericht zu verurteilen?» Doch dann – bevor er wirklich eine Antwort auf seine Not fand – wurde ihm bewusst: Es ist nicht recht, wenn ich so denke.